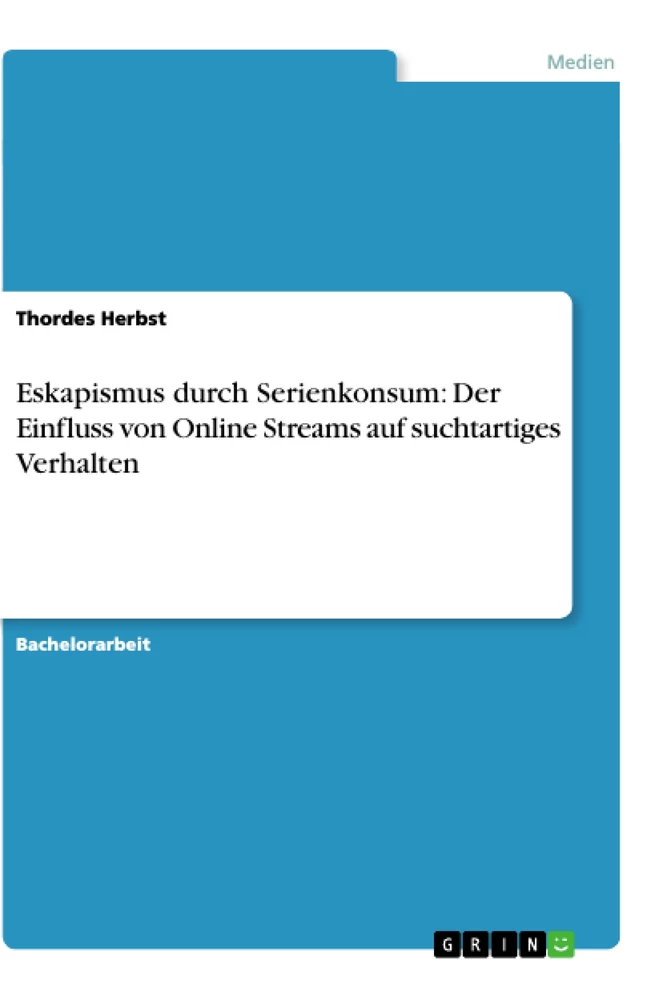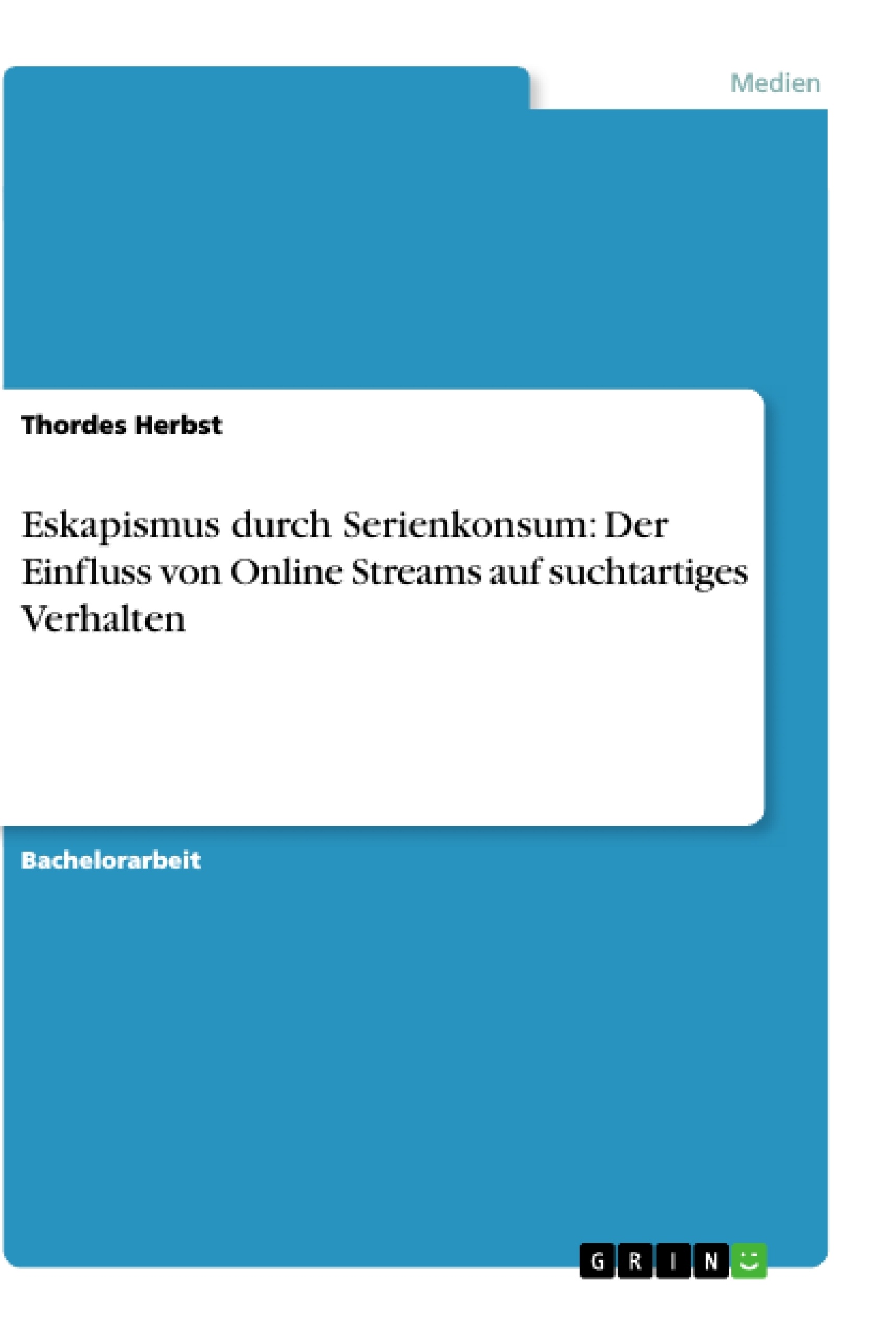Die mediale Landschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Jedes neue Leitmedium beeinflusst die Nutzungsgewohnheiten der Konsumenten. Während die vergangenen Jahrzehnte von Radio und Fernsehen dominiert wurden, ist mit dem Internet eine zusätzliche mediale Großmacht auf dem Spielfeld erschienen. Wie genau sich die neuen Rezeptionsmöglichkeiten des Internets auf die Konsumgewohnheiten der Menschen auswirken, ist bislang ungenügend erforscht. Dabei besteht hier ein großer Handlungsbedarf, um sowohl Chancen als auch Gefahren dieser neuen Entwicklung eruieren zu können.
Das Internet bringt eine neue Dimension der Verfügbarkeit medialer Inhalte mit sich. Die vorliegende Arbeit untersucht erstmals, wie sich dieses Phänomen auf die Gruppe der ‘Serienjunkies’ und auf deren eskapistische Tendenzen auswirkt.
Die neue Omnipräsenz diverser TV-Formate wird besonders an der Distributionsform der Online Streams deutlich. Daher beschränkt sich das Forschungsfeld auf Konsumenten, die ihre Serien auf diese Weise beziehen.
Als theoretisches Fundament der Arbeit dienen neben der Fachliteratur zum Thema Eskapismus auch Werke des Uses – and – Gratifications – Ansatzes. In der Arbeit wird zudem untersucht, inwiefern es sich bei exzessivem Eskapismus um eine Sucht handeln könnte. Hierbei orientiere ich mich an den Diagnosekriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zusätzlich habe ich ein Experteninterview durchgeführt. Die Einschätzungen des Mediensuchtexperten Detlef Scholz sind praxisnah und berücksichtigen zudem die Einflüsse des Internets auf das Verhalten der Probanden.
Ebenfalls wird das Format der TV-Serie definiert und die Funktionsweise von Online Streams erörtert. Aufgrund der aktuellen Relevanz folgt ein Überblick über die rechtliche Beurteilung von Streaming-Seiten.
Die Methodik für die Befragung der Probanden ist der qualitativen Sozialforschung zuzuordnen.
Die Auswertung erfolgt durch eine Kombination aus der sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Paraphrase und der Typologischen Analyse. Mit Hilfe dieses ‘maßgeschneiderten’ Verfahrens können die Forschungshypothesen zum eskapistischen Serienkonsum adäquat überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Forschungsansatz Eskapismus
- 2.2 Hypothese: Zwei „Typen“ von Eskapismus
- 2.3 Klärung des Suchtbegriffes
- 2.4 Das Format der Fernsehserie
- 2.5 Begriffserklärung: Online Streams
- 2.6 Abgrenzung von Streams zu DVD-Konsum
- 2.7 Rechtlicher Hintergrund: Ist das Streamen in Deutschland legal?
- 3. Die Interviews
- 3.1 Methodik
- 3.1.1 Problemzentrierte, leitfadengestützte Interviews nach Mayring
- 3.1.2 Der Fragebogen
- 3.1.3 Die Probanden
- 3.1.4 Aufbereitung: Transkription und Protokoll
- 3.2 Auswertungsverfahren
- 3.3 Auswertung
- 3.3.1 Anna
- 3.3.2 Leonie
- 3.3.3 Veronika
- 3.3.4 Alexander
- 4. Ergebnisse
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Online-Streaming auf das eskapistische Verhalten von Serienkonsumenten. Die Arbeit analysiert, wie die erhöhte Verfügbarkeit von Serien via Internet die eskapistischen Tendenzen bei "Serienjunkies" beeinflusst. Es wird dabei auf theoretische Grundlagen zum Eskapismus und den Uses-and-Gratifications-Ansatz zurückgegriffen.
- Eskapismus durch Serienkonsum
- Die Rolle von Online-Streams
- Typologie des Eskapismus
- Aspekte der Mediensucht
- Rechtliche Aspekte des Online-Streamings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der Medienlandschaft und die zunehmende Nutzung des Internets, insbesondere bei jungen Menschen. Sie hebt die wachsende Bedeutung von Online-Streaming für den Serienkonsum hervor und benennt die Forschungslücke hinsichtlich der Auswirkungen dieser Entwicklung auf eskapistische Tendenzen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Online-Streaming von Serien und Eskapismus bei "Serienjunkies".
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der Arbeit dar. Es beleuchtet verschiedene Forschungsansätze zum Eskapismus, diskutiert den Uses-and-Gratifications-Ansatz und entwickelt die Hypothese von zwei verschiedenen Typen des Eskapismus, die anhand von Verhaltensmerkmalen unterschieden werden können. Der Suchtbegriff wird im Kontext von exzessivem Eskapismus geklärt, das Format der Fernsehserie definiert und die Funktionsweise von Online-Streams erläutert. Schließlich gibt es einen Überblick über die rechtlichen Aspekte des Streamings in Deutschland.
Schlüsselwörter
Eskapismus, Serienkonsum, Online-Streams, Mediensucht, Qualitative Forschung, Uses and Gratifications, Fernsehserien, Internet, Mediennutzung, Leitfadengestütztes Interview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Eskapismus und Online-Streaming von Serien
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Online-Streaming auf das eskapistische Verhalten von Serienkonsumenten. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen der erhöhten Verfügbarkeit von Serien via Internet und den eskapistischen Tendenzen bei „Serienjunkies“. Dabei werden theoretische Grundlagen zum Eskapismus und der Uses-and-Gratifications-Ansatz herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Eskapismus durch Serienkonsum, die Rolle von Online-Streams, eine Typologie des Eskapismus, Aspekte der Mediensucht und die rechtlichen Aspekte des Online-Streamings.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf qualitativer Forschung. Es wurden problemzentrierte, leitfadengestützte Interviews nach Mayring durchgeführt. Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand eines detaillierten Verfahrens, das im Text beschrieben wird.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Die Interviews (inkl. Methodik und Auswertung), Ergebnisse und Ausblick. Die Einleitung beschreibt den Wandel der Medienlandschaft und die Forschungslücke. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar, einschließlich verschiedener Forschungsansätze zum Eskapismus, dem Uses-and-Gratifications-Ansatz und einer Hypothese zu zwei Typen des Eskapismus. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Interviews, die Durchführung und die Auswertung der Interviews mit vier Probanden (Anna, Leonie, Veronika und Alexander). Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse und Kapitel 5 gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit entwickelt die Hypothese von zwei verschiedenen Typen des Eskapismus, die anhand von Verhaltensmerkmalen unterschieden werden können.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Eskapismus, Serienkonsum, Online-Streams, Mediensucht, Qualitative Forschung, Uses and Gratifications, Fernsehserien, Internet, Mediennutzung, Leitfadengestütztes Interview.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Forschungsansätze zum Eskapismus und den Uses-and-Gratifications-Ansatz. Der Suchtbegriff wird im Kontext von exzessivem Eskapismus geklärt.
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Aspekte des Online-Streamings in Deutschland.
Wer waren die Probanden?
Die Studie umfasst Interviews mit vier Probanden: Anna, Leonie, Veronika und Alexander.
- Quote paper
- Thordes Herbst (Author), 2012, Eskapismus durch Serienkonsum: Der Einfluss von Online Streams auf suchtartiges Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201455