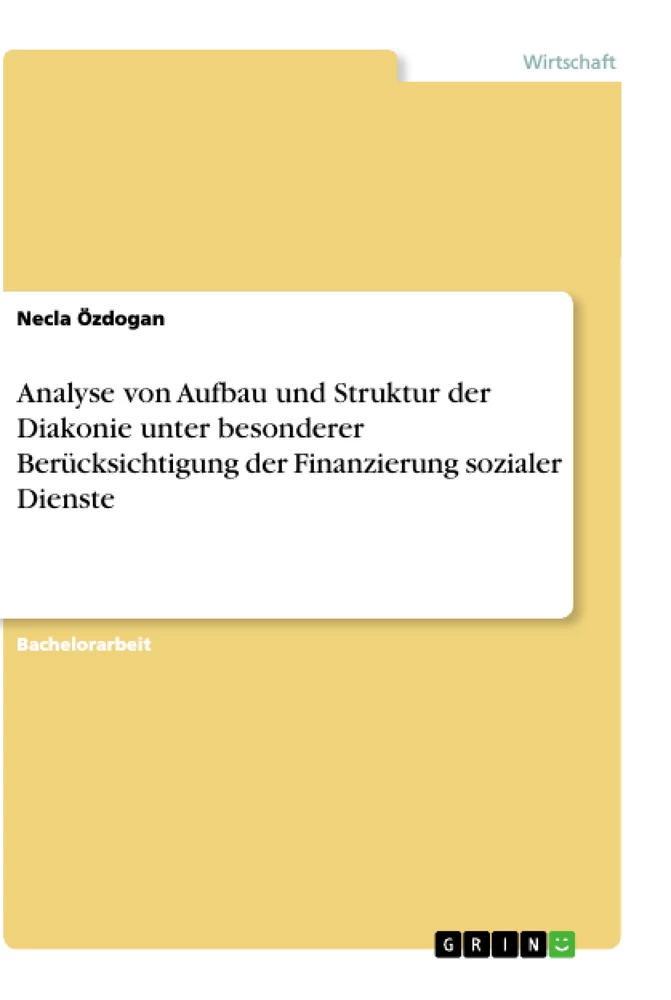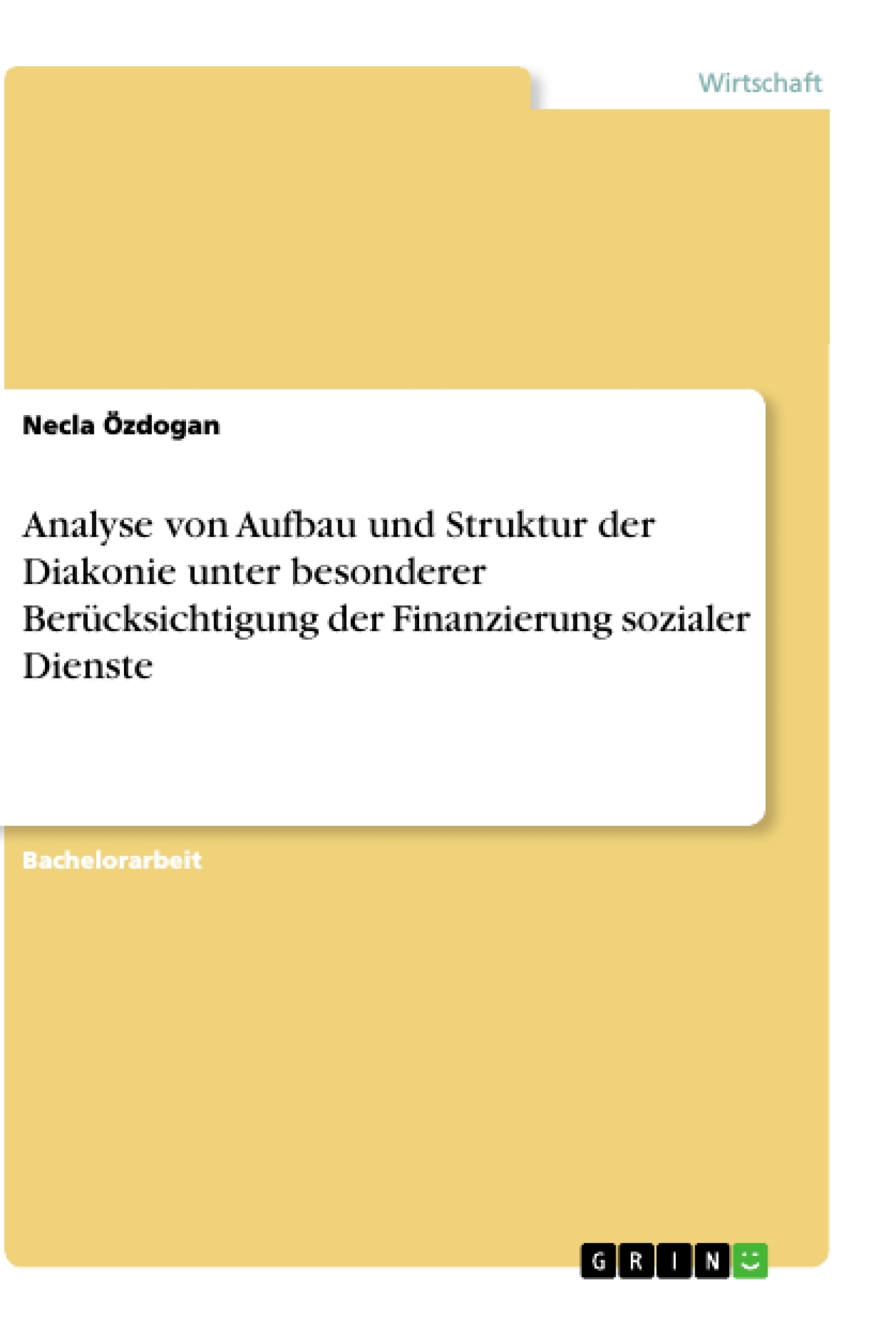1. Einleitung
„Der Non-Profit-Sektor bleibt ein weißer Fleck auf der Landkarte der modernen Gesellschaften, unsichtbar für Politiker, Wirtschaftsführer und sogar für
viele Angehörige des Sektors selbst.“
Der sogenannte Dritte Sektor bezeichnet Non-Profit-Organisationen, die eine Stellung zwischen Markt und Staat einnehmen. Diese befinden sich in einem stetigen Wachstum; sei es als bedeutende Wirtschaftskraft, aus arbeitsmarktpolitischer Sicht oder aber durch ihre Beiträge zum politischen und sozialen Leben.
Allein im Jahr 1995 wurde in diesem Sektor 3,9 % des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Zudem waren im Jahr 1995 ca. 2,1 Mio. Menschen in Deutschland im Non-Profit-Sektor beschäftigt, was wiederum ca. 5 % der Gesamtbeschäftigung in der BRD ausmacht.
Im deutschen Dritten Sektor dominieren vor allem Wohlfahrtsverbände, die insbesondere im Bereich der sozialen Dienste tätig sind, die den größten Anteil des Dritten Sektors ausmacht. Allein die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Paritätischer Gesamtverband, Deutsches Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Diakonisches Werk der EKD) und die ihr angeschlossenen Träger und Einrichtungen tragen ca. drei viertel der sozialen Dienste und werden dabei vor allem durch die öffentlichen Hand finanziert. Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege stehen jedoch als Anbieter sozialer Dienste vor erheblichen Herausforderungen, da der Markt ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Zum einem führen demografische und gesellschaftliche Entwicklungen zu einer steigenden Nachfrage nach sozialen Diensten und zum anderen werden diese nicht mehr von den knappen Finanzmitteln der öffentlichen Haushalte finanzierbar sein.
Aus diesem Grund ist das Ziel dieser Arbeit, die Auswirkungen des Aufbaus und der Struktur der Diakonie als größter Einrichtungsträger im Bereich sozialer Dienste im Hinblick auf deren Finanzierung zu analysieren. Die Arbeit soll aufzeigen welche Finanzmittel der Diakonie aufgrund ihrer Struktur und ihrem Aufbau zur Verfügung stehen. Denn erst durch die Ermittlung des Istzustandes im Hinblick auf deren Aufbau, Struktur und Finanzierung ist es möglich, zukünftige Entwicklungen vor allem in Bezug auf Finanzierungsprobleme zu prognostizieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Träger sozialer Dienste
- 2.1. Allgemeine Definitionsansätze sozialer Dienste
- 2.2. Charakterisierung sozialer Dienste
- 2.3. Träger und Anbieter sozialer Dienste
- 2.3.1. Öffentliche Träger
- 2.3.2. Privatgewerbliche Träger
- 2.3.3. Träger der freien Wohlfahrtspflege
- 2.4. Zwischenfazit
- 3. Organisationsstruktur der Diakonie als größter Träger sozialer Dienste
- 3.1. Struktur des Diakonischen Werkes der EKD
- 3.1.1. Elemente des Verbands
- 3.1.1.1. Aufgabe als Spitzenverband
- 3.1.1.2. Stellung als Spitzenverband und die Auswirkung auf die Organisation
- 3.1.2. Element der Kirche
- 3.1.2.1. Verhältnis von Diakonie und evangelischer Kirche
- 3.1.2.2. Auswirkung auf die Struktur der Diakonie
- 3.1.3. Element des Vereins
- 3.1.3.1. Rechtsform „eingetragener Verein“
- 3.1.3.2. Auswirkung auf die Organisation der Diakonie
- 3.2. Mitglieder des Diakonischen Werkes und deren Strukturen
- 3.2.1. Unmittelbare Mitglieder
- 3.2.2. Mittelbare Mitglieder
- 3.3. Organisationsaufbau und Verbandsgliederung
- 3.3.1. Regionalprinzip
- 3.3.2. Fachprinzip
- 3.4. Organe des Diakonischen Werkes
- 3.5. Hauptgeschäftsstelle
- 3.6. Aufgabenbereiche und Mitarbeiter
- 4. Finanzierung der sozialen Dienste in der Diakonie
- 4.1. Öffentliche Finanzierung
- 4.2. Eigenmittel
- 4.3. Zwischenfazit
- 5. Perspektiven und alternative Finanzierungsmodelle
- 5.1. Zukünftige Herausforderungen der Diakonie
- 5.2. Ursachen der Finanzierungsprobleme
- 5.3. Alternative Finanzierungsmodelle
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert den Aufbau und die Struktur der Diakonie als größten Träger sozialer Dienste in Deutschland, mit besonderem Fokus auf deren Finanzierungsmodelle. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Organisationsstruktur und der damit verbundenen Herausforderungen im Hinblick auf die Finanzierung sozialer Dienste zu entwickeln.
- Organisationsstruktur der Diakonie
- Finanzierungsmodelle sozialer Dienste in der Diakonie
- Öffentliche und private Finanzierung
- Herausforderungen und zukünftige Perspektiven der Finanzierung
- Alternative Finanzierungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Analyse von Aufbau und Struktur der Diakonie unter Berücksichtigung der Finanzierung sozialer Dienste. Sie skizziert den Forschungsansatz und die Gliederung der Arbeit.
2. Grundlagen und Träger sozialer Dienste: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es definiert soziale Dienste, charakterisiert diese und beschreibt verschiedene Träger und Anbieter, darunter öffentliche, privatgewerbliche und Träger der freien Wohlfahrtspflege. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung und den jeweiligen Merkmalen dieser Trägerkategorien, um den Platz der Diakonie im Gesamtsystem zu verdeutlichen.
3. Organisationsstruktur der Diakonie als größter Träger sozialer Dienste: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Organisationsstruktur des Diakonischen Werkes der EKD. Es beleuchtet die Elemente des Verbands (Spitzenverband, Element der Kirche, Element des Vereins), die Mitgliederstruktur (unmittelbare und mittelbare Mitglieder), den Organisationsaufbau (Regional- und Fachprinzip) und die Organe des Werkes (Diakonische Konferenz, Diakonischer Rat, Vorstand). Es wird der Zusammenhang zwischen der rechtlichen Form und der Organisation sowie der Einfluss der kirchlichen Zugehörigkeit auf die Struktur umfassend untersucht.
4. Finanzierung der sozialen Dienste in der Diakonie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Finanzierung sozialer Dienste innerhalb der Diakonie. Es analysiert öffentliche Finanzierung (Rahmenbedingungen, Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis, Finanzierungsformen wie Zuwendungsfinanzierung und Leistungsentgelt) und Eigenmittel (Kirchensteuer, Spenden, sonstige Eigenmittel). Die verschiedenen Finanzierungsströme werden detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für die Handlungsfähigkeit der Diakonie herausgearbeitet.
5. Perspektiven und alternative Finanzierungsmodelle: Dieses Kapitel beleuchtet zukünftige Herausforderungen der Diakonie, wie den demografischen Wandel und die soziale Spaltung. Es analysiert die Ursachen der Finanzierungsprobleme und stellt alternative Finanzierungsmodelle vor, z.B. Förderprogramme der KfW-Bankengruppe, Mezzanine-Kapital, das Investor-Betreiber-Modell und Immobilienfonds. Die Eignung dieser Modelle für die Diakonie wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Diakonie, soziale Dienste, Finanzierung, Organisationsstruktur, Trägerlandschaft, Wohlfahrtspflege, öffentliche Finanzierung, Eigenmittel, alternative Finanzierungsmodelle, demografischer Wandel, Sozialstaatlichkeit, Subsidiarität, Pluralität der Trägerschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Aufbau und Finanzierung der Diakonie
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert den Aufbau und die Struktur der Diakonie als größten Träger sozialer Dienste in Deutschland, mit besonderem Fokus auf deren Finanzierungsmodelle. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Organisationsstruktur und der damit verbundenen Herausforderungen im Hinblick auf die Finanzierung sozialer Dienste zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Organisationsstruktur der Diakonie, die Finanzierungsmodelle sozialer Dienste (öffentliche und private Finanzierung), die Herausforderungen und zukünftigen Perspektiven der Finanzierung sowie alternative Finanzierungsmodelle. Es wird detailliert auf die Elemente des Verbands (Spitzenverband, Element der Kirche, Element des Vereins), die Mitgliederstruktur, den Organisationsaufbau (Regional- und Fachprinzip) und die Organe des Diakonischen Werkes eingegangen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Träger sozialer Dienste, Organisationsstruktur der Diakonie, Finanzierung der sozialen Dienste in der Diakonie, Perspektiven und alternative Finanzierungsmodelle sowie Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Definition sozialer Dienste und der Beschreibung verschiedener Träger, über die detaillierte Analyse der Diakonischen Organisationsstruktur bis hin zur Diskussion zukünftiger Herausforderungen und alternativer Finanzierungsansätze.
Welche Arten von Trägern sozialer Dienste werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen öffentlichen, privatgewerblichen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege. Die Diakonie wird als Träger der freien Wohlfahrtspflege eingeordnet und deren spezifische Merkmale werden im Detail untersucht.
Wie wird die Diakonie finanziert?
Die Finanzierung der Diakonie umfasst öffentliche Mittel (Zuwendungsfinanzierung und Leistungsentgelt) sowie Eigenmittel (Kirchensteuer, Spenden, sonstige Eigenmittel). Die Arbeit analysiert die verschiedenen Finanzierungsströme und deren Bedeutung für die Handlungsfähigkeit der Diakonie.
Welche Herausforderungen und Perspektiven werden für die zukünftige Finanzierung der Diakonie diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet zukünftige Herausforderungen wie den demografischen Wandel und die soziale Spaltung. Es werden die Ursachen der Finanzierungsprobleme analysiert und alternative Finanzierungsmodelle wie Förderprogramme, Mezzanine-Kapital, das Investor-Betreiber-Modell und Immobilienfonds vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für die Diakonie diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Diakonie, soziale Dienste, Finanzierung, Organisationsstruktur, Trägerlandschaft, Wohlfahrtspflege, öffentliche Finanzierung, Eigenmittel, alternative Finanzierungsmodelle, demografischer Wandel, Sozialstaatlichkeit, Subsidiarität, Pluralität der Trägerschaft.
Wo finde ich mehr Details zur Organisationsstruktur der Diakonie?
Kapitel 3 der Arbeit analysiert detailliert die Organisationsstruktur des Diakonischen Werkes der EKD, einschließlich der Elemente des Verbands, der Mitgliederstruktur, des Organisationsaufbaus (Regional- und Fachprinzip) und der Organe des Werkes.
Wo finde ich Informationen zu alternativen Finanzierungsmodellen für die Diakonie?
Kapitel 5 der Arbeit stellt verschiedene alternative Finanzierungsmodelle vor und diskutiert deren Eignung für die Diakonie. Beispiele hierfür sind Förderprogramme der KfW-Bankengruppe, Mezzanine-Kapital, das Investor-Betreiber-Modell und Immobilienfonds.
- Quote paper
- Necla Özdogan (Author), 2012, Analyse von Aufbau und Struktur der Diakonie unter besonderer Berücksichtigung der Finanzierung sozialer Dienste, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201016