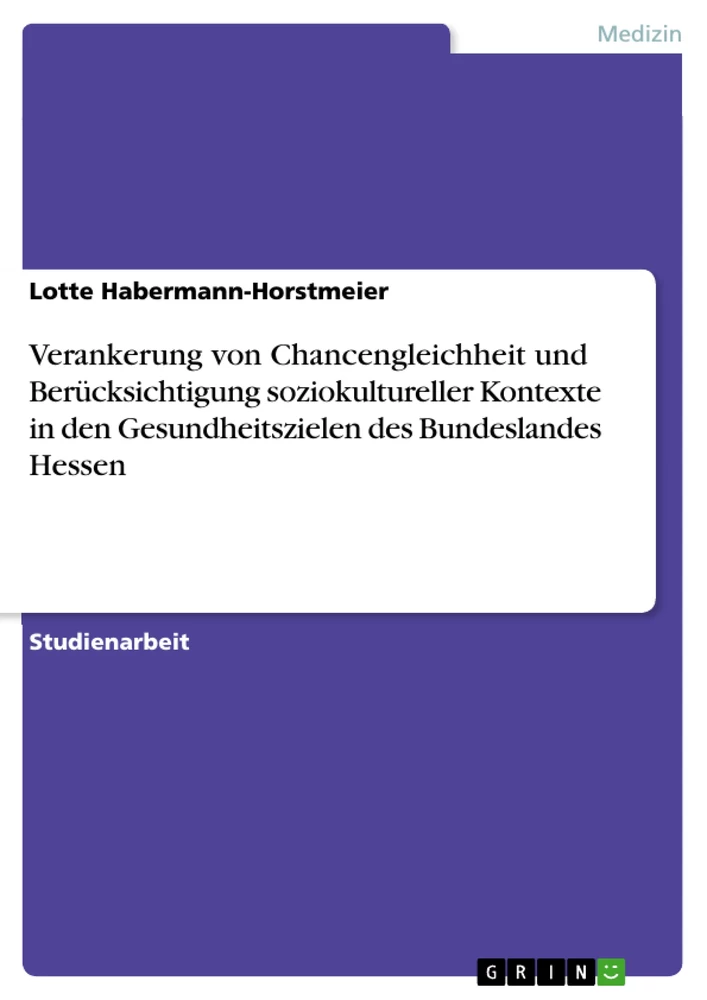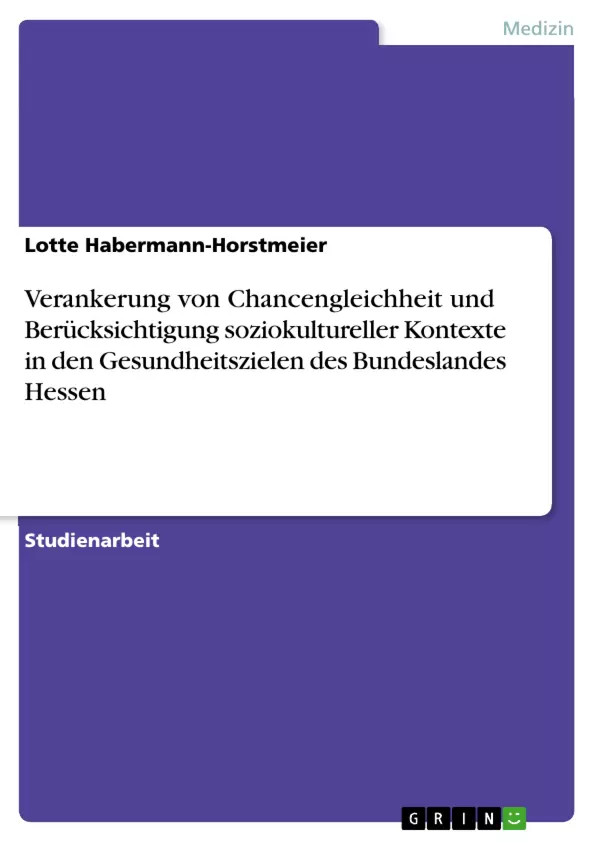In den letzten Jahren haben die deutschen Bundesländer eigene Gesundheitsziele entwickelt. Hessen steht noch am Anfang dieses Prozesses. Bislang wurden hier drei inhaltliche Schwerpunkte definiert: (1) Versorgungsstruktur, (2) Prävention von Volks-krankheiten, (3) Hospiz- und Palliativversorgung. Die vorliegende Arbeit zeigt an einem fiktiven Beispiel, wie sich die hessische Hochschule Z., vertreten durch eine dort im Fachbereich "Pflege und Gesundheit" lehrende Professorin mit einem Argumentarium konstruktiv an diesem Entwicklungsprozess beteiligen könnte. Ihr Ziel ist es dabei, die Berücksichtigung von Chancengleichheit und soziokulturellen Kontexten bei der Entwicklung der hessischen Gesundheitsziele nachdrücklich unterstützen.
I. Ausgangslage
In Deutschland engagieren sich seit dem Jahr 2000 mehr als 70 Organisationen des Gesundheitswesens unter Beteiligung des Bundes und der Länder in einem Kooperationsverbund, dessen Aufgabe die Weiterentwicklung nationaler Gesundheits-ziele ist. Der Verbund (Gesundheitsziele.de) empfiehlt darüber hinaus Maßnahmen zur Zielerreichung, seine Akteure setzen sich gemeinsam für die Umsetzung dieser Maßnahmen ein. In den letzten Jahren haben auch die deutschen Bundesländer eigene Gesundheitsziele entwickelt. Anders als z.B. Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern steht Hessen noch am Anfang dieses Prozesses. Bislang wurden hier drei inhaltliche Schwerpunkte definiert: (1) Versorgungsstruktur, (2) Prävention von Volks-krankheiten, (3) Hospiz- und Palliativversorgung. Nach Auskunft der zuständigen Stelle, dem Hessischen Sozialministerium, befindet man sich derzeit noch im Ziel- und Maßnah-menfindungsprozess.
Der Fachbereich Pflege und Gesundheit an der Hochschule Z., vertreten durch die Studiendekanin Frau Prof. Dr. X. Y., möchte sich mit seinen Studiengängen Public Health, Public Health Nutrition und Gesundheitsförderung konstruktiv in diesen Prozess einbringen und mit einem Argumentarium die Berücksichtigung von Chancengleichheit und soziokulturellen Kontexten bei der Entwicklung der hessischen Gesundheitsziele nachdrücklich unterstützen. Frau Prof. X. Y. hat daher vorab telefonischen Kontakt mit Frau Dr. Katharina Maulbecker-Armstrong, der zuständigen Leiterin des Referats V8 Prävention am Hessischen Sozialministerium in Wiesbaden aufgenommen. Frau Dr. Maulbecker-Armstrong ist sehr an den vom Fachbereich Pflege und Gesundheit gesammelten Argumenten interessiert und bittet Frau Prof. Dr. X. Y., ihr das Argumentarium zu übersenden, um die aufgeführten Argumente bei der nächsten Sitzung mit dem hessischen Sozialminister Stefan Grüttner erörtern zu können.
II. Argumente zur Berücksichtigung von Chancengleichheit und soziokulturellen Kontexten bei der Entwicklung der hessischen Gesundheitsziele
Frau Prof. Dr. X. Y. sendet daher das folgende Argumentarium an Frau Dr. Katharina Maulbecker-Armstrong, Leiterin des Referats V8 Prävention, Hessisches Sozialministerium, Dostojewskistr. 4, D 65187 Wiesbaden.
Argumentarium
zur Verankerung des Ziels der Verringerung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen bei der Entwicklung von Gesundheitszielen im Bundesland Hessen, insbesondere im inhaltlichen Schwerpunktbereich ´Prävention von Volkskrankheiten`
erarbeitet vom
FB Pflege und Gesundheit der Hochschule Z.
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. X. Y.
Hessen hat bei der Entwicklung eigener Gesundheitsziele einen Schwerpunkt im Bereich Prävention von Volkskrankheiten gesetzt. Nach Aussagen der WHO (2009) ist die sich derzeit weltweit epidemieartig verbreitende Adipositas die Hauptursache für chronische Erkrankungen und in deren Folge für die Erwerbsunfähigkeit der betroffenen Personen. In Deutschland sind 60% der Männer und 43% der Frauen übergewichtig, 16% der Männer und 14% der Frauen sogar adipös (Destatis 2010). Hier gehören Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, periphere Durchblutungsstörungen und Arthrose, bei deren Auslösung Adipositas und Bewegungsmangel eine entscheidende Rolle spielen, zu den häufigsten chronischen Krankheiten („Volkskrankheiten“; RKI 2011). Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zudem in Deutschland wie in der EU zu den drei häufigsten Todesursachen (Eurostat 2009). Vor allem aufgrund der sich ändernden Alterstruktur der Bevölkerung werden diese Krankheiten in Deutschland bis zum Jahr 2050 noch weiter und zum Teil erheblich zunehmen (Beske et al. 2009).
Wie stark soziokulturelle Faktoren das Auftreten von Übergewicht insbesondere bei Kindern beeinflussen, zeigen die Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (Schaffrath Rosario, Kurth 2006). Kinder aus Familien mit niedrigem sozialem Status sind häufiger adipös als Kinder aus Familien mit mittlerem oder gar hohem Sozialstatus. Auch Kinder aus Migrantenfamilien sind zu einem höheren Prozentsatz stark übergewichtig, insbesondere wenn ihre Familien aus dem türkisch-arabischen Raum stammen. Diese Kinder und Jugendlichen haben also aufgrund ihrer familiären Herkunft nicht die gleichen Chancen wie andere Kinder und Jugendliche in Deutschland, gesund aufzuwachsen. Die sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheit nimmt in Deutschland - ebenso wie in vielen unserer Nachbarländern - aber auch in anderen Bereichen derzeit weiter zu (Kunst et al. 2005).
Wir sind daher der Meinung, dass die Verankerung des Ziels einer Verringerung von sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit bei der Formulierung von Gesundheits-zielen für das Land Hessen, insbesondere im bereits festgelegten Schwerpunkt Prävention von Volkskrankheiten, für die Einwohner des Landes von großer Relevanz ist und führen hierfür die folgenden Gründe an:
v Die Verankerung des Ziels der Verringerung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit in den Gesundheitszielen des Landes Hessen könnte ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltige Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit in Deutschland sein. Dies ist nach Lampert/Mielck 2008 jedoch nur durch eine umfassende Handlungsstrategie sowie ein breites Spektrum aufeinander abgestimmter politischer Maßnahmen zu erreichen. Hierzu gehört insbesondere auch die Verankerung in den Gesundheitszielen des Bundes und der Länder.
Darüber hinaus erfolgt dadurch eine Einbindung in nationale und internationale Ziele, Projekte und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention:
- Schon in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1946) wurde gesundheitliche Chancengleichheit als eines der zentralen Ziele formuliert. Seitdem findet sich diese vorrangige gesundheitspolitische Zielsetzung in verschiedenen Erklärungen und globalen Strategien der WHO und anderer Gesundheitsorganisationen. So formuliert z.B. das WHO-Rahmenkonzept Gesundheit 21 – Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert 21 Ziele, über deren Erreichen sich „Gesundheit für alle“ verwirklichen soll. Eines der wichtigsten Ziele ist die gesundheitliche Chancengleichheit (WHO 1998).
- Chancengleichheit, definiert als die Beseitigung von Ungleichheiten und die Erleichterung der Verwirklichung von Menschenrechten - einschließlich des Zugangs zu geeigneten Diensten für die am stärksten Benachteiligten, gehört ebenfalls zu den vier Leitprinzipien der Strategie der Europäischen Region zur Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Der Europäische Gesundheitsbericht 2005).
- Auch im White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues der Europäischen Union (EU 2007) wird auf die Rolle des soziokulturellen Kontexts bei der Entstehung der Adipositas und ihrer Folgekrankheiten hingewiesen und gesundheitliche Chancengleichheit eingefordert.
- Als besonders wichtiges Argument erscheint es uns, dass soziokulturelle Aspekte und damit auch die unterschiedlichen gesundheitlichen Chancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland im „Nationalen Gesundheitsziel Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung “ des Kooperationsverbundes gesundheits-ziele.de mehrfach thematisiert werden (BMG 2010).
- Weiterhin wird im Nationalen Aktionsplan IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung gefordert, konkrete Angebote für Menschen und Bevölkerungsgruppen zu schaffen, die bisher kaum Zugang zu gesundheits-förderlichen Angeboten hatten. Die Gesundheitsinitiative der bundesdeutschen Ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie für Gesundheit sieht sich hier in einer Vorbildfunktion für Bund, Ländern und Kommunen. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert darüber hinaus „Aktionsbündnisse Gesunde Lebensstile und Lebenswelten“ und nimmt damit Bezug auf die Ziele des Nationalen Aktionsplans IN FORM. Durch die Förderung dieser Initiativen soll zugleich ein Beitrag zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten geleistet werden. Die meisten Angebote und Maßnahmen richten sich an Kinder und Jugendliche, es werden aber z.B. auch Migranten/-innen und ältere Menschen angesprochen (BMELV, BMG 2008).
- Auch der 2003 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) initiierte Kooperationsverbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“, der derzeit 53 Akteure im Bereich der Gesundheitsförderung umfasst, hat zum Ziel, gesundheitliche Chancengleichheit in Deutschland als Querschnittsaufgabe zu stärken, zum Leitbild zu machen und in der Praxis vor Ort zu verankern (Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten 2006). Im Regionalen Knoten Hessen liegt der Arbeitss chwerpunkt im Bereich der Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.
Darüber hinaus legt das deutsche Sozialgesetzbuch (§ 20 SGB V Prävention und Selbsthilfe, 1. Ab-satz; o.J.) fest, dass die Krankenkassen in ihren Satzungen Leistungen zur primären Prävention vorsehen sollen, die den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen leisten sollen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Schwerpunkte der hessischen Gesundheitsziele?
Die drei inhaltlichen Schwerpunkte sind: Versorgungsstruktur, Prävention von Volkskrankheiten sowie Hospiz- und Palliativversorgung.
Warum ist Chancengleichheit in der Gesundheitsförderung wichtig?
Soziokulturelle Faktoren beeinflussen die Gesundheit stark; beispielsweise zeigen Studien, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder Migrantenfamilien ein höheres Risiko für Adipositas haben.
Welche Rolle spielt Adipositas bei Volkskrankheiten?
Adipositas ist laut WHO eine Hauptursache für chronische Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2, Herzinfarkt und Schlaganfall, was oft zur Erwerbsunfähigkeit führt.
Was ist das Ziel des vorgestellten Argumentariums?
Es soll das Hessische Sozialministerium davon überzeugen, die Verringerung sozial bedingter Ungleichheit fest in den Landesgesundheitszielen zu verankern.
Welche gesetzliche Grundlage unterstützt die Verminderung von Ungleichheit?
Das deutsche Sozialgesetzbuch (§ 20 SGB V) verpflichtet Krankenkassen dazu, Leistungen zur Prävention vorzusehen, die einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit leisten.
- Arbeit zitieren
- Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier (Autor:in), 2011, Verankerung von Chancengleichheit und Berücksichtigung soziokultureller Kontexte in den Gesundheitszielen des Bundeslandes Hessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200975