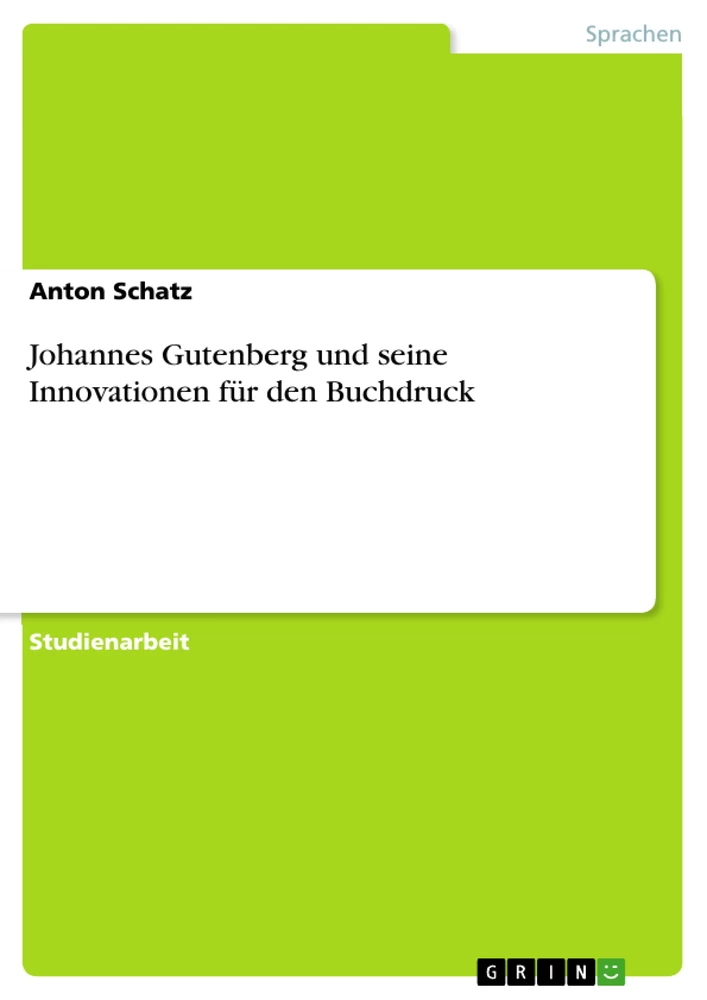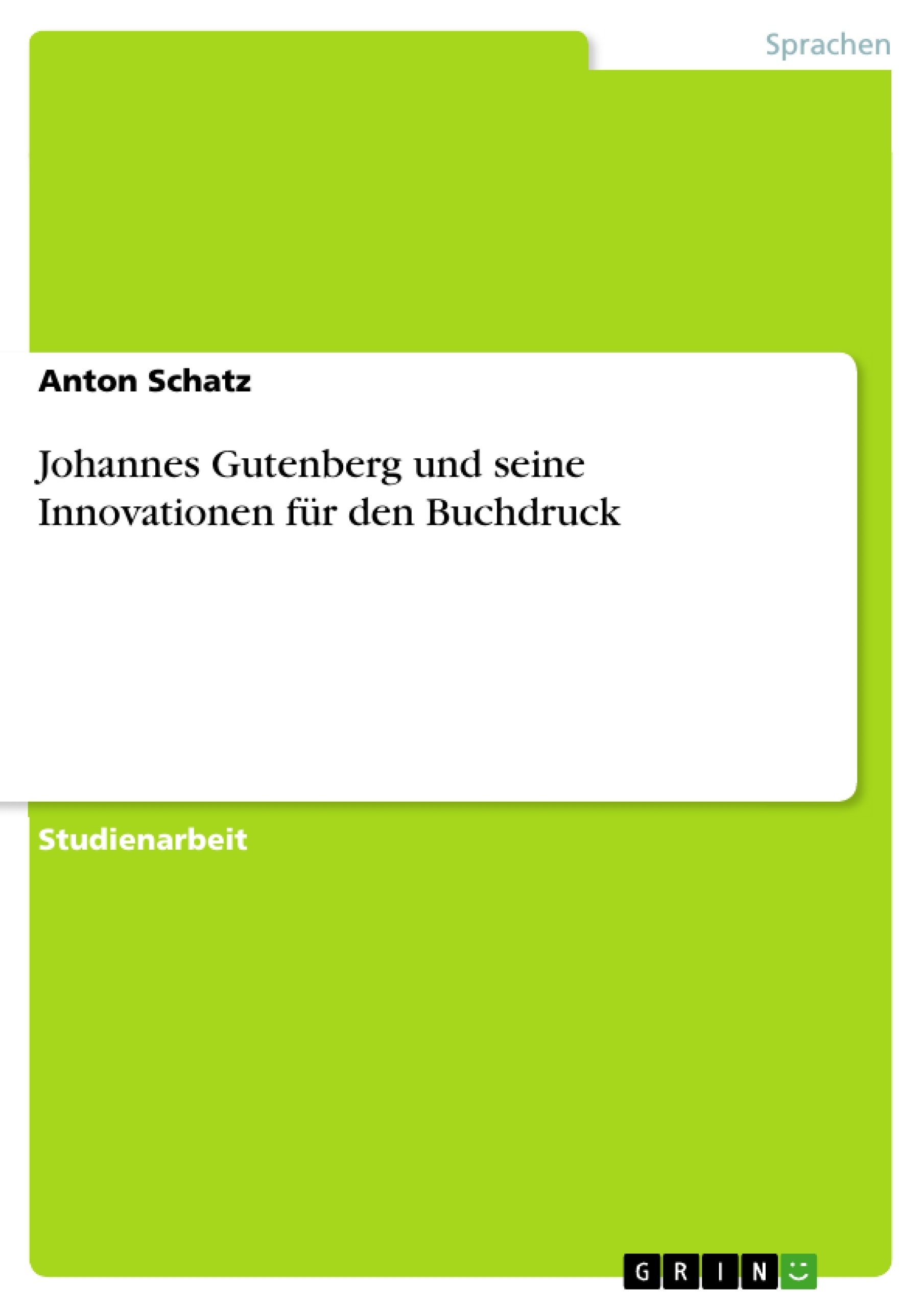Aus dem Inhaltsverzeichnis:
- Bedeutung des Buches
- Johannes Gutenberg und seine Innovationen für den Buchdruck
- Papierherstellung bis zum 16. Jahrhundert
- Druckverfahren vor Gutenberg
- Johannes Gutenberg
- Verbesserungen und Innovationen
- Druck-Erzeugnisse Gutenbergs
Inhaltsverzeichnis
1. Bedeutung des Buches
2. Johannes Gutenberg und seine Innovationen für den Buchdruck
2.1. Papierherstellung bis zum 16. Jahrhundert
2.2. Druckverfahren vor Gutenberg
2.2.1. Holzschnitt
2.2.2. Kupferstich
2.2.3. Blockdruck
2.2.4. Reibedruckverfahren
2.3. Johannes Gutenberg
2.4. Verbesserungen und Innovationen
2.5. Druck-Erzeugnisse Gutenbergs
3. Nachwirken
Literaturverzeichnis
1. Bedeutung des Buchdruckes
In vielerlei Weise beeinflussten Informationen und deren Weitergabe unser tägliches Leben. Seien es Neuigkeiten, welche durch die Lektüre der Tageszeitung gewonnen werden, Erkenntnisse, die uns durch das Lesen einer Betriebsanleitung zu Teil werden, die Gedankenwelt eines Autors, dessen Werk man studiert oder auch Spruchbänder und Aufdrucke auf ganz alltäglichen Gegenständen. Informationen wie die Medien zu deren Produktion und Verbreitung sind heutzutage allgegenwärtig.
Schon vor Gutenberg war die Multiplikation von Informationsträgern durch das Bedrucken von Papier und Pergament gebräuchlich, jedoch leistete er einen wesentlichen Beitrag zu dessen Vereinfachung.
2. Johannes Gutenberg und seinen Innovationen für den Buchdruck
Das nachfolgende Referat befasst sich daher mit Johannes Gutenberg und seinen Innovationen für den Buchdruck, ohne die eine schnelle, effiziente und zugleich kostengünstige Produktion von Büchern ab dem 15. Jahrhundert in Europa nicht möglich gewesen wäre.
2.1. Papierherstellung bis zum 16. Jahrhundert
Die Papierherstellung hat ihre Wurzeln 2. Jh. v. Chr. im chinesischen Kaiserreich. Bekannt als das „dünne Glänzende“[1] oder „das Papier des gnädigen Tsái“[2] ranken sich um dessen Entstehung verschiedene Geschichten. Die Herstellung verlief in mehreren Arbeitsschritten. Als Rohstoff diente besonders Bast. Dieser wurde unter Zugabe anderer Stoffe so lange zerkleinert und gekocht, bis er sich in einzelne Fasern aufgelöst hatte. Mit einem feinmaschigen Sieb wurde ein Teil der gelösten Fasern aufgenommen, sodass nach dem Abtropfen des Wassers eine dünne Zellstoffschicht das Sieb bedeckte. Die Qualität konnte je nach Anforderung variieren. Schließlich wurde die feuchte Papierschicht getrocknet und gepresst.[3]
Die Verbreitung im ostasiatischen Raum ging in den nachfolgenden Jahrhunderten vonstatten. Um 750 n. Chr. wurde die Technik der Papierherstellung von chinesischen Gefangenen an den arabischen Kulturraum weitergegeben. Schon 100 Jahre später entstand in Bagdad eine blühende Papierwirtschaft. Aus dieser Zeit sind auch erste Papierbücher und Wasserzeichen belegt.[4]
Durch die Vertreibung der Araber gelangten auch die bei Valenza bestehenden Papiermühlen in den Einflussbereich des christlich-abendländischen Kulturkreises, sodass erste christliche Quellen auf Papier aus dem 13. Jh. überliefert sind.
Nördlich der Alpen wurde 1390 vom Nürnberger Kaufmann Ulman Stromer die erste Papiermühle errichtet. Das Wissen und die Technik hierfür erlangte er auf einer Geschäftsreise nach Italien. Zwar versuchte er sich durch Vereidigung der Mitarbeiter und Geheimhaltung des Verfahrens eine Monopolstellung zu sichern, jedoch entstanden binnen kürzester Zeit viele Papiermühlen. Ende des 16. Jh. existieren bereits 190 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.[5] Die Verbesserungen an der Drucktechnik durch Gutenberg waren die Ursache des rasch ansteigenden Bedarfs an bedruckbaren Materialien.
2.2. Druckverfahren vor Gutenberg
Die Verfahrensweise des Abdruckens mittels Stempel auf ein zu bedruckendes Medium ist sehr alt, daher werden im Folgenden nur diejenigen Verfahren vorgestellt, die zur Zeit Gutenbergs in Mitteleuropa von Bedeutung waren.
2.2.1. Holzschnitt
Dieses Hochdruckverfahren war bereits den Babyloniern und Ägyptern bekannt. Als Werkstoff eigenen sich aufgrund besserer Eigenschaften in Bearbeitung und Druck besonders harte Hölzer, sodass Kirsche und Nuss hierzu gerne benutzt wurden. Indem nicht zu bedruckende Stellen vom Künstler ausgespart wurden, entsteht das zu druckende Objekt. Es wird generell zwischen Schwarzlinienschnitt und Weißlinienschnitt unterscheiden. Bei Erstgenanntem werden die druckenden Teile das Objekt darstellen, während sie bei Zweitgenanntem die Umgebung oder den Hintergrund darstellen.[6]
2.2.2. Kupferstich
Die eigentliche Technik des Kupferstichs wurde im 12. Jh. von Goldschmieden entwickelt. Zur besseren Sichtbarkeit auf Schmuckstücken und sakralen Gegenständen wurden Gravuren durch Einpolieren und Erhitzen eines schwarzen Pulvers behandelt.[7]
Aus den Abzügen dieser Technik entstand die Kunst des Kupferstichs. Die Grafik wird auf einer polierten Kupferplatte mittels eines Grabstichels eingeschnitten. Da der metallene Werkstoff im Vergleich zum Holz eine wesentlich filigranere Bearbeitung zulässt, entstehen bereits im 15. Jahrhundert hochwertige Kunstdrucke von bestem Detail.[8] Der Ausdruck der Formenvielfalt konnte beim Einschneiden variiert werden. So nennt sich das Gravieren vom Körper weg Stechen und das Heranziehen des Grabstichels zum Körper hin Radieren.
2.2.3. Blockdruck
Schon im 8. Jh. war das Verfahren des Blockdrucks in China bekannt. In Europa wurde dieses im frühen 14. Jh. erstmals praktiziert. Text und bildliche Darstellungen müssen hierbei zuerst aus einer Holzplatte herausgeschnitten werden um diese dann mit einer pechartigen, zähflüssigen Masse für den späteren Abdruck auf Pergament oder Papier zu präparieren.[9] Aus der jeweiligen Anzahl dieser Blockdruckbögen konnten Bücher gebunden werden. Diese werden als Blockbücher bezeichnet. Bis zu Gutenbergs Innovationen war dies das gängige Druckverfahren in Europa.
2.2.4. Reiberdruck
In dieser Methode wird ein Abdruck wie folgt erstellt. Auf eine angeschwärzte Druckplatte wird ein Bogen Pergament oder Papier gelegt. Der Abdruck entsteht indem der Drucker dieses Blatt auf der Rückseite mit aus Leder gefertigten Säcken, den Reibern, gegen die Druckplatte presst. Die Besonderheit des Reiberdruckverfahrens ist auch gleichzeitig ein großer Nachteil dieser Technik.[10] Aufgrund des Anreibens der Rückseite ist ein beidseitiger Druck nicht möglich, da selbst getrocknete Druckerschwärze bei der Bearbeitung der Wechselseite verwischen würde. Diese Tatsache wirkte angesichts der hohen Materialkosten für Papier und Pergament umso schwerer.
2.3. Gutenberg
Johannes Gensfleisch wurde um 1400 als drittes Kind des Mainzer Kaufmanns und Patriziers Friedrich Gensfleisch im Hof zum Gutenberg geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist nichts Verbindliches bekannt, so vermutet man beispielsweise, dass er ein Studium in Erfurt begonnen hat. Seine erste namentliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1420, als er nach dem Tod seines Vaters in Erbstreitigkeiten verwickelt war.[11]
[...]
[1] Sandermann, Wilhelm: Papier. Eine spannende Kulturgeschichte. Berlin (u.a.) 1992. S. 66.
[2] Sandermann, S. 65.
[3] Vgl.: Sandermann, S. 68.
[4] Vgl.: Sandermann, 85.
[5] Vgl.: Sandermann, 117 – 121.
[6] Vgl.: Krejca, Ales: Die Techniken der graphischen Kunst. Hanau 1991. S. 32 -35.
[7] Vgl.: Krejca, S. 67.
[8] Vgl.: Krejca, S. 69 – 71.
[9] Vgl.: Koschatzky, Walter: Die Kunst der Graphik. Technik Geschichte Meisterwerke. München 1983. S. 56.
[10] Vgl.: Koschatzky, S. 70.
[11] Vgl.: Füssel, Stephan: Johannes Gutenberg. Reinbeck bei Hamburg 1999. S. 19.
- Quote paper
- Anton Schatz (Author), 2009, Johannes Gutenberg und seine Innovationen für den Buchdruck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200973