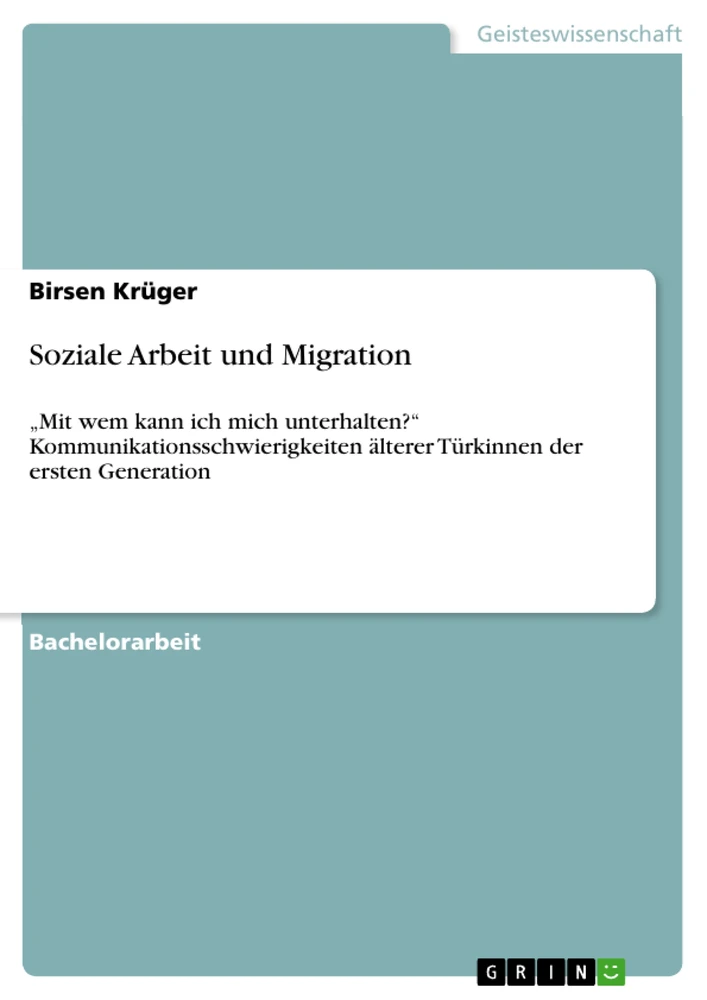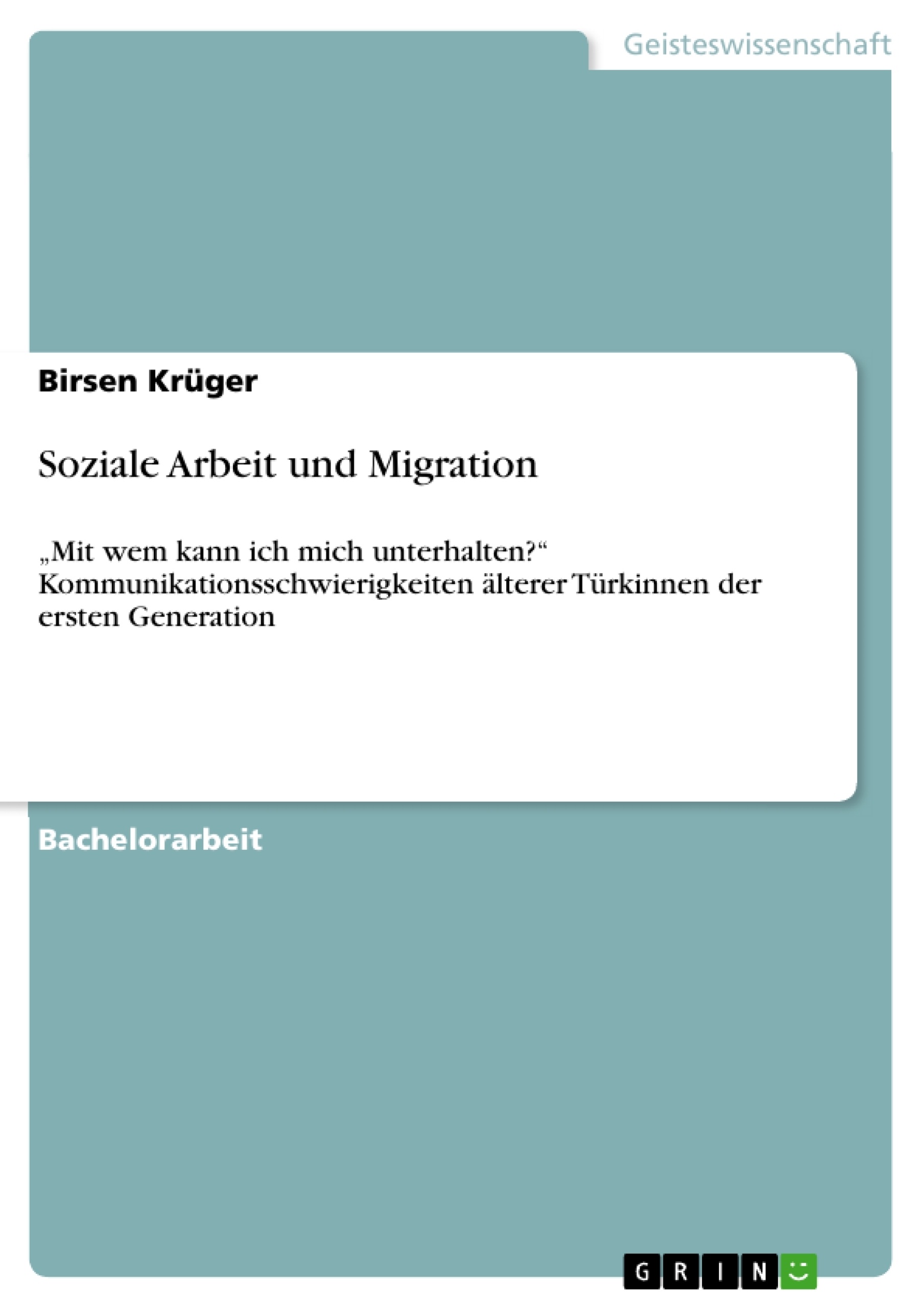Ich beziehe mich in meiner Arbeit auf Beispiele der „ersten“ Generation in der Periode der ersten Anwerbung, sowie in der Periode der Familienzusammenführung. Vieles trifft aber auch in ähnlicher Weise auf die gegenwärtige Zeit zu, da im Rahmen von Heiratsmigration immer wieder eine „erste“ Generation nach Deutschland einreist. Sicherlich sind die Kommunikations-Möglichkeiten und die Möglichkeiten zum Erwerb der Deutschen Sprache heute ganz andere, als noch zur damaligen Einreisezeit. Dennoch könnten Einstellungsähnlichkeiten, wie beispielsweise die Vorstellung einer Einreise auf Zeit, Vorstellungen des Vorrangs von Familienarbeit- und Kindererziehung vor dem Spracherwerb nach erfolgter Eheschließung durch die Schwiegerfamilie ebenfalls Hinderungsgründe abgeben, um die deutsche Sprache zügig zu erlernen. Diese Einstellungen können nicht allein durch Integrationsprogramme und -kurse überwunden werden, sondern bedürfen eines langfristigen Prozesses, bei dem es notwendig ist, auf die Familien zuzugehen und in den Communities für diesen Prozess zu werben, und vor allem auch, diese an einem solchen Prozess zu beteiligen.Mit diesem Rückblick, will ich aufzeigen, wie und was aus der Migrations-Geschichte der ersten Generation zu lernen ist, wenn nämlich die gesamte Lebensphase eines Menschen – aus welchen
Mit diesem Rückblick, will ich aufzeigen, wie und was aus der Migrations-Geschichte der ersten Generation zu lernen ist, wenn nämlich die gesamte Lebensphase eines Menschen – aus welchen politischen Gründen auch immer – aus dem Blick gerät, und sich die sozialen Programme an vordergründige Vorannahmen – Wir/sie gehen zurück – ausrichten und sich dabei lediglich auf den kurzzeitigen Nutzen der jeweiligen Migrationsphase beschränken.
Auf den folgenden Seiten versuche ich die Lage älterer Migrantinnen aus der Türkei zu erfassen, und die Annahmen über diese ältere Generation exemplarisch durch 4 Interviews zu dokumentieren.
Ich werde zu Beginn die Migrationsgeschichte der ersten Frauengeneration aus der Türkei skizzieren und auf die damaligen Möglichkeiten des Spracherwerbs eingehen. Im Anschluss gehe ich auf die Bedeutung von Sprache im gesellschaftlichen Kontext, sowie auf das Altern im Immigrationsland ein. Ich werde die Lebenssituationen dieser Frauen in der Dritten Lebensphase, deren Sprachbedarf und ihre Spracherwerbsmöglichkeiten anhand ihrer Aussagen darlegen, sowie ihre damaligen Möglichkeiten des Spracherwerbs zur Zeit ihrer Einreise aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Frauenmigration aus der Türkei
- 1.1 Die „erste“ Frauengeneration in den Jahren 1961 bis 1973
- 1.2 Die „erste“ Frauengeneration im Rahmen der Familienzusammenführung
- 2. Mangelnde Sprachkompetenz als Behinderung im sozialen Alltag
- 3. Altern im Immigrationsland Deutschland
- 4. Die Interviews
- 4.1 Qualitative Sozialforschung und das Experteninterview
- 5. Sprachbedarf
- 5.1 Sprachkurse für ältere Türkinnen
- 5.2 Auszug an Angeboten der Stadt Wetzlar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kommunikationsschwierigkeiten älterer türkischer Migrantinnen der ersten Generation in Deutschland. Ziel ist es, die Lebensbedingungen dieser Frauen im Alter, insbesondere im Hinblick auf Sprachkompetenz und soziale Integration, zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews und analysiert die Herausforderungen, denen diese Frauen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse gegenüberstehen.
- Frauenmigration aus der Türkei und die spezifischen Bedingungen der ersten Generation
- Sprachbarrieren und deren Auswirkungen auf den sozialen Alltag älterer Migrantinnen
- Altern im Immigrationsland Deutschland und die Herausforderungen für ältere Migrantinnen
- Sprachbedarf und Möglichkeiten des Spracherwerbs für ältere Migrantinnen
- Qualitative Interviews als Methode der Datenerhebung und -analyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Frauenmigration aus der Türkei: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte der Frauenmigration aus der Türkei nach Deutschland, beginnend mit dem Anwerbeabkommen von 1961. Es werden die Arbeitsbedingungen und die Möglichkeiten des Spracherwerbs für die ersten Generationen von Migrantinnen beleuchtet, wobei deutlich wird, dass Frauen in der Migrationsforschung lange Zeit vernachlässigt wurden. Der Fokus liegt auf der frühen Phase der Anwerbung und der anschließenden Familienzusammenführung, wobei die unterschiedlichen Spracherwerbsmöglichkeiten in beiden Phasen analysiert werden. Die Einordnung der Frauen in frauentypische Berufsbereiche und die daraus resultierenden Folgen für die Integration werden ebenfalls thematisiert.
2. Mangelnde Sprachkompetenz als Behinderung im sozialen Alltag: Das Kapitel untersucht die Auswirkungen mangelnder Sprachkompetenz auf den Alltag älterer türkischer Migrantinnen. Es wird dargelegt, wie Sprachbarrieren die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, den Zugang zu Dienstleistungen und die soziale Integration beeinträchtigen. Es werden die konkreten Herausforderungen und Einschränkungen im täglichen Leben beschrieben, die aus der mangelnden Sprachkompetenz resultieren. Die Kapitel beleuchtet die soziale Isolation und die damit verbundenen Probleme dieser Personengruppe.
3. Altern im Immigrationsland Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich den Besonderheiten des Alterns im Kontext von Migration. Es beleuchtet die persönliche und soziale Situation älterer türkischer Migrantinnen, berücksichtigt dabei Aspekte wie Rückkehr-Illusionen, finanzielles Vermögen, Wohnbedingungen, soziale Netzwerke, Bildung, Arbeit und Gesundheit. Das Kapitel zeigt die spezifischen Herausforderungen auf, denen ältere Migrantinnen in Deutschland im Vergleich zu deutschen Altersgruppen gegenüberstehen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und die Notwendigkeit spezifischer Angebote für diese Altersgruppe werden ausführlich diskutiert.
4. Die Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der qualitativen Sozialforschung und die Durchführung der Experteninterviews. Die Interviews mit vier Frauen aus der ersten Einwanderergeneration bilden den Kern dieses Kapitels. Es werden die Lebensgeschichten und Erfahrungen dieser Frauen präsentiert, wobei der Schwerpunkt auf ihren Sprachbedürfnissen und -erwerbsmöglichkeiten liegt. Die Interviews bieten detaillierte Einblicke in die persönlichen Lebensumstände, Herausforderungen und Erfahrungen dieser Frauen.
5. Sprachbedarf: Dieses Kapitel befasst sich mit dem konkreten Sprachbedarf älterer türkischer Migrantinnen und stellt verschiedene Sprachkurse und Angebote in der Stadt Wetzlar vor. Es analysiert die Vor- und Nachteile der bestehenden Programme und Angebote und bewertet deren Geeignetheit und Zugänglichkeit für die Zielgruppe. Der Fokus liegt auf der Analyse von bestehenden Angeboten und deren Effektivität bezüglich der Integration älterer Migrantinnen.
Schlüsselwörter
Frauenmigration, Türkei, Deutschland, Sprachkompetenz, soziale Integration, Alter, Kommunikationsschwierigkeiten, qualitative Sozialforschung, Experteninterviews, Sprachbedarf, Sprachkurse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Kommunikationsschwierigkeiten älterer türkischer Migrantinnen
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht die Kommunikationsschwierigkeiten älterer türkischer Migrantinnen der ersten Generation in Deutschland. Sie beleuchtet ihre Lebensbedingungen im Alter, insbesondere hinsichtlich Sprachkompetenz und sozialer Integration.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf qualitativen Experteninterviews mit vier Frauen der ersten Einwanderergeneration. Die gewonnenen Daten werden analysiert, um die Herausforderungen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Frauenmigration aus der Türkei; 2. Mangelnde Sprachkompetenz als Behinderung im sozialen Alltag; 3. Altern im Immigrationsland Deutschland; 4. Die Interviews (Methodenteil und Darstellung der Interviewergebnisse); 5. Sprachbedarf (Analyse bestehender Sprachkurse und Angebote).
Was ist der Fokus von Kapitel 1 (Frauenmigration aus der Türkei)?
Kapitel 1 gibt einen Überblick über die Geschichte der Frauenmigration aus der Türkei nach Deutschland, beginnend mit dem Anwerbeabkommen von 1961. Es werden die Arbeitsbedingungen und Spracherwerbsmöglichkeiten der ersten Generationen beleuchtet, mit besonderem Augenmerk auf die frühen Phasen der Anwerbung und Familienzusammenführung.
Worauf konzentriert sich Kapitel 2 (Mangelnde Sprachkompetenz)?
Kapitel 2 untersucht die Auswirkungen mangelnder Sprachkompetenz auf den Alltag der betroffenen Frauen. Es beschreibt konkrete Herausforderungen und Einschränkungen im täglichen Leben, die soziale Isolation und die damit verbundenen Probleme.
Was sind die zentralen Aspekte von Kapitel 3 (Altern im Immigrationsland)?
Kapitel 3 beleuchtet die Besonderheiten des Alterns im Kontext von Migration. Es betrachtet die persönliche und soziale Situation älterer türkischer Migrantinnen, unter Berücksichtigung von Aspekten wie Rückkehr-Illusionen, Finanzen, Wohnbedingungen, sozialen Netzwerken, Bildung, Arbeit und Gesundheit.
Was wird in Kapitel 4 (Die Interviews) beschrieben?
Kapitel 4 beschreibt die Methodik der qualitativen Sozialforschung und die Durchführung der Experteninterviews. Es präsentiert die Lebensgeschichten und Erfahrungen der interviewten Frauen, mit Schwerpunkt auf Sprachbedürfnissen und -erwerbsmöglichkeiten.
Worüber handelt Kapitel 5 (Sprachbedarf)?
Kapitel 5 befasst sich mit dem konkreten Sprachbedarf älterer türkischer Migrantinnen und stellt verschiedene Sprachkurse und Angebote in Wetzlar vor. Es analysiert die Vor- und Nachteile der Programme und deren Eignung für die Zielgruppe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Schlüsselwörter sind: Frauenmigration, Türkei, Deutschland, Sprachkompetenz, soziale Integration, Alter, Kommunikationsschwierigkeiten, qualitative Sozialforschung, Experteninterviews, Sprachbedarf, Sprachkurse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Lebensbedingungen älterer türkischer Migrantinnen im Alter zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf Sprachkompetenz und soziale Integration. Sie analysiert die Herausforderungen, denen diese Frauen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse gegenüberstehen.
Wo findet man weitere Informationen?
[Hier könnte ein Link zur vollständigen Studie eingefügt werden]
- Quote paper
- Birsen Krüger (Author), 2011, Soziale Arbeit und Migration , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200843