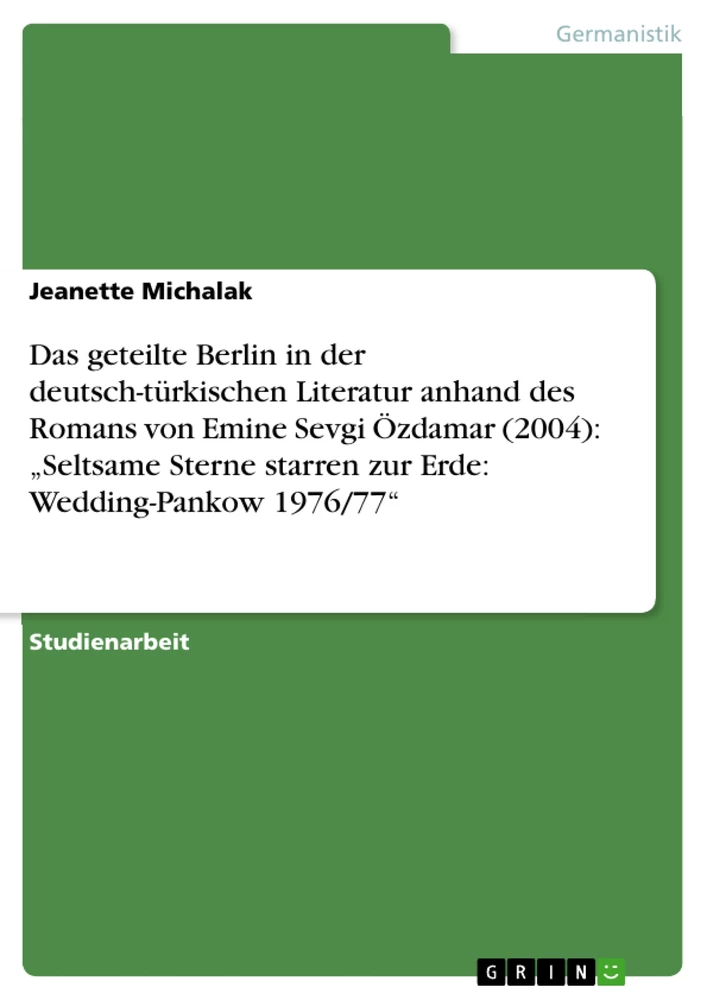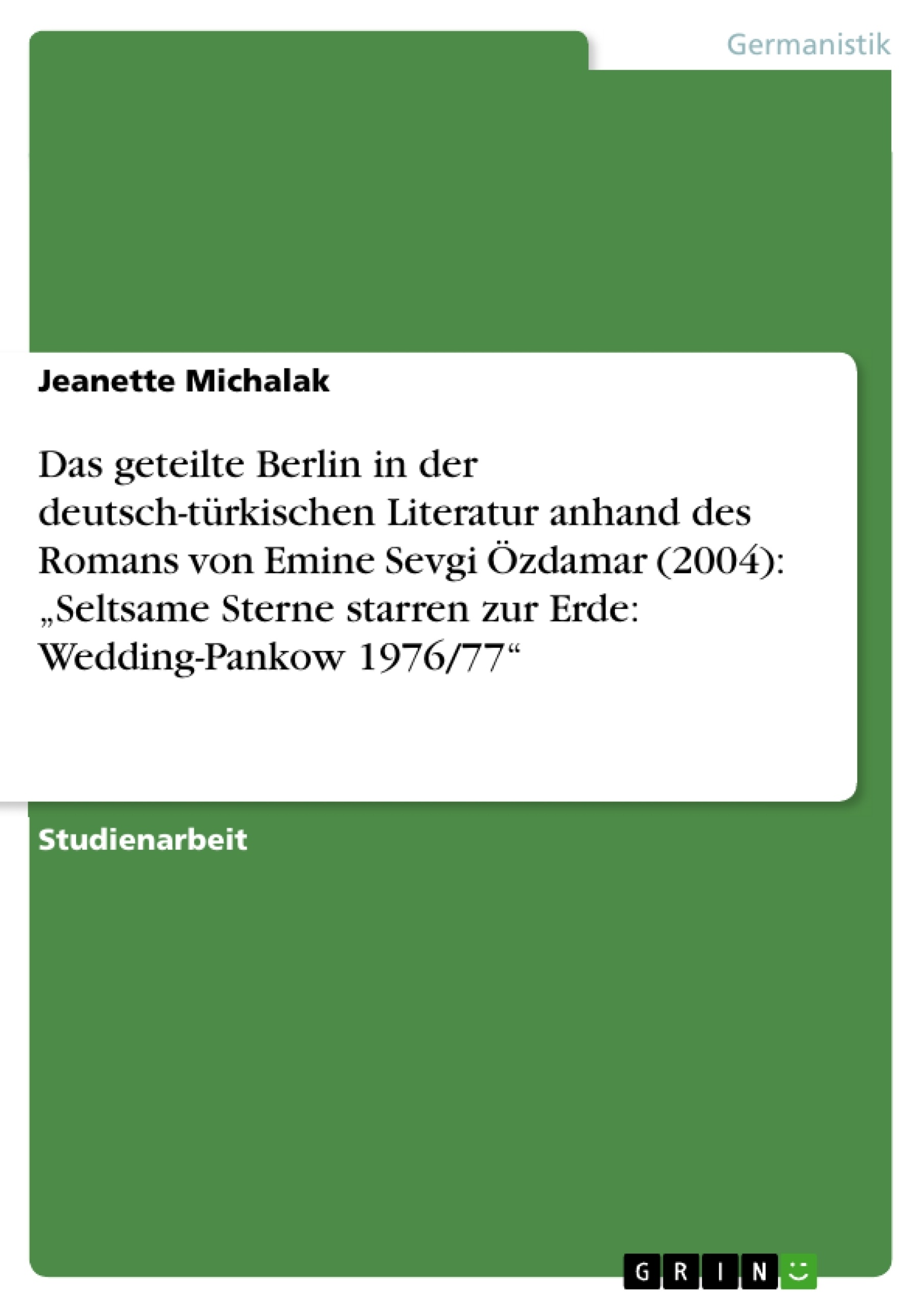In den 1950er Jahren folgte der wirtschaftliche Aufschwung nach dwm zweiten Weltkrieg und brachte Vollbeschäftigung. Doch wie sollte dies zu schaffen sein, da sich viele Männer in Kriegsgefangenschaft befunden haben oder im Krieg gefallen waren. Vor allem die schlecht bezahlten Stellen an den Fließbändern in den Fabriken und die Stellen in weniger qualifizierten Bereichen wollte niemand verrichten
Konrad Adenauer sollte aber die Wende bringen, indem er Gastarbeiter aus Südeuropa, vor allem aus der Türkei, anwarb. Eigentlich sollte es eine Odyssee auf Zeit sein. Die Türken schufen sich jedoch eine neue Existenz hier in Deutschland, darunter auch in Berlin. Später holten sie dann ihre Familien nach und leben nun bereits in der dritten Generation in Deutschland. Hinzu kamen aber nicht nur die Gastarbeiter, sondern auch eine Vielzahl an Asylsuchenden und Studenten, welche sich infolge verschiedener Militärputsche eine neue Heimat, wenn auch erst mal auf Zeit, suchten.
Doch wie nahmen diese Menschen das geteilte Berlin, während des Kalten Krieges, wahr ? Es war so anders als ihre Heimat in der Türkei. Dieser Umstand sollte in den folgenden Jahren auch Eingang in das kulturelle Gedächtnis finden, „die ihr Echo in den Berlin-Romanen türkisch-deutscher Autoren finden und kennzeichnend für den ,Turkish Turn̕ in der deutschen Gegenwartsliteratur sind.“
Allerdings fanden bis zur Wiedervereinigung diese Themen kaum Eingang in die deutsche Literatur, da vermutlich davon ausgegangen wurde, dass es ein zeitlich begrenztes Phänomen konstatiert. Lediglich in Heinrich Bölls Roman „Gruppenbild mit Dame“ wird ein türkischer Charakter eingeführt.
Mit dem ,Turkish Turn̕ kam jedoch ein neues Interesse an den Migranten auf, da diese nun aus ihrer Sicht Deutschland beschrieben, was auch im Zuge der aufkommenden Migrations- und Islamdebatte einen Aufschwung erhielt. Dabei eröffnen die deutsch-türkischen Schriftsteller(innen), eine neue Perspektive auf eine vergangene Zeit und eröffnen gleichzeitig einen Blick in eine, uns doch manchmal andersartig vorkommende, Kultur. Sie tragen somit zum kulturellen Austausch bei und prägen das heutige multikulturelle Bild Deutschlands und vor allem Berlins.
Eine von ihnen ist Emine Sevgi Özdamar, die ein Berlin-Bild aus den 1970er Jahren in ihrem Roman „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“5 zeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Emine Sevgi Özdamar
- Emine Sevgi Özdamar – Kurzbiographie
- „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“
- Inhaltsangabe und formale Gliederung
- Interpretation in Bezug auf meine Fragestellungen
- Teil 1
- Teil 2
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Primärquellen
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das geteilte Berlin in der deutsch-türkischen Literatur am Beispiel des Romans „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“ von Emine Sevgi Özdamar (2004). Die Arbeit befasst sich mit der Wahrnehmung des geteilten Berlins durch die Autorin und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sie in der geteilten Stadt erlebte. Zudem werden die Unterschiede zwischen ihrer neuen Heimat und ihrer Geburtsstadt in der Türkei untersucht.
- Das geteilte Berlin in der deutsch-türkischen Literatur
- Die Erfahrungen von Migranten in der geteilten Stadt
- Die Perspektive der Autorin auf den „Turkish Turn“ in der deutschen Gegenwartsliteratur
- Die Bedeutung des Theaters im Leben der Autorin
- Die Integration von autobiographischen Elementen in den Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und skizziert den historischen Kontext des geteilten Berlins in der deutsch-türkischen Literatur. Sie beleuchtet die Rolle der Gastarbeiter aus der Türkei und die sich entwickelnde Migrations- und Islamdebatte, die neue Perspektiven auf das Leben in Deutschland und die Geschichte des Landes eröffnen.
Das Kapitel über Emine Sevgi Özdamar bietet einen kurzen Abriss ihrer Biografie und zeichnet die wichtigsten Stationen ihres Lebens als Theaterschauspielerin und Schriftstellerin nach. Es beleuchtet die Bedeutung ihres Lebens in Ost-Berlin in der Zeit des Kalten Krieges und die Entstehung des Romans „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“.
Im Kapitel „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“ wird der Inhalt des Romans zusammengefasst und dessen formale Gliederung dargestellt. Die Zusammenfassung des Romans konzentriert sich auf die Lebensumstände der Ich-Erzählerin in einer West-Berliner WG-Wohnung, ihre Erfahrungen mit dem geteilten Berlin und die politischen Ereignisse des „Deutschen Herbstes“. Es wird zudem auf die Bedeutung der Liebe zum Theater und die Integration von autobiographischen Elementen in den Roman eingegangen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Seminararbeit sind: geteiltes Berlin, deutsch-türkische Literatur, Emine Sevgi Özdamar, „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“, Migranten, „Turkish Turn“, Theater, Autobiographie, Integration.
- Quote paper
- Bachelor Jeanette Michalak (Author), 2012, Das geteilte Berlin in der deutsch-türkischen Literatur anhand des Romans von Emine Sevgi Özdamar (2004): „Seltsame Sterne starren zur Erde: Wedding-Pankow 1976/77“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200752