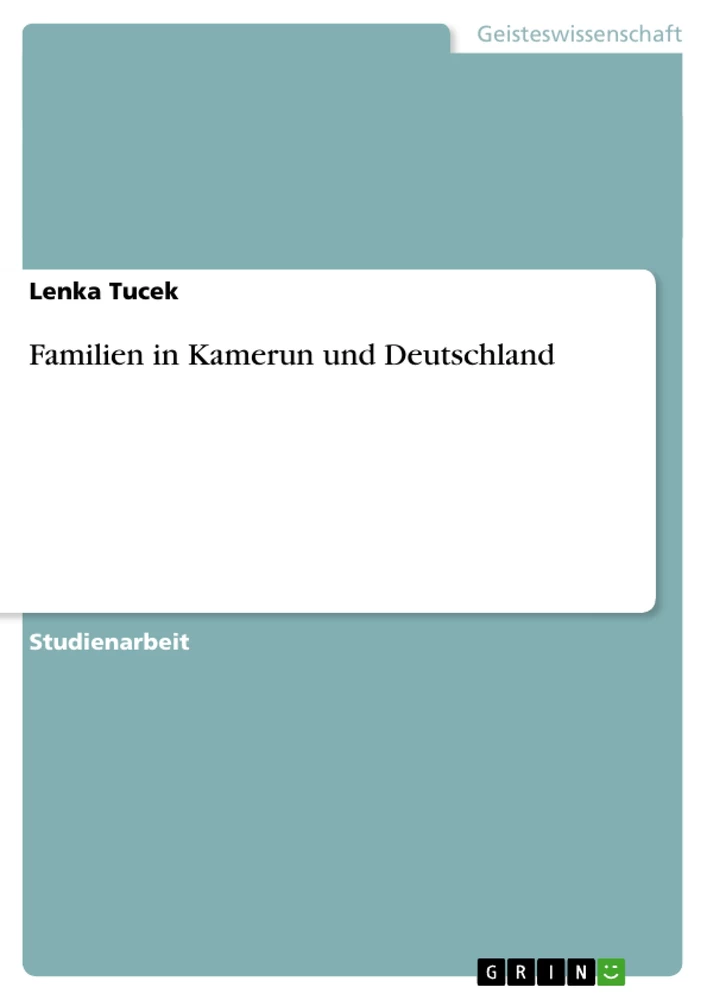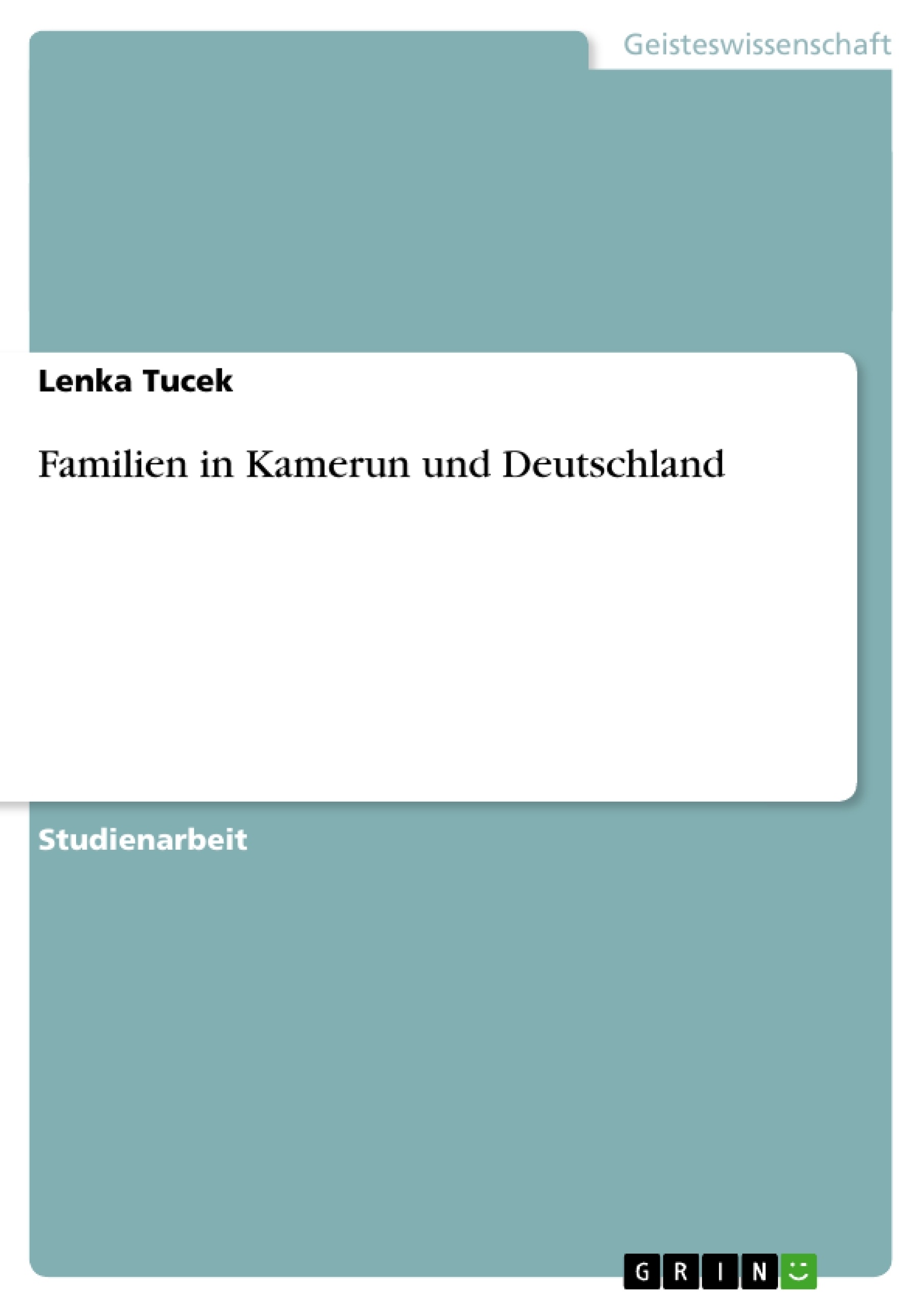Grundlage dieser Arbeit ist der Artikel „Mütterliches Sozialisationsverhalten in Kamerun. Kontinuität und Veränderung.“ von Therese M. Tchombe (In: Nauck, Bernhard 1997, S. 124 ff.). Nach einer kurzen Einführung in Form von Hintergrunddaten über Kamerun beschreibe ich das Familiensystem und den Prozess der Sozialisation in diesem afrikanischen Land. Anschließend berufe ich mich auf eine, in Tchombes Text dargelegte Studie, welche sich mit den Zielen elterlichen Erziehungsverhaltens in Kamerun beschäftigt. Therese Tchombe weist in ihrem Artikel darauf hin, dass in der heutigen Erziehung in Kamerun eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden habe und eindeutig mehr Wert auf die Bildung der Kinder gelegt werde als zuvor. Dies hängt untrennbar zusammen mit dem Wandel der Familienstrukturen und anderen gesellschaftlichen Einflüssen. Daher möchte ich in dieser Arbeit unter anderem näher auf den Wandel der Familienstrukturen in Kamerun eingehen. Da Mütter in Kamerun immer noch die Hauptrolle in der Erziehung der Kinder spielen, beschäftige ich mich hier überwiegend mit ihrer Funktion im Sozialisationsprozess und weniger mit der Rolle des Vaters. Besonders auffällig werden Veränderungen im mütterlichen Sozialisationsverhalten, wenn man in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung in den westlichen Ländern betrachtet. Deutschland und Kamerun, zwei von Familienstruktur und Sozialisationsprozess sehr unterschiedliche Länder und Kulturen, sollen in dieser Arbeit näher betrachtet werden. Ich versuche, die Entwicklung der Familie, bestimmte Sozialisationsverhaltensmuster und insbesondere die Erziehungsziele in zwei verschiedenen Kulturen zu beschreiben und gegenüberzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Daten und Fakten über Kamerun
- III. Familienstrukturen in Kamerun
- 1. Frauen in Kamerun
- 2. Sozialisation in Kamerun
- 3. Studie zum mütterlichen Sozialisationsverhalten in Kamerun
- IV. Familienstrukturen in Deutschland
- 1. Berufstätige Mütter
- 2. Kindererziehung in Deutschland
- 3. Studien zu Erziehungszielen und Sozialisation
- a) Emnid-Studie
- b) Studie zu den Erziehungswerten im Generationenvergleich
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Familienstrukturen und Sozialisationsprozessen in Kamerun und Deutschland. Sie analysiert die Rolle der Mutter in der Erziehung, vergleicht die Erziehungsziele in beiden Ländern und beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Familie.
- Wandel der Familienstrukturen in Kamerun
- Rolle der Mutter im Sozialisationsprozess in Kamerun
- Vergleich der Erziehungsziele in Kamerun und Deutschland
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf Familienstrukturen
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Sozialisationsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Arbeit basiert auf dem Artikel „Mütterliches Sozialisationsverhalten in Kamerun. Kontinuität und Veränderung.“ von Therese M. Tchombe. Sie vergleicht das Familiensystem und den Sozialisationsprozess in Kamerun und Deutschland, wobei der Fokus auf dem Wandel der Familienstrukturen in Kamerun und der Rolle der Mutter in der Erziehung liegt. Der Vergleich soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Erziehungszielen und Sozialisationsmustern beider Kulturen aufzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Veränderungen im mütterlichen Sozialisationsverhalten und deren Zusammenhang mit gesellschaftlichen Einflüssen.
II. Daten und Fakten über Kamerun: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über Kameruns politische und wirtschaftliche Situation. Es hebt die relative politische Stabilität unter Ahmadou Babatora Ahidjo und das wirtschaftliche Wachstum hervor, das hauptsächlich auf der Landwirtschaft basiert. Wichtige demografische Daten wie Geburten- und Todesrate werden präsentiert, ebenso wie wirtschaftliche Kennzahlen, die einen Einblick in die sozioökonomische Situation Kameruns geben. Die Informationen bilden den Kontext für die spätere Diskussion der Familienstrukturen und Sozialisationsprozesse.
III. Familienstrukturen in Kamerun: Dieses Kapitel beschreibt die traditionellen und sich verändernden Familienstrukturen in Kamerun. Es werden die verschiedenen Familientypen (Kernfamilie, polygame Familie, Ein-Eltern-Familie) und die Rolle der Frau in der Familie erläutert. Der Einfluss von Kolonialismus und Christianisierung auf das Familienleben wird thematisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Frau in der Erziehung der Kinder und den Unterschieden zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Der Text verdeutlicht den Einfluss der Mutter und verweist auf die Studien von Tchombe, welche die Schwerpunkte elterlichen Erziehungsverhaltens beleuchten.
IV. Familienstrukturen in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Familienstrukturen und den Sozialisationsprozess in Deutschland im Kontext des Vergleichs mit Kamerun. Es werden die Herausforderungen berufstätiger Mütter und die aktuellen Ansätze der Kindererziehung diskutiert. Die Kapitel analysiert Erziehungsziele anhand von Studien wie der Emnid-Studie und einer Studie zu den Erziehungswerten im Generationenvergleich. Die Zusammenfassung dieser Studien soll den Vergleich mit den kamerunischen Gegebenheiten ermöglichen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in den Familienstrukturen und Sozialisationsmustern der beiden Länder.
Schlüsselwörter
Familienstrukturen, Sozialisation, Kamerun, Deutschland, Mütterrolle, Erziehungsziele, Wandel, Kulturvergleich, polygame Familie, Berufstätige Mütter, Tradition, Moderne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Familienstrukturen und Sozialisationsprozesse in Kamerun und Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Familienstrukturen und Sozialisationsprozesse in Kamerun und Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Familienstrukturen in Kamerun, der Rolle der Mutter in der Erziehung und dem Vergleich der Erziehungsziele in beiden Ländern. Die Arbeit analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Familie und untersucht Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Sozialisationsprozessen beider Kulturen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert primär auf dem Artikel „Mütterliches Sozialisationsverhalten in Kamerun. Kontinuität und Veränderung.“ von Therese M. Tchombe. Zusätzlich werden Studien wie die Emnid-Studie und eine Studie zu den Erziehungswerten im Generationenvergleich herangezogen, um den Vergleich zwischen den beiden Ländern zu ermöglichen.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel I (Einleitung): Einführung in die Thematik und Forschungsfrage, Vorstellung der verwendeten Quellen und des Vergleichsansatzes. Kapitel II (Daten und Fakten über Kamerun): Überblick über die politische und wirtschaftliche Situation Kameruns, demografische Daten und sozioökonomische Kennzahlen. Kapitel III (Familienstrukturen in Kamerun): Beschreibung traditioneller und moderner Familienstrukturen in Kamerun, Rolle der Frau, Einfluss von Kolonialismus und Christianisierung, Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Kapitel IV (Familienstrukturen in Deutschland): Familienstrukturen und Sozialisation in Deutschland, Herausforderungen berufstätiger Mütter, Analyse aktueller Erziehungsansätze anhand von Studien (Emnid-Studie, Studie zu Erziehungswerten im Generationenvergleich). Kapitel V (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Familienstrukturen, Sozialisation, Kamerun, Deutschland, Mütterrolle, Erziehungsziele, Wandel, Kulturvergleich, polygame Familie, Berufstätige Mütter, Tradition, Moderne.
Welche Aspekte der Familienstrukturen werden in Kamerun untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Familientypen in Kamerun (Kernfamilie, polygame Familie, Ein-Eltern-Familie), die Rolle der Frau in der Familie, den Einfluss von Kolonialismus und Christianisierung auf das Familienleben und die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem mütterlichen Sozialisationsverhalten.
Wie werden die Familienstrukturen in Deutschland dargestellt?
Die Darstellung der Familienstrukturen in Deutschland konzentriert sich auf die Herausforderungen berufstätiger Mütter und aktuelle Ansätze der Kindererziehung. Die Arbeit analysiert Erziehungsziele anhand von empirischen Studien und vergleicht diese mit den Gegebenheiten in Kamerun.
Welchen Vergleich zieht die Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Familienstrukturen, Sozialisationsprozesse und Erziehungsziele in Kamerun und Deutschland. Der Vergleich soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen und den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Familienstrukturen in beiden Ländern beleuchten.
Welche Rolle spielt die Mutter in der Studie?
Die Rolle der Mutter im Sozialisationsprozess bildet einen zentralen Aspekt der Arbeit. Es wird untersucht, wie sich die Rolle der Mutter in Kamerun im Wandel der Zeit verändert hat und wie sie sich von der Rolle der Mutter in Deutschland unterscheidet.
- Quote paper
- Lenka Tucek (Author), 2001, Familien in Kamerun und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20053