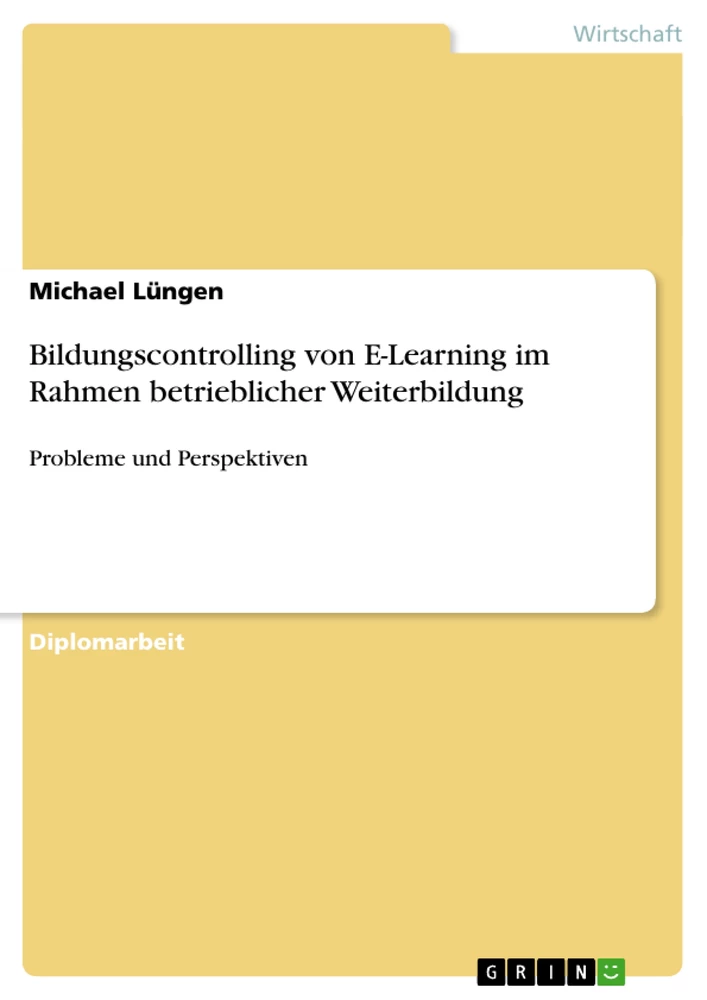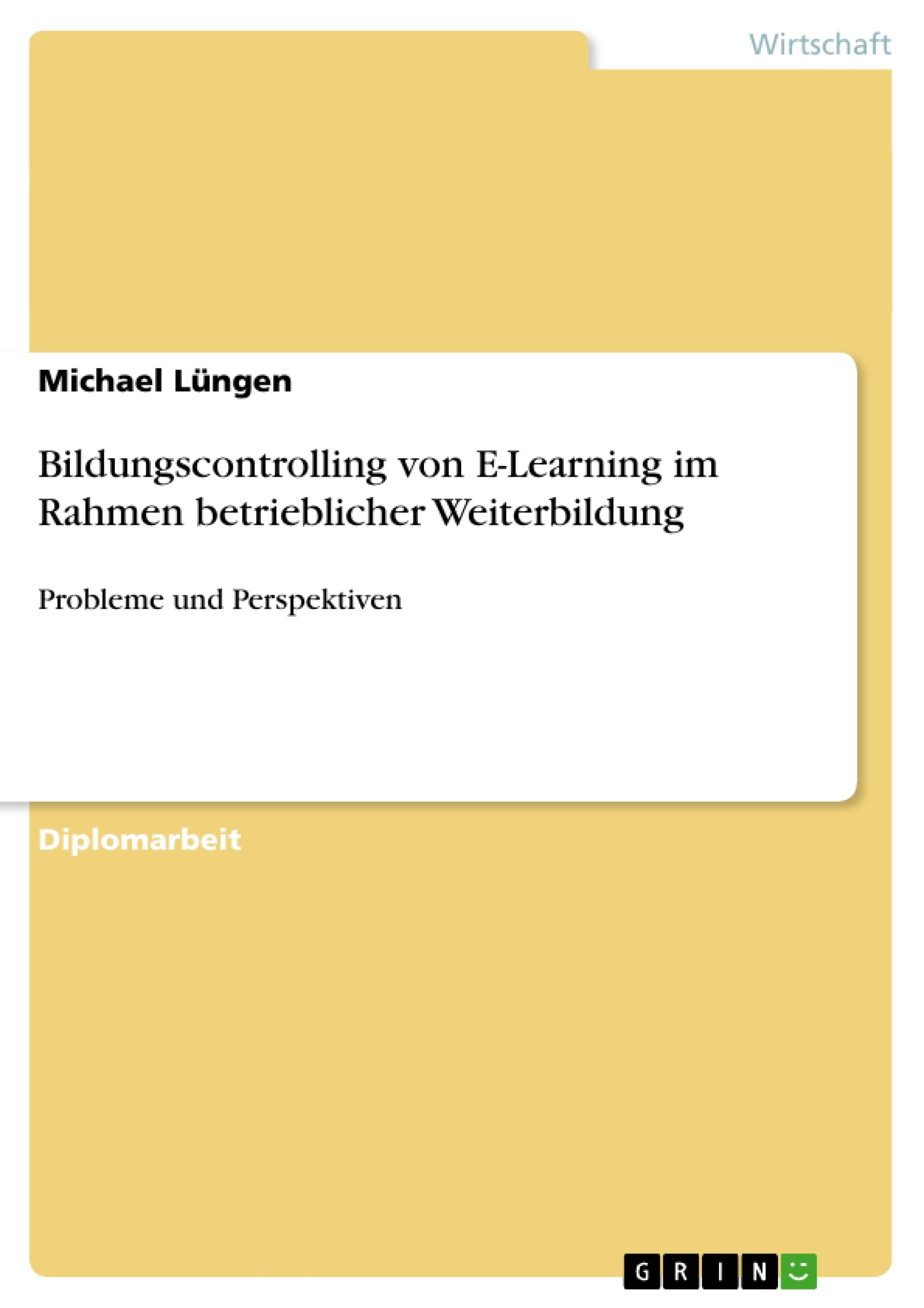„Bilde Dich weiter. Stillstand bedeutet Rückschritt. Wer klug ist, hält Schritt mit den Neuerungen in Werkstatt und Büro, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Er hält nicht nur Schritt, er sucht voranzugehen; dadurch wird man aufmerksam auf ihn […] zum Hinzulernen ist keiner zu alt.“
Dieses Zitat aus dem Jahr 1931 ist heute aktueller denn je. Aufgrund von stetig wachsenden Herausforderungen an Unternehmen und Mitarbeiter unterliegt Wei-terbildung einem ständigen Entwicklungs- und Anpassungsprozess. Im Rahmen dieser Arbeit wird dabei im Speziellen das Lernarrangement E-Learning als Form der betrieblichen Weiterbildung betrachtet, welches Gegenstand aktueller Diskus-sionen ist. In einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wird deut-lich, dass jedes vierte Unternehmen in Deutschland E-Learning-Maßnahmen an-bietet.
Unternehmen setzen aktuell verstärkt auf die Weiterbildung von Mitarbeitern, um dem Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen. Im Jahr 2010 haben 83,2 Prozent der deutschen Unternehmen ihren Mitarbeitern Weiterbildungs-maßnahmen angeboten. Im Durchschnitt ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 1.035 Euro je Mitarbeiter im Jahr. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass Mi-tarbeiter mehr Freizeit für Weiterbildungsmaßnahmen investieren. 2010 haben sie im Durchschnitt neunundzwanzig Stunden für Weiterbildungsmaßnahmen aufge-wendet, von denen im Schnitt zehn Stunden aus Freizeit eingeflossen sind.
Die Besonderheit des Bildungscontrollings ergibt sich dabei aus den Entwicklun-gen der Bildungsstrukturen in Unternehmen. Es wird ein kontinuierliches Lernen der Belegschaft vorausgesetzt, um einerseits den steigenden Anforderungen der Informationsgesellschaft gerecht zu werden und andererseits die sich bietenden Vorteile aus neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zielge-richtet für das Unternehmen einzusetzen. Folglich sind die bildungsverantwortli-chen Personen in Unternehmen von der Geschäftsführung dazu angehalten, kos-tenaufwändige Anschaffungen für Weiterbildungsmaßnahmen und Kosten für Trainer, Räumlichkeiten-, usw. zu rechtfertigen. Genau an diesem Punkt setzt das Bildungscontrolling an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen und Einordnung in den Kontext
- Personalentwicklung
- Betriebliche Weiterbildung
- Controlling
- Personalcontrolling
- Bildungscontrolling
- Begriffsdefinition
- Ziele, Aufgaben und Anforderungen
- Kosten und Nutzen
- Kostencontrolling
- Effizienzcontrolling
- Effektivitätscontrolling
- Bildungscontrolling als integrierendes Konzept
- Zielbestimmung
- Bedarfsanalyse
- Konzeption und Planung
- Kostenplanung
- Realisierung und Beurteilung
- Transfer
- Evaluation
- E-Learning
- Begriffsdefinition
- Einsatzmöglichkeiten und Bedeutung in der betrieblichen Weiterbildung
- Nutzen und Grenzen von E-Learning
- Blended Learning
- Bewertungsansätze für das Bildungscontrolling
- Orientierungshilfe für das Bildungscontrolling
- Zufriedenheitserfolg
- Lernerfolg
- Transfererfolg
- Geschäftserfolg
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Kennzahlen/Kennzahlensysteme
- Phasenorientiertes Controlling
- Return on Investment
- Learning Scorecard
- Bildungscontrolling im E-Learning
- Beurteilungskriterien
- Bewertung der Einzelansätze
- Zufriedenheitserfolg
- Lernerfolg
- Transfererfolg
- Geschäftserfolg
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Kennzahlen
- Phasenorientiertes Controlling
- Return on Investment
- Learning Scorecard
- Beurteilungsergebnisse für E-Learning-Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Bildungscontrolling im Rahmen betrieblicher Weiterbildung. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen des Bildungscontrollings im Kontext von E-Learning-Programmen.
- Definition und Einordnung des Bildungscontrollings
- Analyse der Kosten und des Nutzens von E-Learning-Programmen
- Bewertungsansätze für das Bildungscontrolling im E-Learning-Bereich
- Praxisrelevante Anwendungen und Beispiele
- Perspektiven und zukünftige Entwicklungen des Bildungscontrollings im E-Learning
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Bildungscontrolling im Kontext von E-Learning-Programmen vor und erläutert die Relevanz der Thematik für die betriebliche Weiterbildung.
- Begriffliche Grundlagen und Einordnung in den Kontext: Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Konzepte der Personalentwicklung, betrieblichen Weiterbildung, des Controllings und des Personalcontrollings. Es stellt den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und dem Bildungscontrolling her.
- Bildungscontrolling: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Bildungscontrollings und beleuchtet seine Ziele, Aufgaben und Anforderungen. Es werden verschiedene Ansätze zur Kosten- und Nutzenanalyse von Bildungsmaßnahmen vorgestellt, sowie das Konzept des Bildungscontrollings als integriertes Konzept.
- E-Learning: Dieses Kapitel definiert den Begriff des E-Learnings, erläutert seine Einsatzmöglichkeiten und Bedeutung in der betrieblichen Weiterbildung und beleuchtet Nutzen und Grenzen von E-Learning-Programmen. Das Kapitel behandelt auch das Konzept des Blended Learnings.
- Bewertungsansätze für das Bildungscontrolling: Dieses Kapitel stellt verschiedene Bewertungsansätze für das Bildungscontrolling vor. Dazu gehören Orientierungshilfen, die Messung des Zufriedenheits-, Lern-, Transfer- und Geschäftserfolgs sowie die Anwendung von Kennzahlen, Kosten-Nutzen-Analysen, Phasenorientiertem Controlling, Return on Investment und Learning Scorecards.
- Bildungscontrolling im E-Learning: Dieses Kapitel untersucht die Anwendbarkeit der vorgestellten Bewertungsansätze im E-Learning-Kontext. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Chancen des Bildungscontrollings für E-Learning-Programme analysiert.
Schlüsselwörter
Bildungscontrolling, E-Learning, betriebliche Weiterbildung, Personalentwicklung, Kosten-Nutzen-Analyse, Kennzahlen, Return on Investment, Learning Scorecard, Effizienz, Effektivität, Transfer, Geschäftserfolg, Zufriedenheitserfolg, Lernerfolg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Bildungscontrolling im Kontext von E-Learning?
Es ist ein Steuerungsinstrument, das Kosten und Nutzen von digitalen Weiterbildungsmaßnahmen analysiert, um deren Effizienz und Effektivität sicherzustellen.
Welche Ziele verfolgt das Bildungscontrolling?
Ziele sind die Rechtfertigung von Bildungsausgaben, die Optimierung des Lernerfolgs und die Sicherstellung des Transfers des gelernten Wissens in den Arbeitsalltag.
Was bedeutet "Return on Investment" (ROI) bei Weiterbildung?
Der ROI berechnet das Verhältnis zwischen den Kosten einer E-Learning-Maßnahme und dem daraus resultierenden finanziellen Nutzen für das Unternehmen.
Was ist eine Learning Scorecard?
Ein Bewertungssystem, das verschiedene Kennzahlen nutzt, um den Erfolg von Lernprozessen aus unterschiedlichen Perspektiven (z.B. Finanzen, Kunden, Prozesse) zu messen.
Warum investieren Unternehmen verstärkt in E-Learning?
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, Kosten für Trainer und Räume zu sparen und den Mitarbeitern flexibles Lernen zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Michael Lüngen (Autor:in), 2012, Bildungscontrolling von E-Learning im Rahmen betrieblicher Weiterbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200531