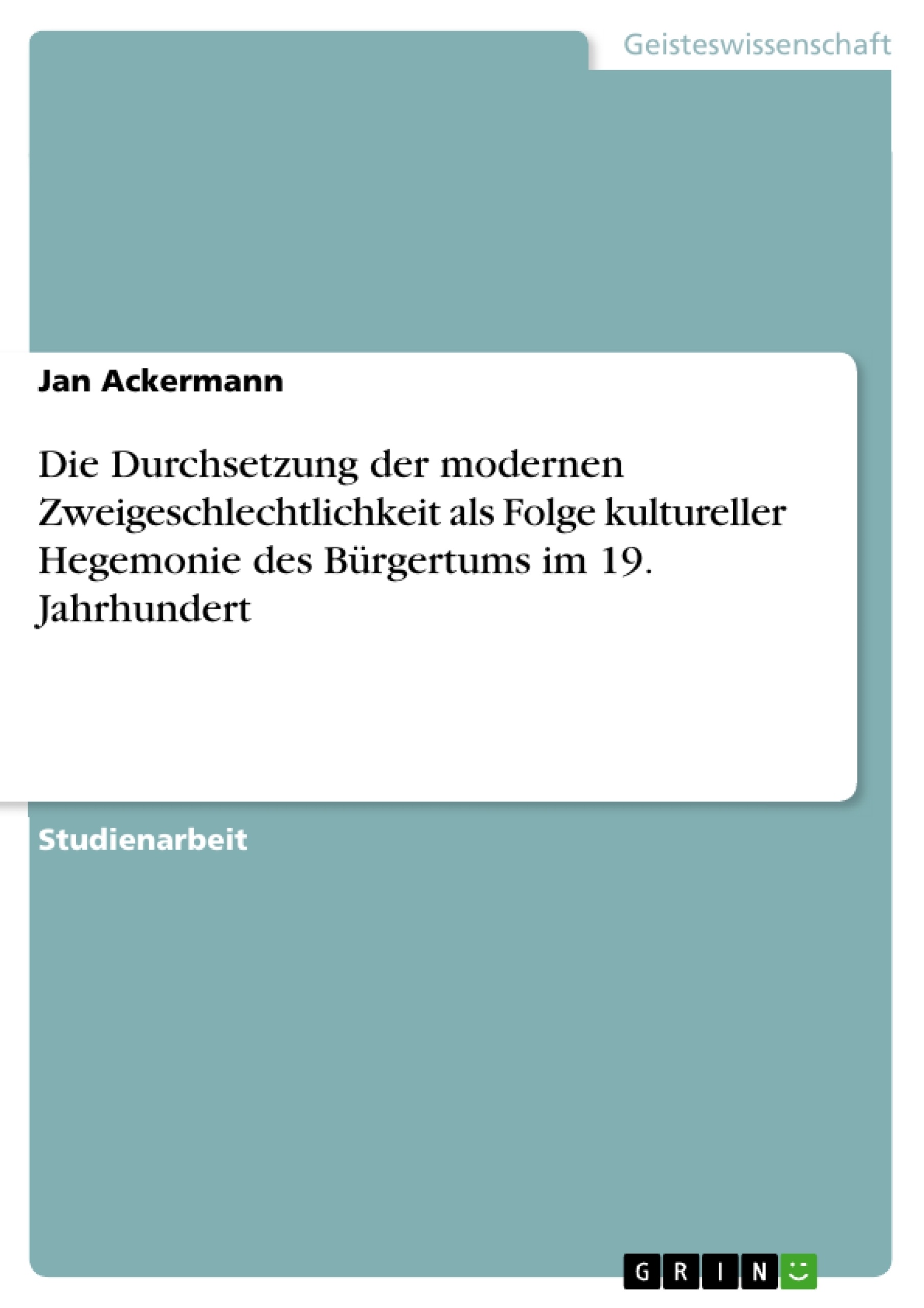1. Einleitung
2. Geschlechterdiskurse in Moderne und Vormoderne
2.1 Das Ein-Geschlechter-Modell
2.2 Das Zwei-Geschlechter-Modell
2.3 Kritische Reflexion
3. Familiale Leitbilder
3.1 Definition
3.2 Das ganze Haus
3.3 Die bürgerliche Familie
4. Gesellschaftliche Realitäten
5. Kulturelle Hegemonie
6. Verteidigung männlicher Privilegien oder Hegemonie des Bürgertums?
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Geschlechterdiskurse in Moderne und Vormoderne
2.1 Das Ein-Geschlechter-Modell
2.2 Das Zwei-Geschlechter-Modell
2.3 Kritische Reflexion
3. Familiale Leitbilder
3.1 Definition
3.2 Das ganze Haus
3.3 Die bürgerliche Familie
4. Gesellschaftliche Realitäten
5. Kulturelle Hegemonie
6. Verteidigung männlicher Privilegien oder Hegemonie des Bürgertums?
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie sich das moderne bipolare Geschlechtermodell mit seinen weitreichenden Folgen für die Konstituierung von Frau und Mann im Laufe des 19. Jahrhunderts in westeuropäischen Gesellschaften als allgemeingültig durchsetzen konnte, sodass es deren grundlegende Verfasstheit bis heute prägt. Dabei müssen verschiedenste Faktoren, wie Familie, Ökonomie, aber auch Bildung und Wissenschaften in den Blick genommen werden. Zunächst müssen allerdings noch einige Einschränkungen bezüglich der Reichweite der Untersuchung vorgenommen werden. Auch wenn die Ausgangsfrage die These impliziert, die Entwicklung des modernen Geschlechtermodells sei in allen westeuropäischen Gesellschaften gleich, oder zumindest ähnlich verlaufen, kann im Rahmen dieser Arbeit eine Betrachtung dieser gesamten Region nicht geleistet werden. Deshalb werden hier exemplarisch Entwicklungslinien in den (späteren) deutschen Gebieten betrachtet, die in dieser Form wahrscheinlich nicht für den Westen an sich 1 verallgemeinerbar sein werden. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Vorgänge dort in ähnlicher Form und auch mit ähnlichen Ergebnissen ebenso stattgefunden haben. Immerhin wurde dieser durch dieselben grundlegenden Umwälzungen in allen Lebensbereichen erfasst, sodass allgemein bezüglich Westeuropa, Nordamerika und Australien mit dem Übergang vom Feudalsystem zu einer kapitalistischen Produktionsweise vom Beginn der Moderne gesprochen wird. Während jedoch mit der Fokussierung auf das moderne Geschlechtermodell eigentlich eine Betrachtung von Entwicklungen seit der Renaissance notwendig wäre, wird sich hier in erster Linie den Umwälzungen in Deutschland seit dem Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gewidmet. Obwohl Rückgriffe auch auf frühere Zeitpunkte für die Ausgangsfrage notwendig sind, soll im Folgenden gezeigt werden, dass dies die entscheidende Phase ist, in der sich in Deutschland dieses Geschlechtermodell verallgemeinerte. Vor allem die Industrialisierung und hiermit verbunden der Aufstieg des Bürgertums und der bürgerlichen Familie sind dabei die entscheidenden Faktoren.
Die zugrunde liegende These ist hierbei, dass das Bürgertum in seiner Alltagspraxis das moderne Geschlechtermodell überhaupt erst herstellte und dieses sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durch eine kulturelle Hegemonie desselben zunächst diskursiv und spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch lebensweltlich in anderen Gesellschaftsschichten ausbreitete. Um diese These zu untermauern müssen zunächst einmal gesellschaftliche Realitäten streng von Leitbildern und Diskursen unterschieden werden, um deren wechselseitiges Verhältnis zueinander untersuchen zu können. Im Sinne Michael Meusers wird dabei davon ausgegangen, dass gesellschaftliche Diskurse keine bloße Widerspiegelung sozialer Wirklichkeit darstellen, diese aber durch das Bereitstellen von Deutungs- und Orientierungswissen mitgestalten.2 Umgekehrt haben selbstverständlich auch Umwälzungen der materiellen Wirklichkeit Einfluss auf den Verlauf von Diskursen, die dieser immer neu angepasst werden müssen, sodass hier von einem wechselseitigem Verhältnis auszugehen ist. Wie sich dieses Verhältnis konkret ausgestaltet, wird ebenso Thema dieser Arbeit sein. Dabei wird auf der Ebene von Leitbildern und Diskursen vor allem der Übergang vom vormodernen Ein- Geschlechter-Modell zum modernen Zwei-Geschlechter-Modell betrachtet und einer kritischen Reflexion unterzogen. Daran anschließend wird die Ablösung des familialen Leitbildes des ganzen Hauses durch das der bürgerlichen Familie in den Blick genommen, die damit eng verknüpft ist. Danach muss sich den gesellschaftlichen Realitäten im Lauf des 19. Jahrhunderts zugewendet werden, wobei klar wird, dass diese Leitbilder ihre Widerspiegelung in der sozialen Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts nur im bevölkerungsmäßig kleinen Bürgertum fanden, während eine solche Lebensform für die meisten Arbeiter_innen3 und landwirtschaftlich Tätigen schon materiell gar nicht möglich war. Um nun aber eine mögliche Erklärung bieten zu können, wie sich bürgerliche Familie und modernes bipolares Geschlechtermodell trotzdem als soziale Realität in der breiten Bevölkerung durchsetzen konnten, wird zum Schluss erläutert, was hier mit kultureller Hegemonie gemeint ist und wieso dieses Konzept einen hilfreichen Ausgangspunkt und eine notwendige Ergänzung verbreiteter Erklärungsversuche darstellt. Diese Elemente werden anschließend noch einer zusammenfassenden Betrachtung unterzogen, um Schlussfolgerungen ziehen und auf mögliche Unzulänglichkeiten eingehen zu können.
2. Geschlechterdiskurse in Moderne und Vormoderne
2.1 Das Ein-Geschlechter-Modell
In der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung ist in den letzten Jahrzehnten die Auffassung zur Lehrmeinung geworden, dass quasi seit der Antike bis zur Entstehung der modernen Wissenschaften im 18. Jahrhundert in Europa ein Ein- Geschlechter-Modell existiert habe, das seit dem späten 18. Jahrhundert durch das moderne Zwei-Geschlechter-Modell abgelöst wurde.4 Die wegweisenden und dabei immer zitierten Arbeiten wurden Anfang der Neunzigerjahre von Thomas Laqueur und Claudia Honegger vorgelegt.5 Die beiden Autor_innen weißen dabei anhand wissenschaftlicher Texte nach, dass sich in dieser Zeit bezüglich der Betrachtung von Geschlecht ein grundlegender Wandel vollzog. Im Gegensatz zur Moderne, bei der die zentrale Unterscheidungskategorie von Mann und Frau biologisch- anatomisch hergeleitet ist, bezogen sich Auseinandersetzungen mit Geschlecht von Antike und Mittelalter bis zur Renaissance immer in erster Linie auf soziale Rollen und Aufgaben. Damit wurden Mann und Frau „lediglich als unterschiedliche Ausprägungen von ein und demselben anatomischen Geschlecht“6 verstanden, wobei dies nicht mit einer generellen Gleichwertigkeit verwechselt werden darf. Der Mann wurde in diesem Modell als die vollkommene Form des Menschengeschlechts verstanden, während die Frau bereits als unvollkommenes Modell abgewertet wurde.7 Das Entscheidende an dieser Betrachtungsweise ist dabei allerdings, dass Unterschiede eben nicht als absolut, sondern relational in Kategorien von mehr oder weniger beschrieben wurden. Dabei spielte vor allem die antike Hitzelehre eine große Rolle, bei der davon ausgegangen wurde, dass Frauen im Gegensatz zu Männern kälter und feuchter seien, was als Ursache dafür verstanden wurde, dass weibliche Genitalien im Inneren des Körpers verbleiben, während männliche Genitalien wegen ihrer größeren Hitze und Trockenheit nach außen gestülpt werden. Damit war eine Grundlage geschaffen, von der aus anatomische Unterschiede nicht in Kategorien der Differenz, sondern von Entsprechung interpretiert werden konnten. Über den Grad der Entsprechung war damit eine Diskussion auf verschiedensten Ebenen angelegt. So wurde beispielsweise viel über den Anteil von weiblichem und
männlichem Samen an der Zeugung gestritten.8 Durch die Dominanz der sozialen Dimension bei Beschreibungen von Geschlecht war in vormodernen Gesellschaften auch ein Wechsel des Geschlechts ungleich einfacher möglich als heute. Schon ein Wechsel der Kleidung konnte Frauen die Möglichkeit eröffnen, sich von den gesellschaftlichen Beschränkungen ihres Standes zu befreien, was auch in zahlreichen Fällen bis ins 19. Jahrhundert hinein belegt ist.9 Allerdings kann, wie bereits angedeutet, nicht von einem vermeintlichen vorgeschlechtlichen Zeitalter bis zur Renaissance ausgegangen werden, da bereits in der Antike die Grundlage geschaffen wurde, auf der sich dann nach einigen Modifikationen in Mittelalter und Renaissance die Polarisierung der modernen Geschlechtscharaktere vollziehen konnte. So beschreibt Heinz-Jürgen Voß ausführlich, dass bereits in der Antike Männlichkeit und Weiblichkeit in ein bin ä res Dominanz-Subordinanz-Schema eingepasst waren, wobei Weiblichkeit bereits mit Haushalt und Familie, Männlichkeit dagegen mit Öffentlichkeit und Politik assoziiert waren.10 In der Renaissance wurde daran anknüpfend dieses Schema schon (wenn auch zunächst nur in der Zeugungslehre) um die für die Moderne wichtige Dimension Aktivität/Passivität erweitert.11 Die Sphären waren allerdings noch nicht strikt getrennt und es gab auch noch keine klare Differenzierung von weiblicher und m ä nnlicher Arbeit, der Übergang zwischen den Geschlechtern war allgemein fließender.
2.2 Das Zwei-Geschlechter-Modell
An diese geschlechtlichen Zuschreibungen konnten allerdings die Diskurse, die das moderne Zwei-Geschlechter-Modell prägten, gut anschließen. Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaften bis ins 19. Jahrhundert veränderten sich zunächst die Begründungszusammenhänge in Diskursen zu Geschlecht. Während in Antike und Renaissance diese Kategorie naturphilosophisch verhandelt wurde, spielten nun in erster Linie Biologie, Medizin und Anthropologie eine entscheidende Rolle. Bezüglich der Anatomie von weiblichen und männlichen Körpern verlagerten sich die dominanten Diskussionen von Theorien der Entsprechung immer weiter in Richtung Differenzbeschreibungen. Schon im 16. Jahrhundert finden sich in der Medizin einzelne, ab dem 17. und 18. Jahrhundert zunehmend mehr Abbildungen von als
weiblich oder männlich kenntlich gemachten Skeletten.12 Weibliche und männliche Anatomie wurden mit Hilfe von Präformationstheorien als bereits ab dem Zeitpunkt der Zeugung fundamental different verstanden und auch begrifflich wurden nun weibliche und männliche Geschlechtsorgane unterschiedlich bezeichnet.13
So wurden die entsprechenden Diskussionen mehr und mehr über Natur und Wesen von Mann und Frau geführt. Allerdings blieb man nicht bei Biologie und Anatomie stehen, sondern leitete davon auch Schlussfolgerungen für Psyche und Charakter der Geschlechter ab. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wird dabei in der Wissenschaft der Begriff Geschlechtscharakter erfunden, welcher eine natürliche, wesenhafte und damit nicht überwindbare Charakterdifferenz zwischen Männern und Frauen bezeichnet.14 Frauen werden hierbei in Spiegelung der realen Arbeitsteilung in privilegierten Bevölkerungsgruppen auf ihre Reproduktionsorgane reduziert und ihre gesamte psychische Struktur darauf zurückgeführt. So wurden die bereits früher vorhandenen geschlechtlichen Pole dem Sozialen entzogen und für biologisch determiniert und damit unabänderlich erklärt. Damit wurde das Geschlechterverhältnis auch gegen Kritik immunisiert, da eine Transformation desselben als Verstoß gegen die natürliche Ordnung verstanden wurde. Im Einzelnen wurden Frauen damit alle Eigenschaften zugeschrieben, die mit der privaten Sphäre assoziiert sind, wie Innerlichkeit, Nähe, Häuslichkeit, Passivität, Schwäche, Bescheidenheit, Abhängigkeit, Liebe, Empathie, Gefühl oder Schönheit. Männern hingegen wurden die Eigenschaften der öffentlichen Sphäre und der Kultur zugeschrieben: Äußerlichkeit, Weite, Aktivität, Stärke, Tapferkeit, Selbstständigkeit, Zielstrebigkeit, Geist, Verstand und Abstraktionsfähigkeit.15 Ähnlich wie bei der Herstellung der Kategorie Rasse wurde so vor allem von der Anthropologie wissenschaftlich fundiert eine natürliche Ordnung konstruiert, in die sich die Menschen zwangsläufig einzufügen hätten.16 Während diese Debatten allerdings bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts rein akademischer Natur waren, weißen Ute Frevert und Karin Hausen nach, wie entsprechende Differenzbeschreibungen im Laufe des 19. Jahrhunderts immer dominanter Eingang in Lexika und Literatur nicht nur für den akademischen Betrieb fanden und damit der Grundstein für ihre Verallgemeinerung gelegt wurde.
Frevert zeigt dabei, dass in Lexikaeinträgen des 18. Jahrhunderts Geschlecht im heutigen Sinne praktisch überhaupt keine Rolle spielte. Wenn dazu in der Bedeutung von männlich/weiblich überhaupt etwas zu finden war, dann nur wenige Worte, teilweise wird der Begriff auch ausschließlich genealogisch im Sinne von Abstammung erklärt. Im frühen 19. Jahrhundert hingegen, wird unter demselben Schlagwort ausführlich und in blumiger Sprache der Unterschied von Mann und Frau auf körperlicher, geistiger und gesellschaftlicher Ebene detailliert ausgemalt; es wird als natürliches Ordnungsprinzip von Gesellschaft überhaupt beschrieben und mit dem Fortpflanzungsverhalten gekoppelt. Diese Form der Darstellung zieht sich durch das gesamte Jahrhundert hindurch, wenn auch im späten 19. Jahrhundert die Differenzen nicht mehr so bis ins Detail durchexerziert werden. Der Fokus auf Geschlecht in der Bedeutung von männlich/weiblich bleibt den entsprechenden Lexika jedoch bis ins ausgehende 20. Jahrhundert erhalten. Frevert interpretiert diese Entwicklung so, dass der Begriff Geschlecht überhaupt erst im 19. Jahrhundert mit dem modernen Sinn von biologischem sexus gefüllt wurde. Daran anschließend wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts Wert darauf gelegt, diese biologische Differenz möglichst weitreichend auszubauen, bis dies seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert entweder wegen allgemeiner Evidenz - durch eine Widerspiegelung in den gesellschaftlichen Realitäten - nicht mehr notwendig war, oder bereits durch die Entstehung der ersten Frauenbewegung und öffentlichen Widerspruch nicht mehr unproblematisch möglich war.17 Um dabei nicht aus einer reinen Bedeutungsverschiebung des Begriffs Geschlecht falsche Schlüsse zu ziehen, widmet sie sich im Folgenden noch den Lexikaeintragungen von Mann und Frau/Weib. Dabei bestätigen sich allerdings die vorherigen Annahmen. Bei Eintragungen zu Mann aus dem 18. Jahrhundert wird sehr klar deutlich, dass es sich hierbei in erster Linie um soziale Standesdefinitionen handelt. Um ein Mann zu sein, reicht hier die Biologie noch lange nicht aus, vielmehr spielen soziale Qualifikationen wie Ehre oder Einkommen eine große Rolle. Seit dem frühen 19. Jahrhundert taucht dann der typische männliche Geschlechtscharakter in den Einträgen auf, der seit den 1830er Jahren klar aus der Biologie und dem männlichen Zeugungsvermögen abgeleitet wird. Ab dem späten 19. Jahrhundert verschwindet der Begriff Mann jedoch bis Mitte des 20. Jahrhunderts beinahe vollständig. Auch das erklärt Frevert als zunehmende Evidenz des M ä nnlichen, die erst mit dessen Irritationen durch die zweite Frauenbewegung aufgebrochen wird.18 Etwas anders stellt sich die Situation für die Schlagworte Frau und Weib dar. Auch hier geht es im 18. Jahrhundert noch in erster Linie um ihre soziale Stellung, wobei Frauen offensichtlich auch als arbeitende Helferinnen ihres Mannes verstanden werden. Und auch hier wird Weiblichkeit im frühen 19. Jahrhundert als qua natura bestimmte Ausrichtung auf Ehe und Mutterschaft beschrieben. Während Männlichkeit jedoch in dessen weiteren Verlauf offensichtlich nicht mehr erklärt werden musste, werden die Artikel zu Weiblichkeit immer ausführlicher und versuchen sich gegen dessen Ende offensichtlich gegen weibliche Emanzipationsbemühungen zur Wehr zu setzen. Zu dieser Zeit hatte Weiblichkeit eindeutig schon keine allgemeine Evidenz mehr.19 Als grobe Entwicklungslinie lässt sich Frevert zufolge festhalten, dass sich Geschlecht erst im späten 18. Jahrhundert mit der heute dominanten biologischen Bedeutung anreicherte, diese im 19. Jahrhundert dann zunehmend verallgemeinert und mit psychisch-charakterlichen Eigenschaften aufgeladen wurde, bis sie sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder auf die biologische Kernbedeutung zurück verlagerte, wobei mit der psycho-sozialen Aufladung eine zunehmende Polarisierung und Dichotomisierung von Mann und Frau einher ging.20
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Karin Hauser, die bei der Analyse von Lexika, Literatur und wissenschaftlichen Texten nachweist, dass die Abgrenzung polarer Geschlechtscharaktere von Mann und Frau seit Ende des 18. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein betrieben wurde. Dabei stellt sie zwei zentrale Trennungsachsen fest, die aus je unterschiedlichen Bereichen abgeleitet werden. Die Pole Rationalität/Emotionalität spiegeln dabei die gesellschaftliche Arbeitsteilung - und damit die natürliche Ordnung - und die Pole Aktivität/Passivität die Rolle beim Geschlechtsakt. Dabei fällt auf, dass diese Charaktere im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erst erfunden wurden, um daran anschließend im Laufe des 19. Jahrhunderts ausführlich mit wissenschaftlichen Theorien unterfüttert zu werden. Danach erstreckte sich der Prozess ihrer Popularisierung in der breiten Bevölkerung bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, bis sie seit den 1950er Jahren wieder an Bedeutung verloren.21
An diese relativ weit verbreiteten Auffassungen müssen im Folgenden noch einige offene Fragen und kritische Einwände angeschlossen werden.
2.3 Kritische Reflexion
Heinz-Jürgen Voß hingegen widerspricht grundsätzlich der Annahme, dass es es ein vormodernes Ein-Geschlechter-Modell bis zur Renaissance und ein davon klar zu unterscheidendes modernes Zwei-Geschlechter-Modell gäbe. In seiner Dissertation widmet er sich ausführlich verschiedenen Geschlechtertheorien seit der Antike bis ins 21. Jahrhundert und kommt zu dem Schluss, dass es in dieser gesamten Zeitspanne immer akademische Diskussionen über Differenz und Entsprechung und den Grad derselben gab22. Dabei nimmt er sowohl die Referenzautoren von Laqueur und Honegger näher in den Blick und sucht darüber hinaus nach weiteren Autor_innen und Positionen, die von der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung übersehen oder übergangen wurden. Laqueur wirft er dabei vor, dass bei einer intensiveren Auseinandersetzungen mit seinen Quellen nicht zu übersehen sei, dass bereits in der Antike - und hier auch bei Aristoteles und Galenos, auf die sich Laqueur zentral bezieht - unter naturphilosophischen Vorzeichen sowohl Elemente der Differenz, als auch der Entsprechung zu finden seien. Durch eine stark homogenisierende Herangehensweise habe er über historisch weit entfernte und starken Veränderungen unterworfene Epochen ein konsistentes Geschlechtermodell festgeschrieben, indem er systematisch gegenläufige Tendenzen ignorierte. Zugute hält er ihm hingegen, dass seine Darstellungen einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt hätten, dass auch vermeintliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse gesellschaftlich hergestellt würden.23 Auch gegen Honeggers Betrachtungen der Moderne wendet er Ähnliches ein. So weißt er beispielsweise bei einem zentralen Referenzautor Honeggers, Jacob Fidelis Ackermann, nach, dass in seinen Theorien Elemente der Entsprechung dominierten und Differenzen im Sinne eines mehr oder weniger beschrieben wurden. Dies ging sogar soweit, dass er annahm, dass sich männliche und weibliche Körper durch eine entsprechende Lebensweise einander angleichen könnten.24 Darüber hinaus stellte er dar, dass sich seit der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert hinein intensive sowohl gesellschaftliche, als auch biologisch- medizinische Debatten um die Themen Geschlechtergleichheit und -differenz finden lassen.25 Mit diesen Einwänden, die sich gegen die Vorstellung eines grundlegenden Bruchs der Geschlechterordnung von Moderne und Vormoderne wenden, wird der Blick frei für das Verhältnis von Kontinuität und Wandel in dieser Zeit der Umbrüche.
Cornelia Klinger stellt in diesem Sinne klar, dass „[w]eder die Abwesenheit der Frauen von öffentlichen Funktionen, von politischen Ämtern oder ökonomischen Machtpositionen, noch ihre Zuständigkeit für die reproduktiven Funktionen und den häuslichen Tätigkeitsbereich, noch schliesslich [sic!] die Ausgrenzung der Geschlechterordnung insgesamt von dem, was als Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit definiert wird, […] moderne 'Erfindungen'“26 seien. Im Gegenteil seien diese tief in der westlichen Kultur verwurzelt und die moderne geschlechtliche Sphärentrennung sei in dieser Form nur auf Grundlage der bereits vorhandenen hierarchischen Geschlechterordnung möglich gewesen.
Dem ist an sich umfassend zuzustimmen, trotzdem begeht Voß einen Fehler, wenn er mit der Analyse akademischer Diskurse die neue Qualität der modernen Geschlechterordnung in Frage stellen will. Während sich schon grundsätzlich das Problem ergibt, dass historische Analysen von Diskursen über Geschlecht bis mindestens zum 19. Jahrhundert ausschließlich Debatten unter privilegierten gesellschaftlichen Kreisen abbilden, während die Lebenswirklichkeiten des Großteils der Bevölkerung nicht, beziehungsweise nur sehr schwer überhaupt erfassbar sind, gilt dies umso mehr, je weiter entfernt die entsprechende Epoche ist. Trotzdem geht Voß mit guten Gründen davon aus, dass Geschlecht seit der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert hinein für Unterprivilegierte - und damit die Mehrheit der Bevölkerung - kaum Relevanz besaß.27 Damit ist aber der Kern dessen angedeutet, was diese Qualität in der Moderne ausmacht. Während nämlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts akademische Debatten über Differenz und Entsprechung und deren Grad geführt wurden, sickerten geschlechtliche, wesenhafte Zuschreibungen seitdem in die breite Bevölkerung durch. So bildeten diese sich Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts erstmals durch Sphärentrennung und Arbeitsteilung, sowie hegemoniale Idealbilder in der Alltagspraxis der Mehrheit der Bevölkerung ab. Dementsprechend lassen sich auch bei fast allen Autor_innen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts für Geschlechtergleichheit stritten, Bezüge zu den genannten Geschlechtscharakteren finden, so wenn beispielsweise das Eintreten für Frauenbildung damit begründet wurde, dass dies ihre erzieherischen Aufgaben erforderten.28 Damit ist auch zu erklären, dass Laqueur und Honegger zu ihren relativ eindeutigen Ergebnissen kamen und ihre Veröffentlichungen so breit rezipiert wurden. So sind Voß' Hinweise auf emanzipatorische oder potentiell emanzipatorische Debattenbeiträge ein durchaus wichtiges Korrektiv, sie verschleiern jedoch, dass diese Positionen seit dem späten 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts marginalisiert waren und gesamtgesellschaftlich kaum Einfluss hatten. In diesem Sinne kommt auch Rüdiger Schnell in einer Kritik an Laqueurs Ausführungen zu dem Ergebnis, dass der maßgebliche Wandel von Vormoderne zur Moderne nicht der von einem Ein- Geschlechter-Modell zu einem Zwei-Geschlechter-Modell gewesen sei, sondern vielmehr der Wandel von prinzipiell pluralen Geschlechterbildern zu einem einheitlichen.29
Darüber hinaus weißt Voß nach, dass Texte, die eine grundlegende Ungleich art igkeit von Frau und Mann behaupten weder in den biologisch-medizinischen Wissenschaften dominant waren, noch breitere gesellschaftliche Unterstützung fanden. Im Gegenteil waren gerade Ansichten im Sinne einer Komplementarität der Geschlechter verbreitet, was er als Argument gegen das Zwei-Geschlechter-Modell vorbringt.30 Dies verkennt allerdings, dass Komplementarität gerade den Kern der modernen Geschlechterordnung ausmacht und diese die Grundlage bildet, von der aus konkrete Ungleichheiten mit den prinzipiellen Gleichwertigkeitsansprüchen der Moderne versöhnt werden konnten, wie noch zu zeigen sein wird.
Wie es nun aber dazu kommen konnte, dass Geschlecht in dieser Form zu einem so weitreichenden und universalen Ordnungsprinzip für den Großteil der Bevölkerung wurde, wird im Folgenden betrachtet werden. Bevor aber gesellschaftliche Realitäten und die Popularisierung des modernen Geschlechtermodells in den Blick genommen werden, müssen zunächst noch die mit Geschlecht eng verknüpften familialen Leitbilder zu Beginn der Moderne untersucht werden.
3. Familiale Leitbilder
3.1 Definition
Bei einer Betrachtung familialer Leitbilder ist zunächst einmal eine Definition dessen notwendig, was mit Familie überhaupt gemeint ist. Alltagsssprachlich wird der Begriff heute häufig in einer sehr eingeschränkten Bedeutung im Sinne der biologisch verwandten Kernfamilie verwendet - also Elter(n) und Kinder(n). Auch in der Wissenschaftssprache gibt es keine einheitliche Familiendefinition, im Gegenteil existieren zahllose verschiedene, die je nach Fragestellung unterschiedliche Vor- und Nachteile bieten.31 Für eine Auseinandersetzung, die sich historisch mit Familie beschäftigt und dabei gesellschaftlichen Wandel in den Blick nehmen will, erscheint eine Definition im alltagssprachlichen Sinn ungeeignet, da diese einerseits eine allgemeine Ableitung aus dem aktuell zumindest ideell vorherrschenden Familienmodell - der bürgerlichen Familie - darstellt und damit andererseits abweichende familiale Lebensformen in anderen Kulturen, zu anderen Zeitpunkten, oder auch in marginalisierten Gruppen innerhalb der Gesellschaft nicht erfassen kann. Außerdem werden damit verschiedene Mythen, die sowohl in wissenschaftlichen, als auch in populären Darstellungen von Familie existieren, weiter bedient. Zu nennen wäre hier vor allem der Konstanzmythos, der die Vorstellung meint, dass Familie als Gefühlsgemeinschaft eine Naturkonstante und damit in allen Kulturen und zu allen Zeiten anzutreffen sei.32 Damit ist diese Definition eine höchst normative und für die wissenschaftliche Forschung ungeeignet. Deshalb wird hier eine sehr offene Definition von Familie gewählt, die sowohl frei ist von solchen normativen Aufladungen, als auch historische Variationen familialer Lebensformen erfassen kann. Familie soll hier also verstanden werden als „Lebensform, in der zumindest eine Generationenbeziehung in Form einer Elter- Kind-Beziehung vorhanden ist.“33 Damit ist eine explizit soziologische Familiendefinition getroffen, die der Tatsache Rechnung trägt, dass beispielsweise Elter-Kind-Beziehungen auch ohne eine biologische Elternschaft aufgebaut werden können. Das Ausklammern von Blutsverwandtschaft ist dabei auch begriffsgeschichtlich angemessen, da der Begriff Familie, der erst im 18. Jahrhundert in die deutsche Alltagssprache einsickerte, zunächst das Bedeutungsspektrum von Haus übernahm, mit der im Sinne des ganzen Hauses alle Mitglieder dieser Wirtschaftseinheit gemeint waren.34
Dass zunächst auf Familienleitbilder fokussiert wird, soll zudem die Diskrepanz zwischen Diskursen über Familie und gesellschaftlichen Realitäten unterstreichen. Da in populären und populärwissenschaftlichen Arbeiten diese beiden Ebenen oft vermischt werden, wird der Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Veränderungen gründlich verstellt.35 Wie diese aber konkret entstehen und verlaufen, soll in dieser Arbeit gerade untersucht werden.
3.2 Das ganze Haus
Das ganze Haus war das dominante familiale Leitbild der frühen Neuzeit bis ins ins 19. Jahrhundert. Der Begriff selbst wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts von dem einflussreichen konservativen Schriftsteller Wilhelm Heinrich Riehl geprägt. Riehl brachte diese Lebensform als Garant der traditionellen Ordnung gegen die Umbrüche der Moderne in Stellung und interpretierte sie als bestimmend seit der Antike.36 Allerdings scheint auch hier fraglich, inwiefern man über diesen langen Zeitraum von einer im Prinzip einheitlichen Lebensform ausgehen kann. Zwar wurde auch im griechischen oikos und der römischen familia im Rahmen einer Hausgenossenschaft gewirtschaftet, doch gab es darüber hinaus entscheidende Unterschiede. So hatte der männliche Familienvater die unbeschränkte Macht über die anderen Haushaltsmitglieder, die bis zur Tötung der Ehefrau oder zum Verkauf der Kinder reichte. Außerdem hatte die Kernfamilie eine herausragende Bedeutung, die von den Sklaven klar abgetrennt war und es war eine zentrale Funktion derselben, männliche Nachkommen zur Fortführung des Haushalts hervorzubringen.37 Um die begriffliche Schärfe zu wahren ist folglich hier mit ganzes Haus ausschließlich das familiale Leitbild des 18. und 19. (und in bestimmten Bevölkerungsteilen auch noch des 20.) Jahrhunderts gemeint.
Ein solcher Haushalt ist idealtypisch gekennzeichnet durch eine Einheit aus Produktion, Konsumtion, Wohnen und Leben. In erster Linie muss er sich als funktionierende Arbeitseinheit bewähren. Produziert wird dabei vor allem für die eigene Subsistenz, wenn überhaupt wird nur ein sehr geringer Teil der produzierten Güter getauscht oder auf dem Markt verkauft. Dabei gehören zum Haus alle dort lebenden Mitglieder, was neben dem männlichen Haushaltsvorstand seine Ehefrau, Kinder, Alte, eventuelle unverheiratete Verwandte und das Gesinde - also alle Arten von im heutigen Sprachgebrauch Hausangestellten - umfasst. Blutsverwandtschaft spielt dabei nur eine nachgeordnete Rolle, zwischen Kernfamilie und weiteren Haushaltsmitgliedern wird nicht besonders unterschieden. Darüber hinaus gibt es eine große Fluktuation, weil durch die hohe Sterblichkeit ausfallende Mitglieder durch Aufnehmen von neuem Gesinde oder Wiederheirat ersetzt werden müssen und auch die Kinder früh das Haus verlassen. Zwar finden sich schon Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, aber noch keine strikte Trennung von weiblicher und m ä nnlicher Arbeit. So existieren unterschiedlich stark ausgeprägte Überlappungen zwischen den geschlechtlich konnotierten Arbeitsbereichen und Frauen sind in den gesamten Produktionsprozess involviert. Nur die engere Führung des Haushalts, wie waschen und kochen, sind als relativ ausschließlicher weiblicher Bereich vorhanden, sowie die Vertretung des Hauses nach außen ein Privileg des männlichen Haushaltsvorstands ist. Außerdem gibt es noch keine differenzierte Kindheitsphase, sobald Kinder körperlich zu arbeiten in der Lage sind, werden auch sie in die Produktion eingebunden. Auch eine funktionale Differenzierung der Wohnräume ist sich noch nicht ausgeprägt, wodurch sich in Verbindung mit der relativen Enge des Hauses auch keine Privatsphäre ausbilden kann. So haben auch emotionale Bindungen unter den Mitgliedern der Kernfamilie wenig Raum und nur nachgeordnete Bedeutung, wenn man auch mittlerweile davon ausgeht, dass sie historisch eine gewisse Rolle spielten und diese bisher unterschätzt wurde. Allgemein kann durch diese Faktoren von keiner klaren Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum gesprochen werden und auch Produktion und Reproduktion bilden eine Einheit.38
3.3 Die bürgerliche Familie
In der idealtypischen bürgerlichen Familie hingegen stellt sich die Organisationsform des Haushalts gänzlich anders dar. Die weitreichendsten Folgen hat dabei die Konstitution einer abgeschlossenen privaten von der öffentlichen Sphäre. Während in dem Modell des ganzen Hauses die Produktion eng an den Haushalt gekoppelt ist, wird diese im bürgerlichen Familienmodell aus diesem ausgelagert. Mit der Durchsetzung von Erwerbsarbeit außerhalb des Hauses wird die Produktion gänzlich von diesem abgespalten. So entsteht eine männliche, öffentliche Sphäre und damit auch die Idee m ä nnlicher Arbeit. Im Gegensatz dazu wird ein privater Binnenraum geschaffen, der der blutsverwandten Kernfamilie vorbehalten ist und der von der Öffentlichkeit abgeschottet wird. Die in diesem Bereich anfallenden reproduktiven und emotional-fürsorgerischen Arbeiten werden an die Frau delegiert und im Gegensatz zur Erwerbsarbeit abgewertet, indem ihnen der Status als Arbeit aberkannt wird. Dem Mann kommt durch diese Organisationsform die Rolle des Ernährers zu, während die Frau auf ihre Funktion als Hausfrau, Mutter und Ehefrau festgelegt wird. Möglich wird diese Sph ä rentrennung durch die Verallgemeinerung von Geldform, Warenproduktion und des Marktes; während in vorindustriellen Haushalten Subsistenz das Ziel der Produktion war, wird nun außer Haus für den Markt produziert. Damit verknüpft spielt die funktionale Differenzierung der Wohnräume eine große Rolle. Durch die relative Größe der Wohnung oder des Hauses im Verhältnis zu den dort lebenden Personen kann diese Abgrenzung der Sphären im Haushalt fortgesetzt werden. So kann beispielsweise die Küche als weibliche Domäne in einen eigenen Raum verlagert werden, während für das männliche Schaffen das Einrichten eines Arbeitsraums möglich ist. Zusätzlich ist man imstande, ein halböffentliches Empfangszimmer für Gäste vom sonstigen Wohnraum abzutrennen. Außerdem hat die Differenzierung privater Schlafzimmer als Rückzugsraum einen entscheidenden Anteil daran, Privatsphäre überhaupt erst zu konstituieren. So kann auch das Gesinde - falls noch vorhanden - aus diesem privaten Kernraum in separate Räume ausgegliedert werden. Auch die Erfindung der Kindheit ist eng mit diesem Familienmodell verknüpft. Da im Laufe des 19. Jahrhunderts Bildung zunehmend wichtiger wurde, um die späteren Aufgaben erfüllen zu können, musste der Erziehung der Kinder besonderer Wert beigemessen werden. Dies galt in Deutschland umso mehr, da hier dem Bürgertum der gesellschaftliche Aufstieg zunächst als Dienstklasse des Adels gelang und nicht wie in England als besitzende Unternehmer. Durch die Entstehung und Ausweitung dieser eigenen Lebensphase, in der die Mutter für das Wohl der Kinder zu sorgen hatte, wurde einerseits der zeitliche Aufwand für die Kindererziehung wesentlich vergrößert und andererseits der Grundstein für eine Idealisierung weiblicher Mütterlichkeit gelegt. Auch die Ehe selbst erfuhr eine entscheidende Aufwertung; während in der vorindustriellen Zeit vielfältige Formen des ehelosen Konkubinats verbreitet waren, wurden diese nun zunehmend delegitimiert. Die Ehenormen wirkten hierbei auch grundlegend an der Konstituierung von weiblicher Passivität und männlicher Aktivität mit. Während nämlich für Frauen Keuschheit bis zur Hochzeitsnacht verbindlich war, galt diese Norm für bürgerliche Männer wenig bis gar nicht. Im Gegenteil war es durchaus üblich mit den adoleszenten Söhnen zu Prostituierten zu gehen, um sie dort erste sexuelle Erfahrungen machen zu lassen. So hatten bürgerliche Frauen keine andere Wahl, als Sexualität ab der Hochzeitsnacht von ihren erfahreneren Ehemännern zu erdulden; eine Erfahrung, aus der in der Wissenschaft nun die wesenhafte Passivität der Frau im Vergleich zu Männern abgeleitet werden konnte.
In ihrer gesamten Verfassung ist das bürgerliche Familienmodell damit ausgerichtet auf Komplementarit ä t. Während der Mann in der harten rationalen Öffentlichkeit, in der abstrakten Gesellschaft Erwerbsarbeit nachgeht, um das Auskommen der Familie zu sichern, sorgt sich die Frau im privaten Raum aufopferungsvoll um die Kinder und den Haushalt und verschafft dem Mann liebevoll Entspannung, wenn er von seinem Tagewerk nach Hause kommt. Damit sind in dem Leitbild der bürgerlichen Familie all jene Faktoren angelegt, die parallel in der Wissenschaft zur Grundlage des modernen Geschlechtermodells wurden.39
Dass jedoch sowohl das ganze Haus, als auch die bürgerliche Familie in dem genannten Zeitraum stets nur Leitbilder waren, die sich keineswegs in den Lebensformen der Mehrheit der Bevölkerung finden lassen, wird im Folgenden herausgearbeitet werden.
4. Gesellschaftliche Realitäten
Wenn man nun untersuchen will, wie sich das Geschlechterverhältnis im täglichen Leben der Bevölkerung des 19. Jahrhunderts gestaltete, liegt es nahe, sich auf die Ausbreitung der familialen Lebensformen in den entsprechenden Bevölkerungsteilen zu konzentrieren. Denn beispielsweise zu Einstellungen bezüglich Geschlecht liegen aus dieser Zeit selbstverständlich keine Daten vor. Eine andere Möglichkeit wäre die Auswertung literarischer Texte, was auch schon von einigen Autor_innen geleistet wurde.40 Hier ergibt sich allerdings die Problematik, dass tendenziell nur Ansichten der schreibenden Oberschicht erfasst würden, beziehungsweise wenn ü ber andere Schichten geschrieben wurde, dies meist hochgradig projektiv war. Außerdem wäre damit fraglich, inwieweit man dabei sinnvoll Leitbilder von gesellschaftlichen Realitäten unterscheiden könnte. Für Formen des familialen Zusammenlebens gibt es allerdings bereits für das 19. Jahrhundert eine recht umfangreiche Datenlage. Da, wie beschrieben, das moderne Geschlechtermodell konstitutiv mit der bürgerlichen Familie verknüpft ist, scheint die Fokussierung auf die Ausbreitung von Familienformen hier angemessen.
Allgemein fällt dabei zunächst auf, dass die Familienformen im 19. Jahrhundert äußerst vielfältig sind, sodass sich kaum für einzelne Bevölkerungsgruppen einheitliche Modelle herausstellen lassen. Während heute viel von einer Krise der Familie und von Pluralisierung von Lebensformen geschrieben wird, gilt dies umso mehr für das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Im Gegenteil scheint das Deutschland der 50er und 60er Jahre eine Ausnahme gewesen zu sein, als es tatsächlich eine dominierende Familienform gab. Generell ist der genannte Zeitraum von Widersprüchen und Ungleichzeitigkeiten geprägt, sodass sich verschiedene Mischformen mit unterschiedlichen Elementen der Leitbilder bürgerliche Familie und ganzes Haus finden lassen. Konzeptuell lässt sich dabei zwischen der meist bäuerlich geprägten Landbevölkerung, dem städtischen Handwerk, der städtischen Arbeiterschaft und dem städtischen Bürgertum unterscheiden.
So lässt sich gerade für die Landbevölkerung ein sehr heterogenes Bild feststellen, das vor allem von regionalen Unterschieden geprägt war. Die Landbevölkerung verringerte sich in den deutschen Gebieten im 19. und 20. Jahrhundert deutlich langsamer als die von Landwirtschaft lebenden Menschen. So entstanden verschiedene Lebensformen, in denen neben Landwirtschaft noch Handwerk, Heim- oder Fabrikarbeit betrieben werden musste. Ein entscheidender Faktor hierbei war das Erbrecht. So galt in den meisten norddeutschen Gebieten das Anerbenrecht, bei dem der gesamte Hof an einen Erben, meist den ältesten oder jüngsten Sohn, übergeben wurde. Hierdurch funktionierte die traditionelle, am Leitbild des ganzen Hauses orientierte Lebensform noch relativ lange, weil die Größe des Hofes erhalten blieb und so für die Subsistenz des Haushalts gesorgt werden konnte. In den südlichen Gebieten hingegen galt das Realerbteilungsrecht, nach dem der Landbesitz zu gleichen Teilen auf alle Erben aufgeteilt wurde. Dies verursachte eine fortschreitende Parzellierung des Landes, sodass fast alle Familien unterschiedlichste Formen des Nebenerwerbs praktizieren mussten.41 Während sich jedoch im Norden schon im Lauf des späten 18. Jahrhunderts Ansätze bürgerlicher Wohnkultur entwickelten, setzte dieser Prozess in manchen Alpengebieten erst im 20. Jahrhundert ein. Dagegen funktionierte die Einheit von Produktion und Konsumtion im Norden länger, während sich im Süden schon im 18. Jahrhundert Formen von abhängiger Beschäftigung außerhalb des Hauses durchsetzten. Leitbild war dabei in allen landwirtschaftlich geprägten Gebieten bis Mitte des 20. Jahrhunderts das ganze Haus und hier entsprachen auch die realen Strukturen diesem am ehesten.42
Ähnlich sah es im städtischen Handwerk aus. Das ganze Haus behielt normative Gültigkeit, allerdings lösten sich schon seit der frühen Neuzeit bis auf die Verschränkung von Unternehmen und Familie die meisten anderen Kennzeichen dieses Modells auf. In einigen Regionen wohnte zwar noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts die Mehrzahl der Gesellen bei der Meisterfamilie, die Regel war dies jedoch in dessen weiteren Verlauf nicht mehr. Und selbst wo es noch diesen gemeinsamen Haushalt gab, war trotzdem schon eine klare Abgrenzung der Kernfamilie zu erkennen. Durch die Zunahme der städtischen Bevölkerung war schon Mitte des 19. Jahrhunderts für viele Gesellen keine selbstständige Existenz mehr in Aussicht, sodass sie oft früh heirateten und in Folge dessen ähnlich den Arbeiterfamilien auch auf Einkommen der Frauen und auf zusätzliche Einkünfte durch Untervermietung angewiesen waren. Beim Handwerk lässt sich also ebenso wenig eine klare Struktur erkennen.43
Im Gegensatz hierzu ließ die materielle Situation der städtischen Arbeiterfamilien eine Orientierung an einem dieser Leitbilder erst gar nicht zu. Die Not erzwang hier mehrheitlich, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts alle Familienmitglieder arbeiteten - die Arbeit von Männern war zwar besser bezahlt, aber die Familie war auch auf den Lohn von Frauen und Kindern angewiesen. Hier war bereits charakteristisch, dass Frauen - wenn möglich - vor allem in Heimarbeit produzierten, beispielsweise für die protoindustrielle Textilindustrie. Da jedoch trotz dessen der Unterhalt vieler Familien kaum zu bestreiten war, wurde die Haushaltskasse noch durch das Aufnehmen von Untermietern in die Wohnung aufgebessert, sodass auf ein Zimmer einer Wohnung bis zu sechs und mehr Menschen kommen konnten. So entstanden auch Lebensformen wie komplexe und erweiterte Familien, Mehrgenerationenfamilien und ähnliches. Zudem war gerade in kleineren Städten und in Bergbaugebieten der Typus des Arbeiterbauern weit verbreitet, wobei neben der Fabrikarbeit noch an geringem Landbesitz festgehalten wurde, um so noch zusätzlich Subsistenzwirtschaft zu betreiben. Auch hier fällt auf, dass dabei in erster Linie Frauen und Kinder für die Landwirtschaft zuständig waren, die nicht vom Haushalt abgespalten war. Entscheidendes Merkmal all dieser Formen war, dass keine Wohnraumdifferenzierung im bürgerlichen Sinne vorhanden war, sich das komplette Familienleben meist im halböffentlichen Raum bewegte und sich also keine separierte private Sphäre herausbilden konnte.44 Wo dies jedoch möglich war, wurde bereits geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entlang der Grenze Lohnarbeit/Heimarbeit praktiziert.45
Im städtischen Bürgertum hingegen lassen sich im 19. Jahrhundert eindeutige Tendenzen erkennen. Das Gesinde wurde mehr und mehr von der Kernfamilie abgegrenzt, sodass ihm beispielsweise der Zutritt zu den privaten Wohnräumen nur noch auf Verlangen gestattet war und keine Rede mehr von einem Einbeziehen in die Familie sein kann. Die einzelnen Wohnbereiche wurden nach verschiedenen Funktionen differenziert, sodass sich eine private Sphäre überhaupt erst etablieren konnte. Außerdem verlor die subsistenzwirtschaftliche Komponente deutlich an Bedeutung, kleinere Gärten blieben zwar oft noch erhalten, aber Landwirtschaft wurde in der Regel nicht mehr betrieben. Zudem verringerten sich die Kinderzahlen drastisch, sodass die Entdeckung der Kindheit vollzogen werden konnte. Die Produktion wurde vollständig aus dem Haushalt ausgelagert und von der Konsumtion getrennt und eine klare Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre etabliert. Der Ehemann konnte nun seine Ernährerfunktion außerhalb des Hauses erfüllen, während die Ehefrau für die Haushaltsführung und die emotionale Fürsorge und Erziehung der Kinder zuständig war. Letztendlich wurde hier eine Lebensform praktiziert, die relativ genau dem Leitbild der bürgerlichen Familie entsprach.46
Klar wird bei dieser Betrachtung der gesellschaftlichen Realitäten, dass das bevölkerungsmäßig kleine Bürgertum die einzige Gruppe ist, bei der sich eindeutige Trends feststellen lassen. Und diese betreffen genau die geschlechtliche Arbeitsteilung und Sphärentrennung, die sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts sowohl ideell als auch in der Lebenswirklichkeit der breiten Bevölkerung verallgemeinert hatte. Ein möglicher Erklärungsansatz für diese Entwicklung soll im nächsten Kapitel zunächst theoretisch vorgestellt werden.
5. Kulturelle Hegemonie
Der Begriff der kulturellen Hegemonie wird heute in vielfältigen wissenschaftlichen Feldern verwandt, meist ohne klar zu definieren, was genau damit gemeint ist. Die Verwendung des Begriffs geht in erster Linie auf Antonio Gramsci zurück, der damit eine Theorie ausarbeitete, nach der sich Herrschaft nicht nur durch Ausübung von Zwang erhalte, sondern mindestens ebenso sehr durch die Produktion von Konsens. Mit Hegemonie ist als also ein Typus von Herrschaft gemeint, „der im Wesentlichen auf der Fähigkeit basiert, eigene Interessen als gesellschaftliche Allgemeininteressen zu definieren und durchzusetzen. Dies geschieht in der Regel nicht mit offenem
Zwang, sondern über Kompromisse und gesellschaftliche Konsense im Sinne allseits geteilter Auffassungen“.47 Für die Herstellung eines solchen Konsenses kommt bei Gramsci Intellektuellen eine entscheidende Rolle zu, wobei Intellektuelle nicht zwangsläufig im akademischen Sinne zu verstehen sind. Vielmehr macht es Intellektuelle im gramscianischen Sinne aus, dass sie vor allem, aber nicht nur, im kulturellen Bereich zustimmungsfähige Ideen artikulieren und so eine gewisse geistige Führung übernehmen können.48 Das Feld, in dem die Auseinandersetzung um die hegemoniale Macht geführt wird, ist die Zivilgesellschaft. Diese ist bei Gramsci jedoch nicht im heutigen Sinne als vom Staat getrennter Bereich zu verstehen, sondern im Gegenteil eng mit diesem verknüpft. Staat wird bei ihm analytisch getrennt in eine politische Sphäre, in der Herrschaft klassisch über Zwang ausgeübt werde, und die Zivilgesellschaft, in der es um die Herstellung von Konsens gehe.49 So kommt Gramsci zu dem Schluss, dass die Ausübung von längerfristig stabiler Herrschaft immer zwei Ebenen umschließe, die er an den Polen Autorität und Hegemonie, Zwang und Konsens, sowie Gewalt und Kultur festmacht. Dabei hält er fest, dass jedes Verhältnis von Hegemonie immer ein pädagogisches Verhältnis im Sinne wechselseitig aufeinander bezogener Lehrer-Schüler-Positionen sei.50 Mit kultureller Hegemonie soll im Folgenden eine Machtposition bezeichnet werden, die es einer gesellschaftlichen Gruppe erlaubt, ihre Vorstellungen durch Konsensherstellung zu verallgemeinern. Die zentralen vier Felder, in denen sich dies vollzieht sind dabei Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Brigitte Rauschenbach merkt in diesem Sinne an, diese These passe auf kein anderes Phänomen so gut, wie auf das der Geschlechterordnung.51
6. Verteidigung männlicher Privilegien oder Hegemonie des Bürgertums?
Zunächst ist in den vorherigen Ausführungen klar geworden, dass die Durchsetzung der modernen Zweigeschlechtlichkeit eng an die Arbeitsteilung und Sphärentrennung der bürgerlichen Familie geknüpft ist. Karin Hausen zeichnet in ihrem vielzitierten Aufsatz detailliert nach, wie dieses Geschlechtermodell als Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben im Bürgertum entstand und sich im 19. Jahrhundert im Wettstreit verschiedener wissenschaftlicher und literarischer Strömungen durchsetzte. Gleichzeitig zeigte sich bei der Betrachtung der gesellschaftlichen Realitäten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, dass in dieser Zeit ausschließlich das zahlenmäßig kleine deutsche Bürgertum eine Lebensform im Sinne dieses Geschlechtermodells praktizierte. Heinz-Jürgen Voß führt in seiner Dissertation aus, dass es in dieser gesamten Zeitspanne stets gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussionen um Geschlechtergleichheit und -differenz gab und dieses Modell zu keiner Zeit kritiklos angenommen wurde. Doch trotz all dieser Faktoren war dieses so wirkmächtig, dass es es sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Leitbild für die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung verallgemeinert hatte und in Folge dessen spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts zur allgemeinen sozialen Realität geworden war.
An die recht triviale Feststellung, das Bürgertum sei die „soziale[] Formation, die dem 19. Jahrhundert seinen Stempel aufdrückte“52, schließt sich nun soziologisch die interessante Frage an, wie dies mit all seinen weitreichenden Folgen bis heute geschehen konnte. Dabei fällt auf, dass die in der Literatur angedeuteten Erklärungsansätze auf einem merkwürdig instrumentellen Niveau verbleiben.
Hausen beispielsweise bezeichnet die Geschlechtscharaktere als Herrschaftsideologie, die entwickelt und benutzt wurde, um konkrete Emanzipationsforderungen der ersten Frauenbewegung abzuwehren.53 Später führt sie aus, dass anzunehmen sei, dass intensiv versucht worden sei, die Lehre von den Geschlechtscharakteren - als Kern der Vorstellung vom wahren Familienleben - bei den Arbeitern zu popularisieren, da in der Restabilisierung der Familienverhältnisse ein Weg zur Lösung der sozialen Frage gesehen wurde.54 Sie arbeitet klar heraus, wie Bildungspolitik und Bildungswesen einen entscheidenden Anteil an der Ausbildung der Geschlechtscharaktere in der breiten Bevölkerung hatten und interpretiert dies als bewussten Prozess.55 Auch Lenz und Adler bezeichnen es als naheliegend, in dieser Geschlechterordnung ein machtpolitisches Interesse der Männer zu vermuten, da in dessen Komplementarität unauflösbar ein Dominanzanspruch der Männer eingebaut ist und Frauen durch deren Ernährerfunktion in völlige ökonomische Abhängigkeit gerieten.56 Auch Voß legt eine solche Interpretation nahe, wenn er ausführt, dass Wissenschaftler versuchten Geschlechterunterschiede zu beweisen, da es einer stärkeren Legitimation bedurfte, um Frauen weiterhin politische Rechte zu verweigern.57 Zwar gibt es Hinweise, dass es solche Motivationen durchaus gab - so beispielsweise, dass männliche Autoren oftmals dazu neigten, gerade ihre eigenen Arbeitsfelder besonders vehement gegen die Öffnung für Frauen zu verteidigen58 -, allerdings lassen die Reichweite und Nachhaltigkeit dieser Verallgemeinerung für einen gesamten Kulturkreis angesichts der Komplexität moderner Gesellschaften eine bewusste Planung als Hauptursache für den durchschlagenden Erfolg dieses Modells als unwahrscheinlich erscheinen. Auch zahlreiche gegenläufige Beispiele stellen dies in Frage. So mischten sich im 19. Jahrhundert durchaus auch Frauen mit antifeministischen Beiträgen in die Debatte ein, um die Frau als aufopferungsvolle Ehefrau und Mutter zu idealisieren.59 Auch dass die literarischen Epochen von Empfindsamkeit, Romantik und Klassik einen entscheidenden Anteil an der Verallgemeinerung der Geschlechtscharaktere hatten, denen wohl kaum eine bewusste Abwertung der Frau vorgeworfen werden kann, spricht gegen diese Interpretation.60
Im Gegenteil kann davon ausgegangen werden, dass sich die Geschlechtscharaktere, aufbauend auf den vormodernen patriarchalen Geschlechterverhältnissen, mit Aufkommen der modernen kapitalistischen Gesellschaftsformation sozusagen hinter dem Rücken des Bürgertums in diesem herausbildeten. Erst in Folge deren Entstehung entwickelte sich daraufhin eine entsprechende Interpretation von Geschlecht. Mit Marx könnte in diesem Sinne von der Ausbildung einer Geschlechterideologie als notwendig falsches Bewusstsein gesprochen werden. Durch die Konstituierung einer privaten und einer abgetrennten öffentlichen Sphäre, durch die geschlechtliche Arbeitsteilung entlang dieser und unterschiedliche Sexualnormen für Männer und Frauen des Bürgertums wurden die realen geschlechtlichen Unterschiede produziert, anhand derer anschließend wissenschaftlich die natürlichen und wesenhaften Unterschiede von Mann und Frau nachgewiesen werden konnten. Hier kommt nun der Begriff der kulturellen Hegemonie zum Tragen. Begonnen hat der Siegeszug dieses Geschlechtsmodells in der Wissenschaft, die bis ins 20. Jahrhundert hinein ausschließlich privilegierten Bevölkerungsgruppen offen stand. Dies bedeutete im 18. Jahrhundert noch Adel und Bürgertum, seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Bürgertum jedoch zunehmend dominanter. Frevert beschreibt, wie genau in dieser Zeit das bipolare Geschlechtermodell in Philosophie, Literatur und Medizin zunehmend Verbreitung findet.61 Gleichzeitig sorgen billigere Druckverfahren seit dem 18. Jahrhundert für eine weitere Verbreitung von Druckerzeugnissen. Diese prägte aber das Bürgertum in der Gesamtheit grundlegend, da genau das die lesende und schreibende Schicht in dieser Zeit war. Als Ursache der Hegemonie des Bürgertums in Wissenschaften und Literatur kann der erhöhte Bildungsbedarf in dieser Schicht seit dem 18. Jahrhundert angesehen werden, zumal in Deutschland, wo ihr der gesellschaftliche Aufstieg als Dienstklasse des Absolutismus im 18. Jahrhundert gelang und damit Bildung den einzig sicheren Garanten für den Status der Nachkommen darstellte. Außerdem war hier überhaupt erst für eine ausreichende materielle Sicherheit gesorgt, um sich dem Lesen und Schreiben widmen zu können. Diese durch das Bürgertum geprägte Wissenschaft war es aber, die die Grundlage des sich im 19. Jahrhundert ausbreitenden Bildungswesens darstellte. Einerseits wurde dabei geschlechtergetrennt gelehrt, um die Jungen und Mädchen auf ihre spätere von der Natur vorgegebene Rolle vorzubereiten, andererseits waren genau diese natürlichen Unterschiede auch Teil der Lehre. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde durch die zunehmende Verbreitung von Schulen auch der Alphabetisierungsgrad der einfachen Bevölkerung zunehmend erhöht. Die Literatur, die nun zum Lesen zur Verfügung stand, war aber genau die, die vorher von bürgerlichen Kreisen in Spiegelung ihrer Lebenswirklichkeit produziert worden war. So konnte in enger Verbindung von Ökonomie (Abspaltung von Produktion und Reproduktion), Wissenschaft, Bildung(spolitik) und Kultur durch die hegemoniale Stellung des Bürgertums die bürgerliche Familie und das mit ihr verbundene bipolare Geschlechtermodell im Laufe des 19. Jahrhunderts ohne eine bewusste Planung so weit verallgemeinert werden, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts bereits ideell allgemeine Gültigkeit besaß. In Folge der materiellen Verbesserungen bei den Arbeiter_innen im Deutschland der Nachkriegszeit konnte dieses Leitbild dann auch in die materielle Realität übertragen werden.
7. Fazit
Zum Schluss soll noch auf einige sich aus diesen Darstellungen ergebende Fragen hingewiesen werden. Zunächst waren die vorherigen Ausführungen sehr schematisch gehalten, um diese historisch zu bestätigen müsste sich noch wesentlich tiefer mit der empirische Datenlage dieser Zeit beschäftigt werden. Bei der näheren Beleuchtung stark schematisierender Theorien stellte sich heraus, dass diese angesichts historischer Realitäten meist zumindest noch modifiziert werden müssen. Beispielsweise könnte anhand von Quellen der Frage nachgegangen werden, wie sich die hegemoniale Stellung des Bürgertums konkret ausgestaltete und sich seit dem späten 18. Jahrhundert entwickelte. Eine in dieser Arbeit fast vollständig ausgeblendete Frage ist die nach der Rolle der Religion in dem beschriebenen Prozess. Vor allem der Blick auf protestantisch und katholisch geprägte Regionen könnte hier noch aufschlussreich sein. Eine wichtige Schlussfolgerung jedoch ist die enge Verwobenheit des modernen Geschlechtermodells mit der bürgerlichen Gesellschaft. Damit ist die Frage aufgeworfen, wie wirkmächtig beispielsweise Queer Theorie und Queer Politics, beziehungsweise auch feministische Interventionen im Allgemeinen innerhalb dieser Gesellschaftsformation überhaupt werden können. Roswitha Scholz legte beispielsweise mit dem Wertabspaltungtheorem in Anlehnung an Marx eine Analyse vor, mit der sie die meisten feministischen Emanzipationsbestrebungungen als am Kern der sexistischen Grundlage dieser Gesellschaft vorbeigehend kritisiert. Dabei erweitert sie die marxsche Analyse von Wertform, Warenfetisch und -subjektivität um die Dimension Geschlecht. Sie stellt dar, wie die Entstehung der - scheinbar geschlechtsneutralen - männlichen abstrakten Arbeit und der damit verbundenen Abspaltung aller nicht in der Wertform aufgehenden Arbeiten und deren Delegation an das Weibliche eine unauflösliche Grundlage dieser Gesellschaft sei, die von allen Gesellschaftskritiker_innen bisher übersehen worden sei und schlussfolgert daraus, dass eine umfassende Emanzipation der Frau nur im Zuge der Aufhebung dieser zu haben sei.62 Ob dies so haltbar ist, wird die Zukunft zeigen; herauszufinden, wie die Verknüpfung zwischen moderner Gesellschaft und Geschlechterverhältnis im Einzelnen aussieht, ist Aufgabe soziologischer und geschichtswissenschaftlicher Forschung.
8. Literaturverzeichnis
Bovenschen, Silvia (1979): Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische
Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Brand, Ulrich/Scherrer, Christoph (2003): Contested Global Governance:
Konkurrierende Formen und Inhalte globaler Regulierung. In: Kurswechsel.
Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen . Heft 1/2003, S. 90-103.
Online unter: www.renner-institut.at/download/texte/brand_scherrer.pdf [Stand: 30.03.2012].
Frevert, Ute (1995): „Mann und Weib und Weib und Mann“. GeschlechterDifferenzen in der Moderne. München: C.H. Beck.
Fuhs, Burkhard (2007): Zur Geschichte der Familie. In: Ecarius, Jutta (Hrsg.): Handbuch Familie. Wiesbaden: VS, S. 17-35.
Gestrich, Andreas (1999): Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg.
Gramsci, Antonio (1991): Gefängnishefte 1. Heft 1. Hamburg: Argument.
Gramsci, Antonio (1992): Gefängnishefte 4. 6. und 7. Heft. Hamburg: Argument.
Gramsci, Antonio (1994): Gefängnishefte 6. Philosophie der Praxis. 10. und 11. Heft. Hamburg: Argument.
Hausen, Karin (1976): Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ - Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- uns Familienleben. In: Conze, Werner (Hrsg.): Sozialgeschichte in der Neuzeit Europas. Stuttgart: Ernst Klett, S. 363-401.
Honegger, Claudia (1991): Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib. 1750 - 1850. Frankfurt am Main: Campus.
Huinink, Johannes/Konietzka, Dirk (2007): Familiensoziologie. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Campus.
Klinger, Cornelia (2000): Die Ordnung der Geschlechter und die Ambivalenz der Moderne.
Online unter: www.uni-tuebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/ PhiloGeschichte/Dokumente/Downloads/ver%C3%B6ffentlichungen/klinger- modpol.pdf [Stand: 30.03.2012].
Laqueur, Thomas: (1992): Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud. Frankfurt am Main/New York: Campus.
Lenz, Karl/Adler, Marina (2010): Geschlecherverhältnisse. Einführung in die sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung. Band 1. Weinheim/München: Juventa.
Lenz, Karl/Adler, Marina (2011): Geschlechterbeziehungen. Einführung in die sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung. Band 2. Weinheim/München: Juventa.
Lenz, Karl/Böhnsch Lothar (1997): Zugänge zu Familien - ein Grundlagentext. In: Lenz, Karl/Böhnsch Lothar (Hrsg.): Familien. Eine interdisziplinäre Einführung. Weinheim/München: Juventa, S. 9-63.
Lüscher, Kurt (1997): Familienrhetorik, Familienwirklichkeit und Familienforschung. In: Vascovics, Laszlo A. (Hrsg.): Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen: Leske und Budrich, S. 50-67.
Meuser, Michael (2001): „Ganze Kerle“, „Anti-Helden“ und andere Typen. Zum Männlichkeitsdiskurs in neuen Männerzeitschriften. In Döge, Peter/Meuser, Michael (Hrsg.): Männlichkeit und soziale Ordnung. Neuere Beiträge zur Geschlechterforschung. Opladen: Leske und Budrich, S. 219-236.
Nave-Herz, Rosemarie (1997): Pluralisierung familialer Lebensformen - ein Konstrukt der Wissenschaft? In: Vascovics, Laszlo A. (Hrsg.): Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen: Leske und Budrich, S. 36-49.
Rauschenbach, Brigitte (2005): Kulturelle Hegemonie und Geschlecht als Herausforderung im europäischen Einigungsprozess - eine Einführung. Online unter: http://web.fu-berlin.de/gpo/KulturelleHegemonieRauschen.htm [Stand: 30.03.2012].
Scholz, Roswitha (1992): Der Wert ist der Mann. Thesen zu Wertvergesellschaftung und Geschlechterverhältnis. In: Redaktion Krisis (Hrsg.): Krisis. Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft 12. Bad Honnef: Horlemann, S. 19-52.
Online unter: http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=schwerpunkte&index=3 &posnr=20&backtext1=text1.php [Stand: 30.03.2012].
Schnell, Rüdiger (2002): Sexualität und Emotionalität in der vormodernen Ehe. Köln/Weimar/Wien: Böhlau.
Voß, Heinz-Jürgen (2010): Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Bielefeld: Transcript.
Voß, Heinz-Jürgen (2011): Geschlecht. Wider die Natürlichkeit. Stuttgart: Schmetterling.
[...]
1 Mit Westen ist hier vor allem der geographische Raum Westeuropa und Nordamerika gemeint, dem gemeinsam ist, dass er kulturell seit dem 15. Jahrhundert zentral durch Renaissance, Reformation und Aufklärung geprägt wurde und sich in deren Tradition sieht.
2 Vgl. Meuser (2001), S. 221.
3 In dieser Arbeit wird für eine geschlechtsneutrale Schreibweise das Gender_Gap verwendet. Im Gegensatz zum Binnen-I sollen dabei nicht nur Frauen und Männer sprachlich sichtbar gemacht werden, sondern der Zwischenraum soll ein Hinweis sein auf Menschen, die nicht in die Kategorien der Zweigeschlechtlichkeit passen, wie beispielsweise Inter- oder Transsexuelle.
4 Vgl. beispielhaft Lenz/Adler (2010), S. 81ff.
5 Laqueur (1992 [englische Erstauflage 1990]) und Honegger (1991).
6 Lenz/Adler (2010), S. 81.
7 Vgl. Voß (2011), S. 70.
8 Vgl. ebd., S. 71ff. Die Beschreibung der weiblichen Keimzelle als Eizelle setzte sich ebenso erst im
späten 18. Jahrhundert durch.
9 Vgl. Lenz/Adler (2010), S. 82.
10 Vgl. Voß (2010), S. 85f.
11 Vgl. ebd., S. 82f.
12 Vgl. Honegger(1991), S. 179ff.
13 Vgl. Voß (2011), S. 79ff.
14 Vgl. Hausen (1976), S. 369.
15 Vgl. ebd., S. 368.
16 Vgl. Frevert (1995), S. 54.
17 Vgl. ebd., S. 18ff.
18 Vgl. ebd., S. 25ff.
19 Vgl. ebd., S. 37ff.
20 Vgl. ebd., S. 51f.
21 Vgl. Hausen (1976), S. 366ff.
22 Vgl. Voß (2010).
23 Vgl. ebd., S. 12, 81ff.
24 Vgl. ebd., S. 91, 131ff.
25 Vgl. ebd., S. 92ff, 232ff.
26 Klinger (2000), S. 38.
27 Vgl. Voß (2010), S. 31f.
28 Vgl. beispielsweise ebd., S. 120f, 167f.
29 Vgl. Schnell (2002), S. 71f.
30 Vgl. Voß (2010), S. 123ff.
31 Vgl. Nave-Herz (1997), S. 37f.
32 Vgl. Lenz/Böhnsch (1997), S. 11.
33 Lenz/Adler (2011), S. 146.
34 Vgl. Gestrich (1999), S. 4.
35 Vgl. Lüscher (1997), S. 65f.
36 Vgl. Fuhs (2007), 18ff.
37 Vgl. Huinink/Konietzka (2007), S. 60.
38 Vgl. zum gesamten Absatz Lenz/Adler (2010), S. 84f, sowie Huinink/Konietzka (2007), S. 63f.
39 Vgl. zu diesem Kapitel Frevert (1995), S. 143ff; Fuhs (2007), S. 20; Gestrich (1999), S. 6; Hausen (1976), S. 377ff; Huinink/Konietzka (2007), S. 67; Lenz/Adler (2010), S. 85ff, sowie Lüscher (1997), S. 61.
40 Zu nennen wäre hier an prominenter Stelle beispielsweise Bovenschen (1979).
41 Vgl. Fuhs (2007), S. 29.
42 Vgl. Gestrich (1999), S. 11ff, 25ff.
43 Vgl. ebd., S. 13ff.
44 Vgl. Huinink/Konietzka (2007), S. 69f.
45 Vgl. Gestrich (1999), S. 15ff, 22ff.
46 Vgl. ebd., S. 17ff.
47 Brand/Scherer (2003), S. 92.
48 Vgl. beispielhaft Gramsci (1991), S. 101f.
49 Vgl. Gramsci (1992), S. 772f, 783.
50 Vgl. Gramsci (1994), S. 335f.
51 Rauschenbach (2005), S. 4.
52 Frevert (1995), S. 11.
53 Vgl. Hausen (1976), S. 376f.
54 Vgl. ebd., S. 383.
55 Vgl. ebd., S. 387ff.
56 Vgl. Lenz/Adler (2010), S. 90f.
57 Vgl. Voß (2010), S. 168.
58 Vgl. ebd., S. 175f.
59 Vgl. ebd., S. 180.
60 Vgl. Hausen (1976), 372f.
61 Vgl. Frevert (1995), S. 55.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ein-Geschlechter-Modell und wie unterscheidet es sich vom Zwei-Geschlechter-Modell?
Das Ein-Geschlechter-Modell, das in Europa von der Antike bis ins 18. Jahrhundert vorherrschte, betrachtete Mann und Frau als unterschiedliche Ausprägungen desselben anatomischen Geschlechts. Unterschiede wurden relational in Kategorien von "mehr oder weniger" beschrieben, wobei der Mann als die vollkommene Form galt. Das Zwei-Geschlechter-Modell, das sich ab dem 18. Jahrhundert entwickelte, basiert auf biologisch-anatomischen Unterschieden als grundlegender Unterscheidungskategorie und betont die Differenz zwischen Mann und Frau.
Was ist das "ganze Haus" und die "bürgerliche Familie" als familiale Leitbilder?
Das "ganze Haus" war das dominante familiale Leitbild der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert, gekennzeichnet durch eine Einheit von Produktion, Konsumtion, Wohnen und Leben. Es war in erster Linie eine funktionierende Arbeitseinheit, in der alle Mitglieder, einschließlich Gesinde, zum Haus gehörten. Die "bürgerliche Familie" hingegen konstituiert eine abgeschlossene private Sphäre, getrennt von der öffentlichen Sphäre. Die Produktion wird ausgelagert, und die Frau ist für reproduktive und emotional-fürsorgerische Arbeiten zuständig, während der Mann als Ernährer fungiert.
Welche gesellschaftlichen Realitäten prägten die Familienformen im 19. Jahrhundert?
Die Familienformen im 19. Jahrhundert waren äußerst vielfältig und regional unterschiedlich. Die Landbevölkerung, das städtische Handwerk, die städtische Arbeiterschaft und das städtische Bürgertum entwickelten unterschiedliche Lebensformen. Das bevölkerungsmäßig kleine Bürgertum war die einzige Gruppe, bei der sich eindeutige Trends in Bezug auf geschlechtliche Arbeitsteilung und Sphärentrennung feststellen ließen.
Was bedeutet "kulturelle Hegemonie" im Kontext der Geschlechterordnung?
"Kulturelle Hegemonie", basierend auf den Theorien von Antonio Gramsci, bezeichnet eine Machtposition, die es einer gesellschaftlichen Gruppe erlaubt, ihre Vorstellungen durch Konsensherstellung zu verallgemeinern. Im Kontext der Geschlechterordnung bezieht es sich auf die Fähigkeit einer Gruppe (hier das Bürgertum), ihre Geschlechtervorstellungen als gesellschaftliche Normen durchzusetzen, nicht nur durch Zwang, sondern durch die Produktion von Konsens.
Wie konnte sich das moderne Zwei-Geschlechter-Modell im 19. Jahrhundert durchsetzen, obwohl es nicht der Lebensrealität der Mehrheit entsprach?
Das Bürgertum, als die gesellschaftlich prägende Kraft des 19. Jahrhunderts, übte kulturelle Hegemonie aus. Durch Wissenschaft, Bildung und Medien wurden bürgerliche Geschlechtervorstellungen, die eng mit der bürgerlichen Familie verbunden waren, verallgemeinert und als natürliche und wünschenswerte Normen dargestellt. Diese Vorstellungen sickerten in die breite Bevölkerung ein und wurden schließlich, durch materielle Verbesserungen, in die Lebensrealität übertragen.
Welche Rolle spielten Wissenschaft, Bildung und Medien bei der Durchsetzung des modernen Geschlechtermodells?
Wissenschaft und Bildung spielten eine zentrale Rolle. Die Wissenschaft entwickelte und legitimierte die Geschlechtscharaktere, während das Bildungswesen, oft geschlechtergetrennt, diese Vorstellungen an die Bevölkerung vermittelte. Medien wie Lexika und Literatur verbreiteten die Geschlechtercharaktere zusätzlich und trugen zur Verallgemeinerung des modernen Geschlechtermodells bei.
Was sind die wichtigsten Kritikpunkte am Konzept eines klaren Bruchs zwischen vormodernen und modernen Geschlechtermodellen?
Kritiker argumentieren, dass es bereits in der Antike und im Mittelalter Debatten über Geschlechterunterschiede und -gleichheit gab und dass die Geschlechterordnung der Moderne auf bereits vorhandenen hierarchischen Strukturen aufbaute. Außerdem wird betont, dass Texte, die eine grundlegende Ungleichartigkeit von Mann und Frau behaupten, weder in den biologisch-medizinischen Wissenschaften dominant waren, noch breitere gesellschaftliche Unterstützung fanden.
- Citation du texte
- Jan Ackermann (Auteur), 2012, Die Durchsetzung der modernen Zweigeschlechtlichkeit als Folge kultureller Hegemonie des Bürgertums im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200400