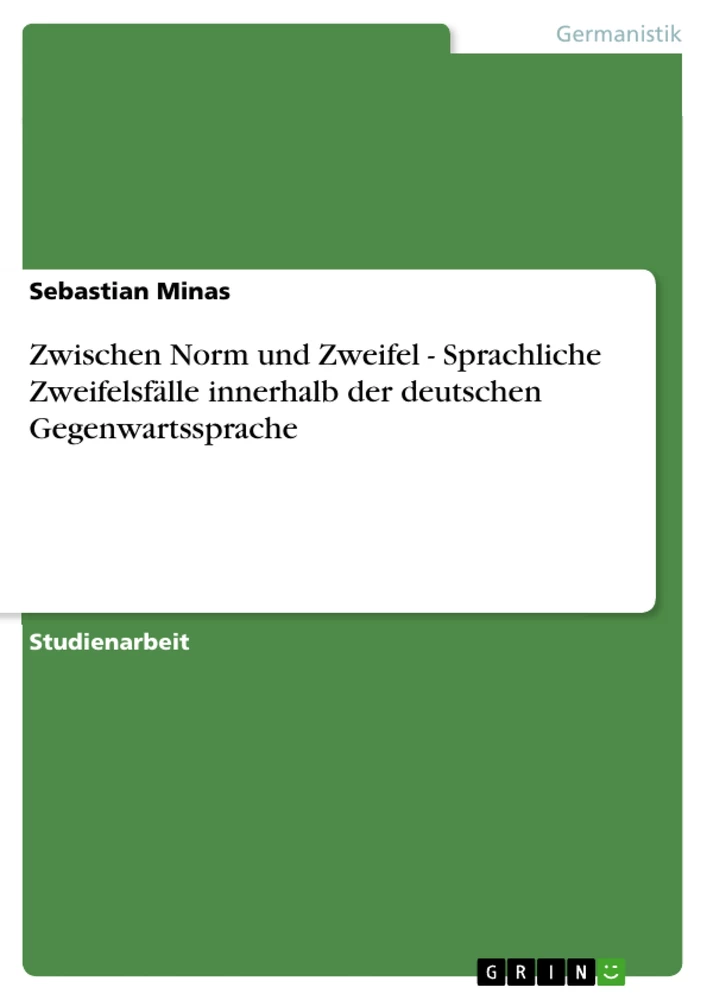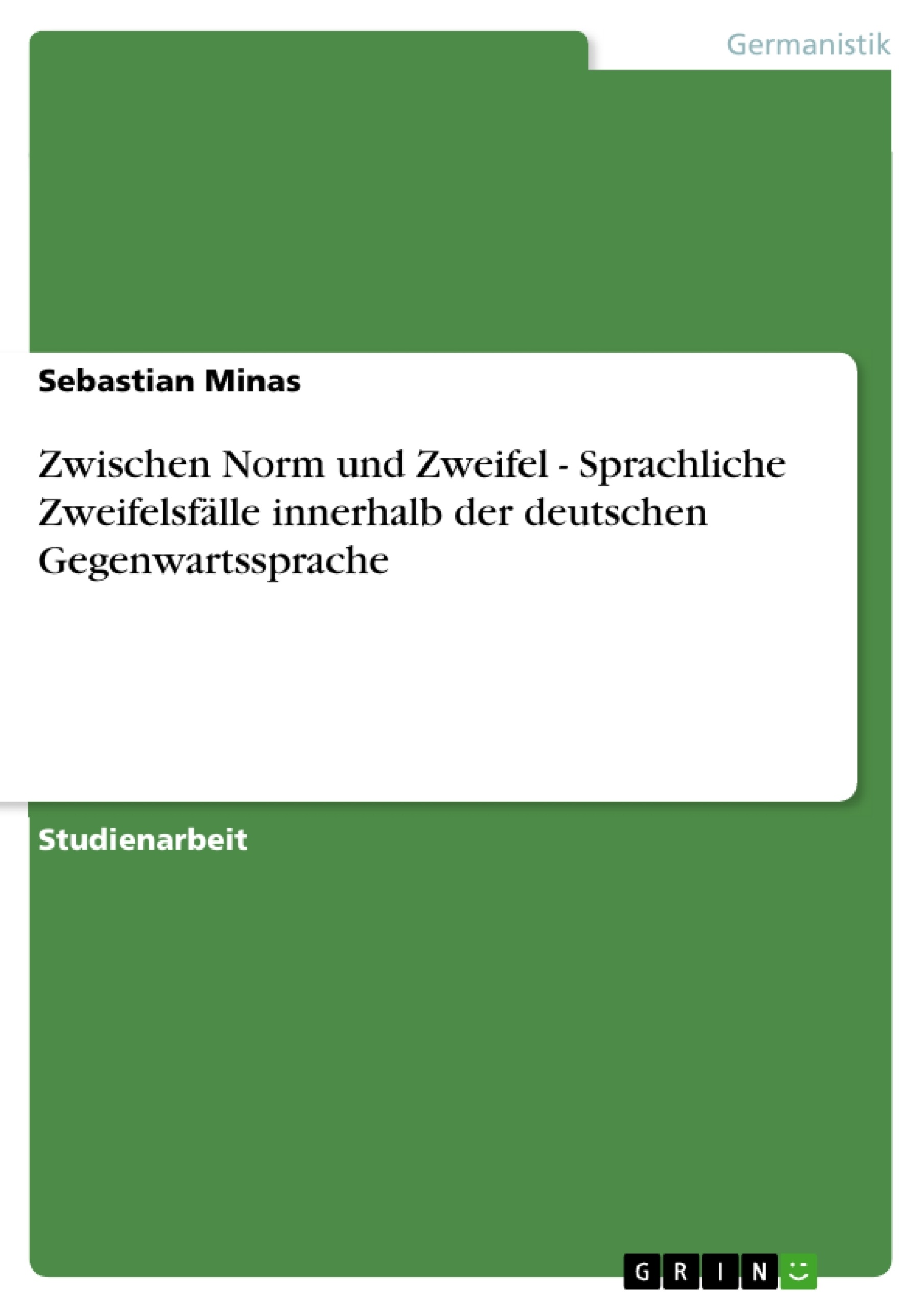Das Phänomen sprachlicher Zweifelsfälle ist allgegenwärtig. Ständig kommt man als Sprachproduzent und -rezipient in Situationen, in denen man sich nicht für eine jener möglichen Varianten entscheiden kann, die unsere Sprache prägen. Diese Arbeit ist ein Versuch, dieses gesellschaftlich so relevante Phänomen in eine sprachwissenschaftliche Dimension zu überführen, in der generell die Tendenz besteht, Zweifelsfälle aus Gründen theoretischer Abstraktion auszublenden. Dies hat Gründe, die auf eine Kluft zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und Sprachwissenschaft zurückgehen und die auf unterschiedlichen Normsystemen beruhen. Die vorliegende Arbeit widmet sich daher vor allem der Frage, inwiefern sprachliche Zweifelsfälle Herausforderungen für Sprachwissenschaft, Sprachnormierung und Sprachberatung darstellen und welche Perspektiven sich daraus für die Behandlung sprachlicher Zweifelsfälle ergeben. Darüber hinaus gilt es zu klären, weshalb sprachliche Zweifelsfälle innerhalb der Sprachwissen-schaft tendenziell eher marginalisiert und als randständige Objekte betrachtet worden sind und inwiefern dies falsch ist. Überdies gilt es zu analysieren, welche Rolle letztlich Institutionen wie Sprachberatungen sowohl bei der Klärung als auch der Etablierung dieser Zweifelsfälle im öffentlichen Sprachbewusstsein spielen.
Im Folgenden wird zunächst auf die theoretische Fundierung sprachlicher Zweifelsfälle eingegangen, um zu klären, inwiefern sich System und Norm innerhalb der Sprachwissenschaft verhalten und wie sich daraus eine Sprachnorm definiert. Dies ist wichtig, um das Normierungsbestreben der Sprachöffentlichkeit, aber auch Normierungsprozesse durch die Sprachwissenschaft anschaulich darzustellen. Der Theorieteil beinhaltet auch eine Geschichte des Begriffs ‚sprachlicher Zweifelsfälle’, um sie definieren und klassifizieren zu können. Das letzte Kapitel dieser Arbeit widmet sich schließlich der Kernfrage, inwiefern die Zweifelsfallproblematik im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch fassbar wird und wie sich das öffentliche Sprachbewusstsein gegenüber dem linguistischen Normierungsbestreben verhält. Aus solchen Diskursen ergeben sich letztlich institutionelle Konsequenzen in Form von Sprachberatungen, um das Bemühen der Sprachwissenschaft zu verdeutlichen, „sprachliches Verhalten aus dem bipolaren Spannungsfeld von ‚richtig’ und ‚falsch’ herauszuführen“ (Wermke 2007, 361).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zweifelsfalltheorie innerhalb der Sprachwissenschaft und der Sprachnormierung
- Das Verhältnis zwischen System und Norm in der Sprachwissenschaft
- Begriffsgeschichte und Terminologie
- Klassifikation und Identifikation
- Sprachliche Zweifelsfälle innerhalb der deutschen Gegenwartssprache
- Zweifelsfälle zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und Sprachwissenschaft
- Sprachliche Normierungsprozesse und Klärung sprachlicher Zweifelsfälle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen sprachlicher Zweifelsfälle in der deutschen Gegenwartssprache. Ziel ist es, dieses Phänomen in eine sprachwissenschaftliche Perspektive zu rücken und die Kluft zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und linguistischer Betrachtungsweise zu analysieren. Die Rolle von Sprachnormierung und -beratung bei der Klärung und Etablierung von Zweifelsfällen wird ebenfalls beleuchtet.
- Das Verhältnis zwischen Sprachsystem und Sprachnorm
- Die Begriffsgeschichte und Klassifizierung sprachlicher Zweifelsfälle
- Der Unterschied zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und sprachwissenschaftlicher Normierung
- Die Rolle von Sprachberatungen bei der Klärung von Zweifelsfällen
- Die Marginalisierung von Zweifelsfällen in der Sprachwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik sprachlicher Zweifelsfälle ein und beschreibt deren Relevanz für Sprachproduktion und -rezeption. Sie betont die Notwendigkeit, dieses gesellschaftlich bedeutsame Phänomen sprachwissenschaftlich zu untersuchen, da es in der Linguistik oft aufgrund theoretischer Abstraktion ausgeblendet wird. Die Arbeit widmet sich der Frage, wie sprachliche Zweifelsfälle Sprachwissenschaft, -normierung und -beratung herausfordern und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Sie untersucht die Marginalisierung von Zweifelsfällen in der Sprachwissenschaft und die Rolle von Institutionen wie Sprachberatungen.
2. Die Zweifelsfalltheorie innerhalb der Sprachwissenschaft und der Sprachnormierung: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretische Fundierung sprachlicher Zweifelsfälle. Es untersucht das Verhältnis zwischen Sprachsystem und -norm in der Sprachwissenschaft, erläutert die Begriffsgeschichte und Terminologie von sprachlichen Zweifelsfällen, und analysiert die Klassifizierung und Identifizierung solcher Fälle. Der Fokus liegt auf der Darstellung, wie Normen entstehen und funktionieren, im Kontext von Sprachgebrauch und -verhalten.
3. Sprachliche Zweifelsfälle innerhalb der deutschen Gegenwartssprache: Dieses Kapitel widmet sich der Kernfrage, wie sich die Problematik sprachlicher Zweifelsfälle im aktuellen deutschen Sprachgebrauch manifestiert. Es untersucht den Unterschied zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und linguistischen Normierungsbestrebungen, sowie die sprachlichen Normierungsprozesse und die Klärung sprachlicher Zweifelsfälle. Die Analyse zeigt auf, wie sich der Diskurs um Zweifelsfälle auf institutioneller Ebene (Sprachberatung) niederschlägt.
Schlüsselwörter
Sprachliche Zweifelsfälle, Sprachnorm, Sprachsystem, Sprachnormierung, Sprachberatung, öffentliches Sprachbewusstsein, Sprachwissenschaft, deutsche Gegenwartssprache, Normverstoß, Varietäten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Zweifelsfälle in der deutschen Gegenwartssprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen sprachlicher Zweifelsfälle in der deutschen Gegenwartssprache. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und sprachwissenschaftlicher Perspektive und beleuchtet die Rolle von Sprachnormierung und -beratung bei der Klärung solcher Fälle.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, sprachliche Zweifelsfälle in einen sprachwissenschaftlichen Kontext einzubetten und die Kluft zwischen öffentlichem Sprachverständnis und linguistischer Betrachtungsweise zu analysieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Rolle von Sprachnormierung und -beratung bei der Klärung und Etablierung von Zweifelsfällen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Verhältnis zwischen Sprachsystem und Sprachnorm, die Begriffsgeschichte und Klassifizierung sprachlicher Zweifelsfälle, den Unterschied zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und sprachwissenschaftlicher Normierung, die Rolle von Sprachberatungen bei der Klärung von Zweifelsfällen und die Marginalisierung von Zweifelsfällen in der Sprachwissenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Zweifelsfalltheorie innerhalb der Sprachwissenschaft und der Sprachnormierung, ein Kapitel zu sprachlichen Zweifelsfällen in der deutschen Gegenwartssprache und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz sprachlicher Zweifelsfälle. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretische Fundierung, während das dritte Kapitel die Manifestation der Problematik im aktuellen Sprachgebrauch untersucht.
Was wird im Kapitel zur Zweifelsfalltheorie behandelt?
Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis zwischen Sprachsystem und -norm, erläutert die Begriffsgeschichte und Terminologie von sprachlichen Zweifelsfällen und analysiert deren Klassifizierung und Identifizierung. Es konzentriert sich auf die Entstehung und Funktionsweise von Normen im Kontext von Sprachgebrauch und -verhalten.
Was wird im Kapitel zu sprachlichen Zweifelsfällen in der deutschen Gegenwartssprache behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Problematik sprachlicher Zweifelsfälle im aktuellen deutschen Sprachgebrauch. Es untersucht den Unterschied zwischen öffentlichem Sprachbewusstsein und linguistischen Normierungsbestrebungen sowie die sprachlichen Normierungsprozesse und die Klärung sprachlicher Zweifelsfälle. Die Rolle von Sprachberatungen wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Zweifelsfälle, Sprachnorm, Sprachsystem, Sprachnormierung, Sprachberatung, öffentliches Sprachbewusstsein, Sprachwissenschaft, deutsche Gegenwartssprache, Normverstoß, Varietäten.
Welche Bedeutung haben sprachliche Zweifelsfälle?
Sprachliche Zweifelsfälle sind gesellschaftlich relevant, da sie die Sprachproduktion und -rezeption beeinflussen. Ihre Untersuchung ist wichtig, um die Interaktion zwischen Sprachsystem, Sprachnorm und öffentlichem Sprachbewusstsein besser zu verstehen.
Wie werden sprachliche Zweifelsfälle in der Sprachwissenschaft behandelt?
Die Arbeit zeigt auf, dass sprachliche Zweifelsfälle in der Sprachwissenschaft oft aufgrund theoretischer Abstraktion marginalisiert werden. Die Arbeit untersucht diese Marginalisierung und die Rolle von Institutionen wie Sprachberatungen bei der Klärung von Zweifelsfällen.
- Citar trabajo
- Sebastian Minas (Autor), 2012, Zwischen Norm und Zweifel - Sprachliche Zweifelsfälle innerhalb der deutschen Gegenwartssprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200022