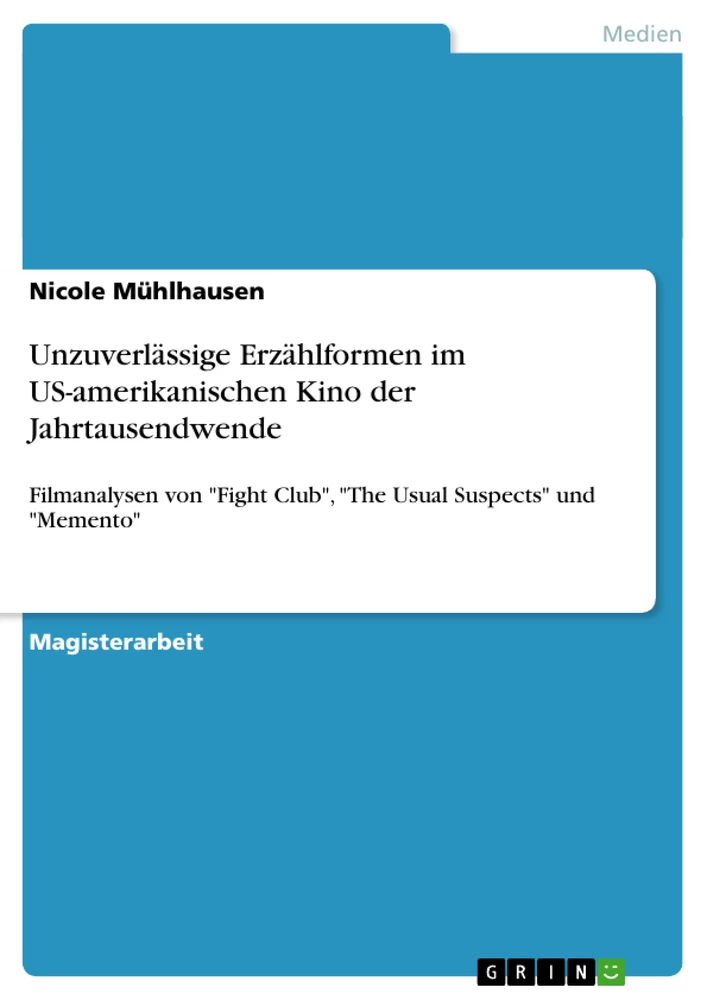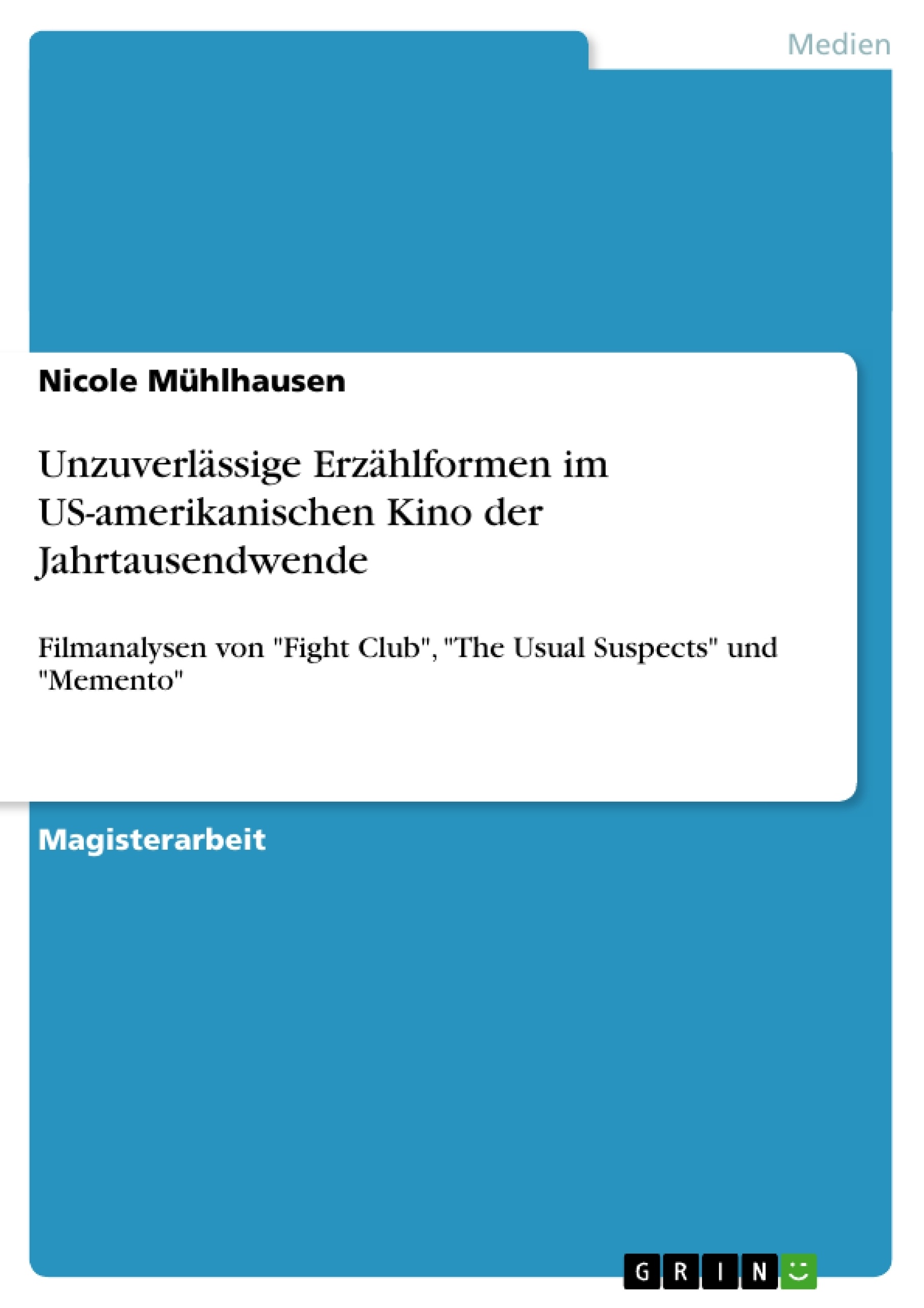Das Phänomen des unreliable narrators / unzuverlässigen Erzählers selbst ist kein Novum in der Filmgeschichte und lässt sich bis in die Stummfilmzeit zurückverfolgen . Nur handelte es sich dabei um verein-zelte Sonderfälle. Die empörten Publikumsreaktionen auf Hitchcocks Film STAGE FRIGHT (USA 1950) , in der eine Lüge des Protagonisten in Bildern manifestiert wurde, belegen das Vertrauen des Zuschauers in das Bild als ein objektives und authentisches Abbildungsmedium. Unter diesem filmgeschichtlichen Blickwinkel stellt diese auffällige Häufung von Filmen mit einem unzuverlässigen Erzähler zwischen 1995 und 2001 ein Novum dar und weckte mein Forschungsinteresse. Warum werden diese so unkonventionell und komplex erzählten Filme mit dem eher abwertenden Begriff „unzuverlässig“ erzählt eingestuft? Gerade das unbemerkte „Belügen“ und „Täuschen“ des Rezipienten verlangt eine hohe Intelligenz und Kunstfertigkeit im Fabulieren.
Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Filme ist, dass die unzuverlässige Erzählperspektive nicht nur der Hervorhebung erzählerischer Finesse dient, sondern in den meisten Fällen kongeniales Ausdrucksmittel der Identitätskrise der überwiegend männlichen Hauptfiguren ist. Das Subjekt selbst ist „unzuverlässig“ und auf der Suche nach dem eigenen „Ich“. Die Fremdtäuschung des Rezipienten gründet sich auf der Selbsttäuschung des Protagonisten, die den Rezipienten zugleich zum kritischen Hinterfragen der eigenen Wahrnehmung auffordert. Dies führt zu einem nächsten lohnenswerten Untersuchungsgegenstand dieser Filme: dem Status der Bilder. Büßen die Bilder ihre Qualität als evidentes, objektives Abbildungsmedium vollends ein und werden nach Jean Baudrillards Theorie zu Simulakren, die auf keine Realität mehr verweisen, sondern in ständiger Zirkulation eine „Hyperrealität“ kreieren (Vgl. Baudrillard 1972, zitiert nach Prümm, 1996)?
Da eine Analyse aller Filme dieser Welle den Umfang meiner Arbeit
übersteigen würde, habe ich den Filmkorpus auf die folgenden drei Filme eingegrenzt:
• FIGHT CLUB,
• THE USUAL SUSPECTS und
• MEMENTO.
Das Ziel meiner filmanalytischen Arbeit ist die Untersuchung der ausgewählten Filme vor der Vergleichsfolie der klassischen Hollywood-Narration hinsichtlich der narrativen Konzeption einer unzuverlässigen Erzählweise, der Identitätsproblematik der Protagonisten und der Bildkonzeption.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
1.2 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
1.3 Ziel der Arbeit
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Überblick über den Forschungsstand
2.1 Der Terminus des unreliable narrators
2.2 Jüngste theoretische Ansätze zur Definition und Analyse von Filmen mit einer unzuverlässigen Erzählperspektive
3 Inhaltsangaben der Filme FIGHT CLUB, THE USUAL SUSPECTS und ME- MENTO
3.1 Inhaltsangabe: FIGHT CLUB
3.2 Inhaltsangabe: THE USUAL SUSPECTS
3.3 Inhaltsangabe: MEMENTO
4 Die klassische Hollywood-Narration als Vergleichsfolie
5 Ordnung, Stimme und Modus der filmischen Erzählung
5.1 Narratologische Terminologie
5.2 Die Voice-over
5.2.1 Die Voice-over in FIGHT CLUB
5.2.2 Die Voice-over in THE USUSAL SUSPECTS
5.2.3 Die Voice-over in MEMENTO
5.3 Zeitstruktur und narrative Ebenen
5.3.1 Zeitstruktur und narrative Ebenen in FIGHT CLUB
5.3.2 Zeitstruktur und narrative Ebenen in THE USUAL SUSPECTS
5.3.3 Zeitstruktur und narrative Ebenen in MEMENTO
5.4 Zusammenfassung des Kapitels „Ordnung, Stimme und Modus der fil- mischen Erzählung“
6 Identitätsproblematik des Protagonisten
6.1 Identitätsproblematik des Protagonisten in MEMENTO
6.2 Identitätsproblematik des Protagonisten in FIGHT CLUB
6.3 Identitätsproblematik des Protagonisten in THE USUAL SUSPECTS
6.4 Zusammenfassung des Kapitels „Identitätsproblematik des Protagonisten“
7 Die Bildkonzeption im Kontext von Markierung und Auflösung der unzuverläs- sigen Erzählperspektive
7.1 Die Bildkonzeption in FIGHT CLUB im Kontext von Markierung und Auf- lösung der unzuverlässigen Erzählperspektive
7.2 Die Bildkonzeption in THE USUAL SUSPECTS im Kontext von Markie- rung und Auflösung der unzuverlässigen Erzählperspektive
7.3 Die Bildkonzeption in MEMENTO im Kontext von Markierung und Auflö- sung der unzuverlässigen Erzählperspektive
7.4 Zusammenfassung des Kapitels „Die Bildkonzeption im Kontext von Markierung und Auflösung der unzuverlässigen Erzählperspektive“
8 Abschließende Zusammenfassung
8.1 Zusammenfassung der Analyseergebnisse
8.2 Vergleich mit der klassischen Hollywood-Narration
8.3 Auslösende Faktoren der Welle von Filmen mit einer unzuver- lässigen Erzählperspektive im US-amerikanischen Kino
8.4 Das Ende der Welle von Filmen mit einer unzuverlässigen Erzählpers- pektive im US-amerikanischen Kino
9 Literaturverzeichnis
9.1 Primärliteratur
9.2 Sekundärliteratur
9.3 Lexika
10 Filmografie
1 Einleitung
Denn das Ziel des Lügners ist einfach, zu bezaubern, zu entzücken und Vergnügen zu bereiten. Er ist das eigentliche Ferment der zivilisierten Gesellschaft[ … ].
(Wilde 1889, 410)
So what is real and what is not? And who am I? Am I this, or am I that?
(Swift 1992, 90)
1.1 Einführung in das Thema
THE USUAL SUSPECTS aus dem Jahr 1995 setzte das Startsignal für den Beginn einer Welle von US-amerikanischen Filmen, die um die Jahr- tausendwende ihren Höhepunkt erreichte. Diese Filme hatten sich der Lüge und Täuschung verschrieben, die sowohl eine Wirkung nach au- ßen, auf das Publikum, als auch nach innen, auf ihre Protagonisten, aus- übte. So wurde das Publikum in Verwirrung, Faszination, Empörung und/oder Überraschung versetzt, wenn sich die zunächst suggerierten und visualisierten Tatbestände spätestens am Ende des Films als „falsch“ erwiesen. Die Protagonisten dagegen wurden durch die Auswir- kungen der Fremd- oder auch Selbsttäuschung in eine Identitätskrise gestürzt, in der sie sich der Frage stellen mussten: Wer bin ich wirklich? Zu den Filmen dieser Welle im US-amerikanischen Kino zählen:
1995 - THE USUAL SUSPECTS
1997 - THE GAME
1998 - WILD THINGS
1999 - FIGHT CLUB
THE SIXTH SENSE eXistenz
MATRIX (1. Teil)
2000 - MEMENTO 2001 - THE OTHERS
VANILLA SKY
A BEAUTIFUL MIND
Das Phänomen des unreliable narrators1 / unzuverlässigen Erzählers selbst ist kein Novum in der Filmgeschichte und lässt sich bis in die Stummfilmzeit zurückverfolgen2. Nur handelte es sich dabei um verein- zelte Sonderfälle. Die empörten Publikumsreaktionen auf Hitchcocks Film STAGE FRIGHT (USA 1950)3, in der eine Lüge des Protagonisten in Bil- dern manifestiert wurde, belegen das Vertrauen des Zuschauers in das Bild als ein objektives und authentisches Abbildungsmedium. Zugleich verweist diese negative Zuschauerhaltung auf die im alttestamenta- rischen Bilderverbot innewohnende Erkenntnis von der Macht des Bildes aufgrund dessen Ikonizität und Indexikalität. Unter diesem filmgeschicht- lichen Blickwinkel stellt diese auffällige Häufung von Filmen mit einem unzuverlässigen4 Erzähler zwischen 1995 und 2001 ein Novum dar und weckte mein Forschungsinteresse. Warum werden diese so unkonven- tionell und komplex erzählten Filme mit dem eher abwertenden Begriff „unzuverlässig“ erzählt eingestuft? Gerade das unbemerkte „Belügen“ und „Täuschen“ des Rezipienten verlangt eine hohe Intelligenz und Kunstfertigkeit im Fabulieren. Thomas Koebner ist in seiner Ansicht bei- zupflichten, dass Unzuverlässigkeit in der Kunst kein Makel oder Verge- hen bedeutet.
Vielleicht ist sogar die Wahrnehmung des Unzuverlässigen im künstlerischen Prozess ein Moment, der wieder der Erkenntnis, wie kurzfristig auch immer, Geltung verschafft, dass gerade das Gegenstück: die Idee der Zuverlässigkeit, die eigentliche unge heuerliche Fiktion sei (Liptay/Wolf 2005, 21).
Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Filme ist, dass die unzuverlässi- ge Erzählperspektive nicht nur der Hervorhebung erzählerischer Finesse dient, sondern in den meisten Fällen kongeniales Ausdrucksmittel der Identitätskrise der überwiegend männlichen Hauptfiguren ist. Das Subjekt selbst ist „unzuverlässig“ und auf der Suche nach dem eigenen „Ich“. Die Fremdtäuschung des Rezipienten gründet sich auf der Selbsttäuschung des Protagonisten, die den Rezipienten zugleich zum kritischen Hinter- fragen der eigenen Wahrnehmung auffordert. Dies führt zu einem nächs- ten lohnenswerten Untersuchungsgegenstand dieser Filme: dem Status der Bilder. Büßen die Bilder ihre Qualität als evidentes, objektives Abbil- dungsmedium vollends ein und werden nach Jean Baudrillards Theorie zu Simulakren, die auf keine Realität mehr verweisen, sondern in ständi- ger Zirkulation eine „Hyperrealität“ kreieren (Vgl. Baudrillard 1972, zitiert nach Prümm, 1996)?
1.2 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
Ich habe meinen Filmkorpus gegenüber Filmen abgegrenzt, in denen die Unzuverlässigkeit nicht mehr auf der Vergleichsfolie des Zuverlässigen konstituiert wird, wie beispielsweise bei einigen Filmen David Lynchs5. Denn wie Jörg Schweinitz zutreffend argumentiert, führen derartige Filme „im Grunde zu einer tendenziellen Selbstaufhebung des Begriffs vom un- zuverlässigen Erzählen, da sie den Bezugspunkt des Zuverlässigen und der Abweichung davon intern nur noch als abwesende Größe besitzen, die sich lediglich im intertextuellen Vergleich mit dem klassischen Erzähl- film und den dadurch geprägten Rezeptionserwartungen realisiert“ (Lip- tay/Wolf 2005, 93).
Da eine Analyse aller Filme dieser Welle den Umfang meiner Arbeit übersteigen würde, habe ich den Filmkorpus auf die folgenden drei Filme eingegrenzt:
- FIGHT CLUB,
- THE USUAL SUSPECTS und
- MEMENTO.
Auswahlkriterien waren hierbei eine komplexe narrative Struktur der Fil- me wie eine achronologische Erzählweise, verschiedene narrative Ebe- nen, das Vorhandensein eines Ich-Erzählers sowie eine differenzierte Qualität der Bilder. Die Komplexität der Narration ermöglicht eine diffe- renzierte und umfassende Analyse der narrativen Mittel zur Konstruktion einer unzuverlässigen Erzählperspektive. Die Fokussierung auf Filme mit einem Ich-Erzähler verspricht eine lohnenswertere Analyse der Identi- tätsproblematik, die mindestens implizites Thema in allen Filmen dieser Welle im US-amerikanischen Kino ist. Alle Hauptfiguren der drei ausge- wählten Filme nehmen aus unterschiedlichen Gründen andere Persön- lichkeiten an und gehen damit bewusst oder unbewusst auf die Suche nach einer Antwort auf die Fragen: „Wer bin ich?“ bzw. „Wer möchte ich eigentlich sein?“ Ebenso arbeiten die Filme mit einer ausdifferenzierten Inszenierung der Bildebene sowie mit unterschiedlichen Bildmedien wie Phantomzeichnungen, Fotografien und Tätowierungen, die ein interes- santes Untersuchungsfeld hinsichtlich des Status’ des Bildes und dessen Funktionen eröffnen.
1.3 Ziel der Arbeit
Das Ziel meiner filmanalytischen Arbeit ist die Untersuchung der ausgewählten Filme FIGHT CLUB, THE USUAL SUSPECTS und MEMENTO vor der Vergleichsfolie der klassischen Hollywood-Narration hinsichtlich der narrativen Konzeption einer unzuverlässigen Erzählweise, der Identitätsproblematik der Protagonisten und der Bildkonzeption. Dabei möchte ich insbesondere folgenden Leitfragen nachgehen:
- Wie wird die unzuverlässige Erzählperspektive konstituiert? Wer- den hierfür spezifische narrative Elemente verwendet?
- Wie gestaltet sich die Identitätssuche bzw. Identitätskonstruktion der Protagonisten?
- In welchem Kontext steht die Identitätsproblematik mit der Täu- schung des Rezipienten?
- Wie werden die Bilder in diesen Filmen eingesetzt und welche Be- deutung haben diese für die Konstituierung einer unzuverlässigen Erzählperspektive?
- Negieren diese Filme den Objektivitäts-, Evidenz- und Authentizi- tätscharakter des Bildes, dem es bereits durch die Digitalisierung ausgesetzt ist, noch weiter?
- Etablieren diese überraschend anders konzipierten Filme ein al- ternatives Erzählmodell zur klassischen Hollywood-Narration?
- Was waren die Auslöser dieser Welle von Filmen mit einer unzu- verlässigen Erzählperspektive im US-amerikanischen Kino?
Diese Arbeit ist als exemplarische Filmanalyse zu verstehen, die auf- grund des begrenzten Filmkorpus keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt.
1.4 Aufbau der Arbeit
Als Einstieg werde ich meiner Arbeit einen Überblick über den For- schungsstand zu diesem Thema voranstellen (Kapitel 2). Ausgangspunkt ist der aus der Literaturwissenschaft übernommene Terminus des unre- liable narrators / unzuverlässigen Erzählers, der als Analysefaktor zur Definition derartiger Erzählverfahren herangezogen wird. In diesem Kon- text werde ich auch auf die Problematik des impliziten Autors bzw. cine- matic narrtors eingehen, dessen Vorhandsein als im Text verortbare Be- zugsgröße umstritten ist.
Im zweiten Teil dieses Kapitels gebe ich eine Bewertung zu jüngeren Forschungspositionen, die für die Analyse der unzuverlässigen Erzähl- formen nicht nur neue Termini wie Puzzle Film, Mind-game Film oder forking path Film verwenden, sondern vor allem neue theoretische Ausgangspunkte für die Definition solcher Filme setzen. Das sind zum einen das Aristotelische (klassische) Narrationsmodell und zum anderen die Film-Rezipient-Beziehung. Zum Abschluss des Kapitels lege ich dar, welchen theoretischen Ansatz ich meiner Arbeit für die Analyse der ausgewählten Filme zu Grunde lege.
Vor dem filmanalytischen Hauptteil erfolgt zum besseren Verständnis eine Inhaltsangabe der drei untersuchten Filme (Kapitel 3) sowie im Kapitel 4 eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale der als Vergleichsfolie dienenden klassischen Hollywood-Narration.
Im Hauptteil meiner filmanalytischen Arbeit (Kapitel 5-7) werden die nar- rativen Elemente in den drei ausgewählten Filmen untersucht, die zur Konzeption einer unzuverlässigen Erzählperspektive in Betracht kom- men. Hierbei möchte ich den Fokus auf die nachfolgenden narrativen Elemente richten, da diese entweder Hauptmerkmale der als Vergleich dienenden klassischen Hollywood-Narration sind oder eine herausgeho- bene Position in der Narration der untersuchten Filme einnehmen.
Im Kapitel „Ordnung, Stimme und Modus der filmischen Erzählung“ wird zunächst das in allen drei Filmen eingesetzte narrative Element der Voice-over, anschließend die komplexe Zeitstruktur sowie die auffallende Vielfalt an narrativen Ebenen untersucht.
Im Kapitel 6 richtet sich der Analyseschwerpunkt auf den Protagonisten, und zwar konkret auf dessen Identitätssuche und -konstruktion. Kapitel 7 widmet sich der Bildkonzeption der Filme und betrachtet in die- sem Kontext auch die Markierung und die Auflösung der unzuverlässigen Erzählperspektive, da diese häufig auf der visuellen Ebene vorzufinden ist.
Bei der Analyse dieser einzelnen Elemente möchte ich zunächst deren Konzeption und Funktion näher beleuchten und dann abschließend der Frage nachgehen, ob das einzelne narrative Mittel substantielle Voraus- setzung für die Generierung einer unzuverlässigen Erzählperspektive ist.
Zum Abschluss meiner Arbeit werden zunächst die eingangs gestellten Leitfragen hinsichtlich der narrativen Konzeption einer unzuverlässigen Erzählperspektive, der Identitätsproblematik der Protagonisten und der Bildkonzeption nochmals aufgegriffen und unter Einbeziehung aller film- analytischen Ergebnisse zusammenfassend beantwortet. Im Anschluss gehe ich den Fragen nach, ob die unzuverlässigen Erzählformen ein al- ternatives Erzählmodell zur klassischen Hollywood-Narration etablieren und welche Faktoren als Auslöser dieser Welle von unzuverlässig erzähl- ten Filmen im US-amerikanischen Kino anzusehen sind.
2 Überblick über den Forschungsstand
2.1 Der Terminus des unreliable narrators
Der Terminus des unreliable narrators hat seinen Ursprung in der Litera- turwissenschaft. Wayne C. Booth führte diesen Begriff 1961 in seiner Studie „The Rhetoric of Fiction“ in die literaturwissenschaftliche Erzähl- theorie ein und dieser gilt seither als ein akzeptierter Analysefaktor. Booth definiert den unreliable narrator als einen abgeleiteten Negativbe- griff wie folgt:
I have called a narrator reliable when he speaks for or acts in ac- cordance with the norms of the work (which is to say, the implied author ’ s norms), unreliable when he does not. (Booth 1983, 158f.)
Für Booth ist der Maßstab für die Unterscheidung zwischen einem zuver- lässigen und unzuverlässigen Erzähler der Grad und die Art von Distanz, die zwischen dem diegetischen Erzähler, vorwiegend einem Ich-Erzähler, und der Instanz des impliziten Autors besteht. Dieser implizite Autor wird von Booth und der Vielzahl seiner Anhänger6 wie folgt definiert: Der implizite Autor ist weder der reale Autor noch der diegetische Erzäh- ler, sondern eine ordnende werkimmanente Erzählinstanz, die den Er- zähler und alle anderen Elemente der Erzählung kreiert. Zudem dient er als Garant für die vom Autor intendierte Sichtweise auf die Dinge, die sich von der des unzuverlässigen Erzählers unterscheidet. (Vgl. Booth 1983)
Bereits Booth vergleicht daher das unzuverlässige Erzählen als ein mit der Ironie verwandtes, widersprüchliches Erzählverfahren. Martinez/ Scheffel geben hierfür eine prägnante Beschreibung:
Der unzuverlässige Erzähler l äß t sich am besten mit dem Begriff der Ironie erklären. Ironische Kommunikation verdoppelt das Kommunikat zwischen zwei Gesprächspartnern in eine explizite und eine implizite Botschaft. […] Die besonderen Möglichkeiten fik- tionaler Texte werden jedoch erst dann genutzt, wenn die doppelte Botschaft der Ironie auf zwei verschiedene Sender verteilt ist. In diesem Fall kommuniziert der unzuverlässige Erzähler eine explizi- te Botschaft, während der Autor dem Leser implizit, sozusagen am Erzähler vorbei, eine andere, den Erzählerbehauptungen wider- sprechende Botschaft vermittelt. (Martínez/Scheffel 2000, 100f.)
Auch Seymour Chatman sieht diese Verbindung zum ironischen Erzähl- verfahren. Er argumentiert, dass bei einer Differenz zwischen der Aussa- ge des diegetischen Erzählers und der Haltung des impliziten Autors eine Kommunikation zwischen Leser und implizitem Autor in Form einer „sec- ret ironic message about the narrator’s unreliability“ (Chatman 1990, 151) entsteht. Zur Veranschaulichung seiner These verortet er den impliziten Autor als Sender im etablierten Kommunikationsmodell narrativer Texte (vgl. Nünning 1998, 14). Sowohl Booths Kategorie des impliziten Autors als auch Chatmans modifiziertes Kommunikationsmodell werden u.a. von Manfred Jahn und Ansgar Nünning stark kritisiert. Ihre Gegenposition fußt auf der Feststellung, dass der implizite Autor keine Stimme im Text hat, womit er keine Senderfunktion erfüllen und folglich keine Position in einem kommunikationstheoretischen Rahmen einnehmen kann. Nünning entwirft deshalb eine radikale Neukonzeptionierung des unzuverlässigen Erzählens, indem er auf die Bezugsgröße des impliziten Autors vollstän- dig verzichtet. Er schlägt vor, dass der unreliable narrator als eine Projek- tion des Lesers zu verstehen ist, der Widersprüche innerhalb des Textes und zwischen der fiktiven Welt des Textes und seinem eigenen Wirklich- keitsmodell auf diese Weise auflöst“ (Nünning 1998, 5). Er erweitert da- mit Booths und Chatmans textliche Herangehensweise um einen interak- tiven kognitiven Rezeptionsprozess im außertextlichen Bereich. Nach Nünnings Theorie ist der Leser die entscheidende Bezugsgröße, die das Werturteil über die Zuverlässigkeit bzw. Unzuverlässigkeit des Erzählers fällt, indem dieser sein Weltwissen, das jeweilige historische Wirklich- keitsmodell, Kenntnisse über Gattungskonventionen, seine kognitiven Fähigkeiten und sein Moral- und Wertesystem in interpretativer Weise einsetzt.
Diese konträren Positionen haben sich mit wenigen Modifikationen auch in der Filmwissenschaft etabliert. Diese Modifikationen ergeben sich aus der für den Film charakteristischen Kopräsenz von mehreren Erzählin- stanzen. Während in der Literatur die textuellen Signale ausschließlich sprachlicher Natur sind, kann im Film jedes Element (z.B. Kameraposi- tionen, Licht, Geräusche, Filmmusik, Montage), das durch Bild und Ton vermittelt wird, Signale für die Unzuverlässigkeit des Erzählers setzen. Seymor Chatman sowie Sarah Kozloff und Jakob Lothe überführten die Kategorie des impliziten Autors unter Berücksichtigung der beschriebe- nen Kopräsenz mehrerer Erzählinstanzen in die filmische Narrationstheo- rie. Chatman bezeichnet diese Kategorie hier als cinematic narrator und definiert sie als „composite of a large and complex variety of communicat- ing devices“ (Chatman 1990, 134).
Filmwissenschaftler wie David Bordwell, Edward Branigan und Brian Henderson negieren wie u.a. Nünning die Existenz eines impliziten Au- tors, da dieser keinerlei hör- oder sichtbare Präsenz habe. Die Kritik gründet sich hierbei einerseits auf die Personalisierung eines Erzählers. Um dem Verdacht einer Anthropomorphisierung des impliziten Autors vorzubeugen, halte ich es für sinnvoll, den u.a. von Jörg Schweinitz ver- wendeten Begriff der zentralen narrativen Instanz zu verwenden, den er wie folgt definiert:
Die zentrale narrative Instanz ist vielmehr als die in den jeweiligen Film ‚ eingeschriebene ‘ , die Erzählung organisierende Kraft zu ver- stehen, der ebenso wie dem literarischen Erzähler die Hoheitüber alle Ausdrucksmittel des Mediums zuerkannt wird. (Schweinitz 2007, 89f.)
Andererseits negieren u.a. Nünning und Bordwell die Existenz eines Senders im Kommunikationsprozess von Literatur und Film aufgrund ei- ner mangelnden Nachweisbarkeit im Text und konstatieren, dass die Nar- ration als ein Zusammenschluss von Hinweisbündeln betrachtet werden sollte, die zwar einen Empfänger, aber keinen Sender voraussetze. Auch Bordwell behauptet, dass die Unzuverlässigkeit eines filmischen Textes allein durch die Interpretationsleistung des Rezipienten erschlossen wird. Gleichwohl werden durch Literatur und Film unzweifelhaft Kommunikati- onsprozesse ausgelöst, die grundsätzlich auf einem Informationsaus- tausch zwischen zwei verschiedenen Elementen, einem Sender und ei- nem Empfänger, basieren. Auch Nünning und Bordwell gehen bei ihrer These hinsichtlich erzählerischer Unzuverlässigkeit von textlichen Signa- len aus, die den Hinweis auf die Unzuverlässigkeit des Erzählers geben. Also stellt sich doch auch bei dieser These die Frage: Wer sendet diese Signale? Konsequenter Weise müssten Nünning und Bordwell hierauf die Antwort geben: der reale Autor. Aber wie Genette richtig bemerkt, ist bei einer Fiktionserzählung der Autor nicht mit dem Erzähler gleichzusetzen, da „die narrative Situation einer Fiktionserzählung natürlich nie mit ihrer Schreibsituation identisch“ ist (Genette 1998, 152). Anders ausgedrückt: der Erzähler „kennt“ die diegetische Welt mit ihren darin agierenden Per- sonen, während der Autor sich diese nur ausdenkt (vgl. Ebenda). Darü- ber hinaus stellt sich beim Film zudem die grundsätzliche Frage wer der reale Autor ist: der Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann, Cutter oder das gesamte Filmteam?
Der Hauptkritikpunkt an der These Nünnings und Bordwells ist jedoch die Vernachlässigung der Subjektivität des Rezipienten bei der Interpretation der unzuverlässigen Texte. Andreas Solbach kritisiert zutreffend, dass diese These „den entwicklungspsychologischen Prozess der kognitiven und emotionalen Reifung weitgehend außer Acht lässt, denn nicht alle Leser sind immer auf dem gleichen Stand kognitiver Fähigkeiten: Unter- schiede von Begabung und Kontexten machen sich ebenso bemerkbar wie Leseerfahrung und Konzentration“ (Liptay/Wolf 2005, 63). Somit könnte derselbe Text von einem Rezipienten als unzuverlässig erzählt interpretierbar sein und von einem anderen dagegen nicht.
Ich halte es daher für die Analyse des Phänomens der erzählerischen Unzuverlässigkeit im Film für nützlich, eine zentrale narrative Instanz zu hypostasieren, da die Senderfunktion im filmischen Kommunikationsprozess nicht einfach negiert werden kann und deren schlichte Zuweisung an einen realen Autor im Film nicht möglich ist.
2.2 Jüngste theoretische Ansätze zur Definition und Analyse von Filmen mit einer unzuverlässigen Erzählperspektive
In Warren Bucklands Aufsatzsammlung „Puzzle Films“ aus dem Jahr 2009 werden u.a. auch die von mir angeführten Filme mit einer unzuver- lässigen Erzählperspektive einbezogen und analysiert. Allerdings wird hier weder Bezug genommen zum Terminus des unreliable narrators noch auf die damit verbundene Theorie. So findet sich im Werk Buck- lands zunächst eine Vielzahl neuer Bezeichnungen für die von mir unter- suchten Filme. Während Buckland für diese Filme den Terminus Puzzle Film prägt, benutzt Elsaesser die Bezeichnung Mind-game Film und nicht zuletzt wird wiederholt auf die von Bordwell gefundenen Bezeichnungen forking path Film sowie multiple draft Film aus seinem 2002 erschienen Aufsatz „Film Futures“ verwiesen. So entsteht zunächst ein Verwirrung stiftendes Konvolut von neuen Termini für dieselbe Gruppe von Filmen. Gleiches gilt für die theoretische Definition dieser Filme. Buckland nimmt hierfür als Ausgangspunkt Aristoteles‘ Definition des complex plots bzw. in der deutschen Übersetzung von Fuhrmann der komplizierten Fabel aus seinem Werk „Poetik“. Für Aristoteles zeichnet sich der complex plot / komplizierte Fabel im Gegensatz zum simple plot /zur einfachen Fabel dadurch aus, dass die Wende der Handlung mit einer Peripetie oder Wiedererkennung verbunden ist. Buckland argumentiert weiter, dass der Puzzle Film den dritten Typ einer Fabel darstellt, der hierarchisch über dem complex plot /der komplizierten Fabel einzuordnen ist. Seine Definiti- on des Puzzle Film lautet:
A puzzle plot is intricate in the sense that the arrangement of events is not just complex, but complicated and perplexing; the events are not simply interwoven, but entangled. (Buckland 2009, 3)
Bereits dadurch, dass Fuhrmann Aristoteles zweiten Fabeltyp als kompli- zierte Fabel ins Deutsche übersetzt, wirft die Einordnung von Bucklands drittem Fabeltyp Schwierigkeiten auf. Denn Buckland bezeichnet diesen nunmehr als Steigerung zum zweiten Fabeltyp als kompliziert. Darüber hinaus unterliegen auch die anderen von Buckland verwendeten Abgren- zungsbegriffe wie perplexing als Steigerung zu complex und entangled als Steigerung zu interwoven der subjektiven Einschätzung des Rezipien- ten und sind daher als objektive Abgrenzungskriterien nicht geeignet. Zudem weisen beispielsweise die Filme A BEAUTIFUL MIND und THE SIXTH SENSE eine klassische, chronologisch erzählte Fabel auf und dürften nach Bucklands Definition nicht als Puzzle Film einzustufen sein. Gleichwohl wird THE SIXTH SENSE als Puzzle Film ausführlich in Buck- lands Buch analysiert. Des Weiteren erachte ich auch Bucklands gefun- dene Bezeichnung Puzzle Film als irreführend. Ein Puzzle ist ein Rätsel, das sich dem Ratenden nur erschließt, wenn er die einzelnen Teile in der richtigen Art und Weise zusammensetzt. Es stellt demnach an den Ra- tenden eine aktive Spielaufforderung. Die Filme FIGHT CLUB, A BEAU- TIFUL MIND und THE SIXTH SENSE beispielsweise vermeiden es aber gerade, eine derartige Spielaufforderung an den Rezipienten zu stellen. Denn diese Filme zielen darauf ab, den Rezipienten mit einer neuen Les- art des Films zu überraschen. Aus den genannten Gründen halte ich da- her weder die von Buckland gefundene Bezeichnung noch die Definition dieser Filme für geeignet.
Elsaesser stellt bei der Bezeichnung und Definition dieser Filme die Rolle des Rezipienten stärker in den Mittelpunkt. Er definiert den Mind-game Film daher wie folgt:
It comprises movies that are „ playing games, “ and this at two le vels: there are films in which a character is being played games with, without knowing it or without knowing who it is that is playing these (often very cruel and even deadly) games with him (or her): […]. Then. there are films where it is the audience that is played games with, because certain crucial information is withheld or am biguously presented: […]. (Buckland 2009, 14)
Zu der ersten Kategorie zählt Elsaesser beispielsweise die Filme SILEN- CE OF THE LAMBS, SEVEN, THE TRUMAN SHOW und überraschen- der Weise auch THE GAME. Zunächst ist zu konstatieren, dass die Filme der ersten Ebene nicht zur Gruppe der Filme mit einer unzuverlässigen Erzählperspektive hinzuzurechnen sind. Bei SILENCE OF THE LAMBS und SEVEN erwartet der Rezipient aufgrund der Genrekonventionen des
Thrillers bzw. Kriminalfilms, dass er nicht alle Informationen erhält (vgl. hierzu meine Ausführungen auf S. 18). Bei dem Film THE TRUMAN SHOW erfährt der Zuschauer zu Beginn des Films, dass hier ein Spiel mit dem Protagonisten gespielt wird. Entscheidend bei den Filmen mit einer unzuverlässigen Erzählperspektive ist jedoch, dass der Rezipient von dieser überrascht bzw. durch diese in ein Verwirrung stiftendes per- zeptives und kognitives Spiel hineingezogen wird, dass das gewohnte passive Rezeptionsverhalten übersteigt. Aus diesem Grund ist der Film THE GAME als Vertreter der von Elsaesser definierten zweiten Ebene von Filmen zu bewerten, in die sich zugleich die Filme mit einer unzuver- lässigen Erzählperspektive einordnen lassen. Denn in THE GAME wird das Spiel mit dem Verstand nicht nur mit dem Protagonisten, sondern auch mit dem Rezipienten gespielt: Beide können nicht mehr erkennen, welche Erlebnisse in der diegetischen Welt „real“ oder Teil des Spiels sind.
Die Definition der zweiten Ebene von Mind-game Filmen verweist auf eines der Verfahren, mit dem sich auch ein unzuverlässiger Erzähler konstituieren lässt:
Dem Rezipienten werden Informationen über Umstände und Ereignisse vorenthalten und erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert, so dass er erst dann die bis dato bemerkten Leer- stellen bzw. Irritationen ähnlich einem unvollendeten Kreuzwort- rätsel ausfüllen und so den intendierten Sinn der filmischen Erzäh- lung vollends erschließen kann. Bei diesem Verfahren erweist sich der Erzähler als unzuverlässig, weil er lügt, sich irrt oder nicht zwi- schen Eingebildetem, Halluzinationen, Träumen oder übernatür- lichen Erfahrungen einerseits und der Realität innerhalb der fil- mischen Fiktion andererseits unterscheiden kann. (vgl. dazu Lip- tay/Wolf 2005, 21)
Das zweite Verfahren zur Konstruktion einer unzuverlässigen Erzähl- perspektive, das Elsaesser in seiner Definition der Mind-game Filme nicht miterfasst, wird in der Erzählforschung (vgl. Ebenda) folgendermaßen definiert:
Der Rezipient ist im Besitz aller Informationen der fiktiven Welt, aber der Erzähler deutet diese Welt oder die darin erfahrenen Erlebnisse falsch, wodurch er sich als unzuverlässig entpuppt. Diese Erzähler nehmen vor der Hintergrundfolie einer „normalen, richtigen“ Weltansicht die dargestellte Welt aus einer andersartigen subjektiven Perspektive wahr, beispielsweise einer naiven, ironischen, zynischen oder pathologischen.
Alle von mir angeführten Filme mit einer unzuverlässigen Erzählperspek- tive sind dem ersten Verfahren bzw. den Mind-game Filmen der zweiten Ebene zuzuordnen. Dennoch ist eine auffällige Heterogenität dieser Fil- me hinsichtlich ihrer intendierten Rezeptionswirkung festzustellen, so dass ich eine Differenzierung in die zwei folgenden Unterkategorien für sinnvoll erachte:
Unterkategorie 1 - Unzuverlässigkeit als überraschender Clou:
In der ersten Unterkategorie sind die im filmischen Text angelegten Markierungen für die Unzuverlässigkeit des Erzählers für den Rezipienten nicht klar erkennbar, so dass er von der Unzuverlässigkeit des Erzählers überrascht wird. Zur ersten Unterkategorie zähle ich die Filme THE USUAL SUSPECTS, WILD THINGS, FIGHT CLUB, THE SIXTH SENSE, THE OTHERS, VANILLA SKY und A BEAUTIFUL MIND.
Begründung: Der Erzähler verheimlicht vor dem Rezipienten bis zur überraschenden Auflösung seiner unzuverlässigen Erzählweise, dass der Protagonist in:
- FIGHT CLUB und A BEAUTIFUL MIND psychisch krank ist;
- THE SIXTH SENSE, THE OTHERS und VANILLA SKY7 tot ist;
- THE USUAL SUSPECTS und WILD THINGS der raffinierte Draht- zieher eines kriminellen Coups ist.
Unterkategorie 2 - Unzuverlässigkeit als offenes Konzept:
Im Gegensatz dazu sind die Filme der zweiten Unterkategorie als Rätsel konzipiert, bei dem die Unzuverlässigkeit des Erzählers offengelegt wird. Der Rezipient befindet sich i.d.R. in der Lage der Hauptfigur, die sich in einer veränderten bzw. unbekannten Welt zurecht finden muss und zu ergründen versucht, was „real“ und was „irreal“ ist. Als Filme der zweiten Unterkategorie ordne ich die Filme THE GAME, eXistenz, MATRIX und MEMENTO ein.
Begründung: In THE GAME ist der Protagonist Teilnehmer eines Spiels in seiner „realen“ Welt, bei dem dieser bald nicht mehr unterscheiden kann, welche Erlebnisse real oder Teil des Spiels sind. Ähnlich ergeht es den Protagonisten in eXistenz, nur dass hier die virtuelle Realität des Computerspiels auch als eigene „Welt“ visualisiert wird. Der Protagonist in MATRIX versucht dagegen herauszufinden, ob seine „reale“ Welt le- diglich eine Computersimulation (Matrix) ist, die von Maschinen ent- wickelt wurde, um die versklavte Menschheit unter Kontrolle zu halten. In MEMENTO hat sich die Welt für den Protagonisten aufgrund seiner psy- chischen Erkrankung verändert und wird dadurch neu erlebt.
Da alle vier Filme aus der ausschließlichen Erlebensperspektive der Protagonisten erzählt wird, teilt der Rezipient deren verwirrende Lage.
Diese von mir getroffene Differenzierung weist hinsichtlich der Unterkate- gorie 2 auf ein Abgrenzungsproblem der unzuverlässig erzählten Filme gegenüber dem Genre des Kriminalfilms und Thrillers hin, das in der For- schung keine explizite Erwähnung findet. Denn auch in diesen Filmen werden dem Rezipienten Informationen vorenthalten, die sukzessiv enthüllt werden, um im intendierten Ratespiel mit dem Zuschauer den Täter zu entlarven. Somit weisen auch alle Filme des Kriminalfilms und Thrillers, die die Tätersuche in den Handlungsmittelpunkt stellen, eine unzuverlässige Erzählperspektive auf. Allerdings ist die unzuverlässige Erzählperspektive in diesen Filmen standardisiertes Genremerkmal und wird daher vom Rezipienten erwartet. Aus diesem Grund sind derartige
Genrefilme nicht in den Filmkorpus der unzuverlässig erzählten Filme einzubeziehen.
Abschließend ist festzustellen, dass sich die Filme mit einer unzuverläs- sigen Erzählperspektive auch als die von Elsaesser bezeichneten Mind- game Filme der zweiten Ebene einordnen lassen. Positiv an Elsaessers Definition von Mind-game Filmen dieser Ebene ist auch, dass er die wich- tige Rolle des Rezipienten durch den Verweis auf das „Spiel“ mit diesem in den Vordergrund stellt. Allerdings beantwortet Elsaesser nicht die Fra- ge, wer dieses Spiel mit dem Rezipienten spielt. Genau diese Frage führt wieder zur Kategorie der zentralen narrativen Instanz. Darüber hinaus gründet sich das Besondere, Andersartige dieser Filme darauf, dass der Rezipient der in Wort und Bild gezeigten Filmerzählung nicht wie ge- wohnt vertrauen kann. Der Rezipient hat es mit einem Erzähler zu tun, der ihn bewusst oder unbewusst täuscht und somit nicht glaubwürdig ist. Aufgrund dessen erachte ich die Theorie des unreliable narrators, trotz der unglücklichen deutschen Übersetzung mit unzuverlässiger Erzähler, als am besten geeignet, um die eingangs aufgeführten Filme zu untersu- chen.
3 Inhaltsangaben der Filme FIGHT CLUB, THE USUAL SUSPECTS und MEMENTO
3.1 Inhaltsangabe: FIGHT CLUB
Der Film beginnt damit, dass der namenlose Protagonist von seinem Partner Tyler Durden mit der Waffe bedroht wird. In dieser Ausgangssi- tuation fängt der bedrohte Protagonist an, in komplexen diegetischen Rückblenden und non-diegetischen Einschüben zu erzählen, wie er in diese Lage geraten ist. Der Ich-Erzähler, vom allgemeinen gesellschaft- lichen Konsum- und Profitwahn krank geworden, leidet unter Schlaflosig- keit. Schlafen kann er nur noch, wenn er sich als vermeintlich Betroffener in verschiedenen Selbsthilfegruppen das Leiden von Schwerkranken an- hört und sich ausweinen kann. Dies funktioniert nicht mehr als ein ande- rer Hochstapler, Marla Singer, bei diesen Treffen auftaucht und ihm damit seine eigene Lüge vor Augen führt. Erst die Bekanntschaft mit Tyler Dur- den, der all das verkörpert, was er gern sein möchte - gut aussehend, charismatisch, intelligent, kompromisslos handelnd -, eröffnet ihm eine neue Lebensperspektive. Gemeinsam gründen sie den geheimen „Fight Club“, in dem sich Männer im Faustkampf ihre Männlichkeit zurücker- obern. Erst als der „Fight Club“ zu einer paramilitärischen Organisation avanciert und die Sprengung mehrerer Finanzorganisationen plant, ver- sucht der Erzähler die Aktion zu stoppen und sucht nach seinem ver- schwundenen Partner Tyler Durden. Erst dabei macht der Protagonist die schockierende Entdeckung, dass er selbst Tyler Durden ist. Während er noch versucht, die Erkenntnis über seine multiple Persönlichkeitsstörung zu verarbeiten, muss er feststellen, dass die terroristischen Pläne Tylers nicht mehr rückgängig zu machen sind. Durch einen Schuss in seinen Kopf will er zumindest den Dämon Tyler in sich töten. Am surrealen Ende beobachtet der Protagonist mit einer klaffenden Kopfwunde Hand in Hand mit seiner Freundin Marla Singer die Explosionen der Bankgebäu- de. Doch die dabei kurz zu sehenden Frames von einem Penis verweisen darauf, dass Tyler nicht völlig ausgelöscht wurde.
3.2 Inhaltsangabe: THE USUAL SUSPECTS
Der Protagonist und Ich-Erzähler dieses Films ist der körperlich behinder- te Kleinkriminelle Verbal Kint, der als einer von zwei Überlebenden eines blutig geendeten (vermeintlichen) Drogendeals auf einem Frachtschiff von Zollinspektor Kujan verhört wird. Verbal erzählt in mehreren Rück- blenden, wie sich er und vier weitere Ganoven, u.a. der Ex-Polizist Kea- ton, zusammengeschlossen haben. Nach zwei gemeinsamen Raubüber- fällen wurden sie vom Anwalt des mächtigen, aber unbekannten Gangs- terbosses Keyser Soze zu einem Himmelfahrtskommando gezwungen. Sie sollten eine Drogenlieferung im Wert von 90 Millionen Dollar eines Konkurrenten Keyser Sozes vernichten und dessen Bande eliminieren. Der zweite Überlebende dieses Himmelfahrtskommandos, ein schwer verletzter ungarischer Gangster des konkurrierenden Drogenkartells, wird zur selben Zeit von Kujans Kollegen im Krankenhaus verhört. Dieser Gangster erklärt, dass auf dem Schiff nicht Drogen versteckt wurden, sondern der einzige Augenzeuge, der Keyser Soze identifizieren konnte. Zwar wurde dieser Zeuge ermordet, aber der verletzte Ungar hat in jener Nacht Keyser Soze gesehen. Eine Phantomzeichnung wird angefertigt. Kujan glaubt Verbals Aussage nicht, wonach Keaton bei dem Überfall getötet wurde. Er hält Keaton für Keyser Soze und versucht Verbal davon zu überzeugen, dass Keaton Verbal nur als Augenzeuge für seinen ver- meintlichen Tod benutzt hat und ihn später töten wird. Doch Verbal lässt sich nicht einschüchtern und wird frei gelassen. Nur wenige Minuten nachdem Verbal das Büro verlassen hat, erkennt Kujan, dass Verbal sich u.a. aus den Notizen auf der Pinnwand des Verhörraums diese überzeu- gende Lügengeschichte ausgedacht hat, die ihn als unschuldigen Au- genzeugen erscheinen ließ. Zeitgleich kommt aus dem Krankenhaus die Phantomzeichnung von Keyser Soze an. Es ist - Verbal! Kujan stürzt Verbal hinterher, aber sieht nicht mehr wie Verbal/Keyser Soze, plötzlich nicht mehr humpelnd, in das Auto seines Anwalts steigt und davonfährt.
3.3 Inhaltsangabe: MEMENTO
Der Protagonist und Ich-Erzähler in MEMENTO ist der ehemalige Versi- cherungsermittler Leonard Shelby, der seit dem Mord an seiner Frau sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Trotz dieser geistigen Dysfunktion will er den Mord an seiner Frau rächen, indem er den nie gefassten zweiten Täter findet und tötet. Dabei benutzt er Notizen, Fotos und Tattoos als Gedächtnishilfen. Unterstützung erhält Leonard vom korrupten Polizisten Teddy und von Natalie, der Freundin des Drogendealers Jimmy Grant. Leonard ermordet im Verlauf des Films zwei Menschen - Teddy und Jimmy Grant. Zunächst scheint es bei beiden Morden so, dass Leonard immer im Glauben handelte, den Mörder seiner Frau zu töten und er von Anderen nur als Killer benutzt wurde. Zum einen von Teddy bei der Er- mordung Jimmy Grants und zum anderen von Natalie bei der Ermordung Teddys. Am Ende stellt sich jedoch heraus, dass Leonard die Ermordung Teddys bewusst geplant hat und somit tatsächlich ein Killer ist.
4 Die klassische Hollywood-Narration als Ver- gleichsfolie
Da die Hollywood-Narration in der Filmwissenschaft als das klassische Erzählmodell gilt, möchte ich diese als Vergleichsfolie heranziehen, um die narrative Konzeption der Filme FIGHT CLUB, MEMENTO und THE USUAL SUSPECTS zu analysieren und die weitergehende Frage beantworten, ob diese Filme ein neues Erzählmodell als Alternative zur klassischen Hollywood-Narration begründen.
Um die narrativen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den drei zu untersuchenden Filmen im Vergleich zur klassischen Narration heraus- zuarbeiten, soll zunächst eine Zusammenfassung der wichtigsten Merk- male der klassischen Hollywood-Narration vorangestellt werden. David Bordwell, Kristin Thompson und Janet Staiger haben in ihrem Standard- werk „The classical Hollywood cinema. Film style & mode of production to 1960.” die Charakteristika der klassischen Hollywood-Narration8 formu- liert. Das klassische Narrationsmodell ist an die Aristotelische Dramen- theorie angelehnt und zeichnet sich durch eine klare figurenzentrierte Kausalkettenstruktur aus, die die Handlung motiviert. Zufälle und nicht kausal verbundene Handlungen sind weitestgehend eliminiert, um die Einheit des Films und die Aufmerksamkeit des Zuschauers nicht zu stö- ren. Zudem haben diese Filme ein geschlossenes Ende, d.h. einen defi- nitiven und eindeutigen Abschluss der Kette von Ursache und Wirkung, wobei es gleichgültig ist, ob der Protagonist den Sieg davon trägt oder verliert. Der Protagonist hat eine klar definierte Identität, der er sich auch bewusst ist, und besitzt einen hohen Grad an Charakterkontinuität. Bei der klassischen Erzählweise ist die Aufrechterhaltung der Illusionswir- kung des Mediums zentrales Element, d.h. die Narration versucht im Ge- gensatz zu beispielsweise Godards Filmen9 möglichst unsichtbar zu sein.
Hinsichtlich der Bildkonzeption ist festzustellen, dass die Bilder die Funk- tion haben, die Handlung zu illustrieren oder einen zusätzlichen Schau- wert zu generieren. Darüber hinaus erfüllen die Bilder der klassischen Hollywood-Filme den ursprünglichen Anspruch nach Authentizität, Objek- tivität und Evidenz. szenen (PIERROT LE FOU) [FRA/I 1965] oder Schießereien (MASCULIN - FÉMININ: 15 faits précis) [FRA/SWE 1966).
5 Ordnung, Stimme und Modus der filmischen Erzählung
Der Filmwissenschaft mangelt es an einer einheitlichen narratologischen Terminologie. Zum einen werden divergierende Begriffe für dasselbe Phänomen verwendet, zum anderen Termini kontrovers diskutiert und konzeptionalisiert. Um meiner Arbeit ein klar definiertes theoretisches Gerüst zu geben, werde ich mich auf die von Gérard Genette in seinem Werk „Die Erzählung“ entwickelte Terminologie stützen. Genettes aus der Literaturwissenschaft stammende Terminologie gilt als eine der differen- ziertesten und komplexesten und ist in der internationalen Erzählfor- schung weit verbreitet und akzeptiert.
Nach der kurzen Einführung in die narratologische Terminologie Genettes möchte ich die narrativen Elemente untersuchen, die zur Konzeption einer unzuverlässigen Erzählperspektive in Betracht kommen. Hierbei möchte ich den Fokus auf die nachfolgenden narrativen Elemente richten, da diese entweder Hauptmerkmale der als Vergleich dienenden klassischen Hollywood-Narration sind oder eine herausgehobene Position in der Narration der untersuchten Filme einnehmen:
- die Voice-over
- Zeitstruktur und narrative Ebenen
- Identitätsproblematik des Protagonisten
- Bildkonzeption
- Markierungen der erzählerischen Unzuverlässigkeit
- Auflösungssequenz
In diesem Kapitel („Ordnung, Stimme und Modus der filmischen Erzählung“) wird zunächst das in allen drei Filmen eingesetzte narrative Element der Voice-over, anschließend die komplexe Zeitstruktur sowie die auffallende Vielfalt von narrativen Ebenen untersucht. Die Identitätsproblematik der Protagonisten und die Bildkonzeption im Kontext von Markierung und Auflösung der erzählerischen Unzuverlässigkeit sind die Analyseschwerpunkte in den zwei Folgekapiteln (6 und 7).
5.1 Narratologische Terminologie
Für meine Analyse der Narration in den drei Filmen sind nur die drei folgenden von Genette definierten Kategorien relevant: die Ordnung, die Stimme und der Modus der Erzählung.
Die Kategorie der Ordnung ist für die Analyse der Zeitstruktur von Bedeu- tung. Genette definiert die Ordnung als das Verhältnis zwischen dem tat- sächlichen zeitlichen Verlauf der Ereignisse der Geschichte und der Anordnung dieser Ereignisse in der Erzählung. Werden die Ereignisse nicht chronologisch-linear in der Erzählung angeordnet, spricht Genette von Anachronien . Genette unterscheidet die Anachronien in folgende Arten:
- Analepse: ein Zeitsprung in die Vergangenheit (Rückblende). Geht
man von einer Basiserzählung mit Anfang und Ende aus, kann man die Analepse entsprechend ihrer Reichweite in die folgenden Unterarten gliedern:
- externe Analepse: erzählt die Ereignisse, die vor der Basis- erzählung liegen,
- interne Analeps e: füllt die Lücken innerhalb der Basiserzäh- lung auf.
Der Umfang der analeptischen Erzählung wird von Genette mit den folgenden Termini unterschieden:
- vollständige Analepse: die „Rückblende“ wird bis zu dem Zeitpunkt erzählt, an dem die Basiserzählung unterbrochen wurde,
- partielle Analepse: die „Rückblende“ schließt nicht nahtlos an die unterbrochene Basiserzählung an.
- Prolepse: ein Zeitsprung in die Zukunft (Vorausschau). Auch die Prolepse kann nach ihrer Reichweite und ihrem Umfang unterschieden werden in:
- externe Prolepse: erzählt die Ereignisse, die nach der Ba- siserzählung liegen,
[...]
1 Die Erläuterung dieses Terminus erfolgt ab Seite 3.
2 Beispiele aus der Filmgeschichte sind: Robert Wienes DAS CABINET DES DR. CALIGARI (D 1920), Alfred Hitchcocks STAGE FRIGHT (USA 1950) und VERTIGO (USA 1958), Akira Kurosawas RASHOMON (J 1950).
3 In diesem Film lässt Hitchcock seinen Protagonisten durch dessen Schilderung der Ereignisse bis zur Enthüllung am Ende als unschuldig Verfolgter erscheinen, obwohl er tatsächlich der Mörder ist. Diesen Eindruck erweckt er beim Publikum durch eine vier- telstündige Rückblende, in der er die Falschaussage des Protagonisten visualisiert.
4 In der deutschen Film- und Literaturwissenschaft wurde die Bezeichnung „unreliable“ mit „unzuverlässig“ übersetzt (Vgl. hierzu Fabienne Liptays und Yvonne Wolfs Buch „Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Film“). Treffender wäre eine Übersetzung mit dem Wort „unglaubwürdig“ und zwar in dem Sinn, dass der Rezipient dem Erzähler nicht vertrauen und eine distanzierte Rezeptionshaltung ein- nehmen sollte.
5 LOST HIGHWAY (USA/FRA 1997) und MULHOLLAND DRIVE (USA/FRA 2001).
6 Beispielsweise: Seymor Chatman, Franz K. Stanzel, James Phelan, Tamar Yacobi, Monika Fludernik.
7 In VANILLA SKY hat sich der Protagonist nach einem schweren Autounfall einfrieren lassen.
8 Bordwell, Thompson und Staiger verorten zeitlich die klassische Narration im Hollywoodkino zwischen 1916 bis Ende der 1960er Jahre.
9 Godard durchbricht in seinen Filmen häufig die Filmrealität, indem er die Aufnahme- mechanismen des Mediums offenlegt oder Elemente des Dokumentarfilms einfließen lässt. So zeigt er in 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE (FRA 1967) seine Protago- nisten in Interviewsituationen oder durchbricht die Filmhandlung mit plötzlichen Musik-
- Quote paper
- Nicole Mühlhausen (Author), 2012, Unzuverlässige Erzählformen im US-amerikanischen Kino der Jahrtausendwende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200021