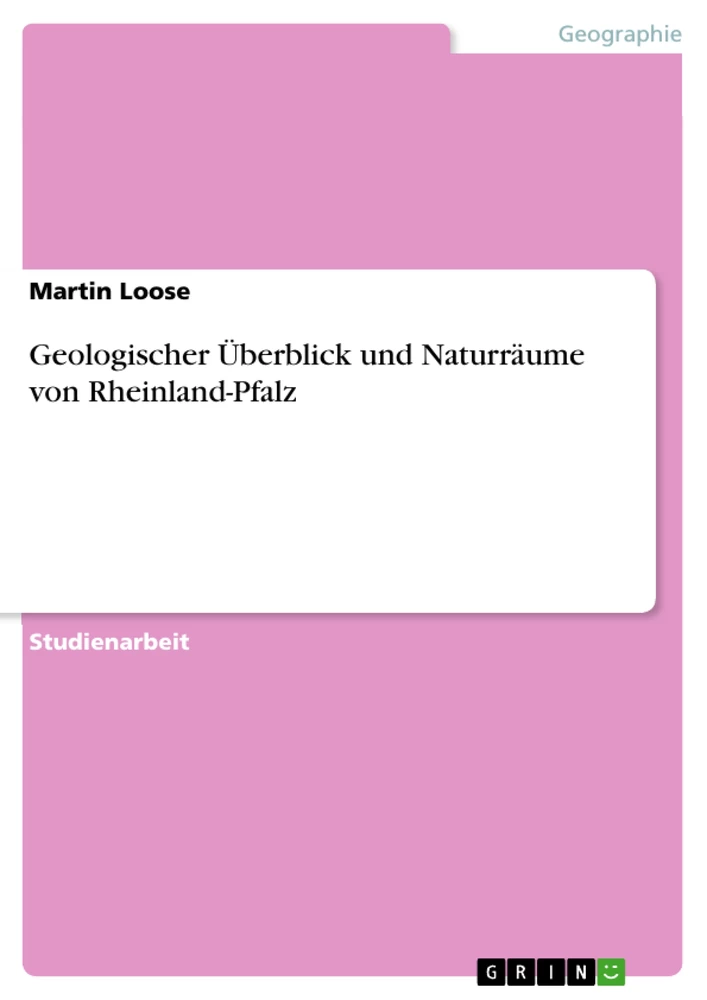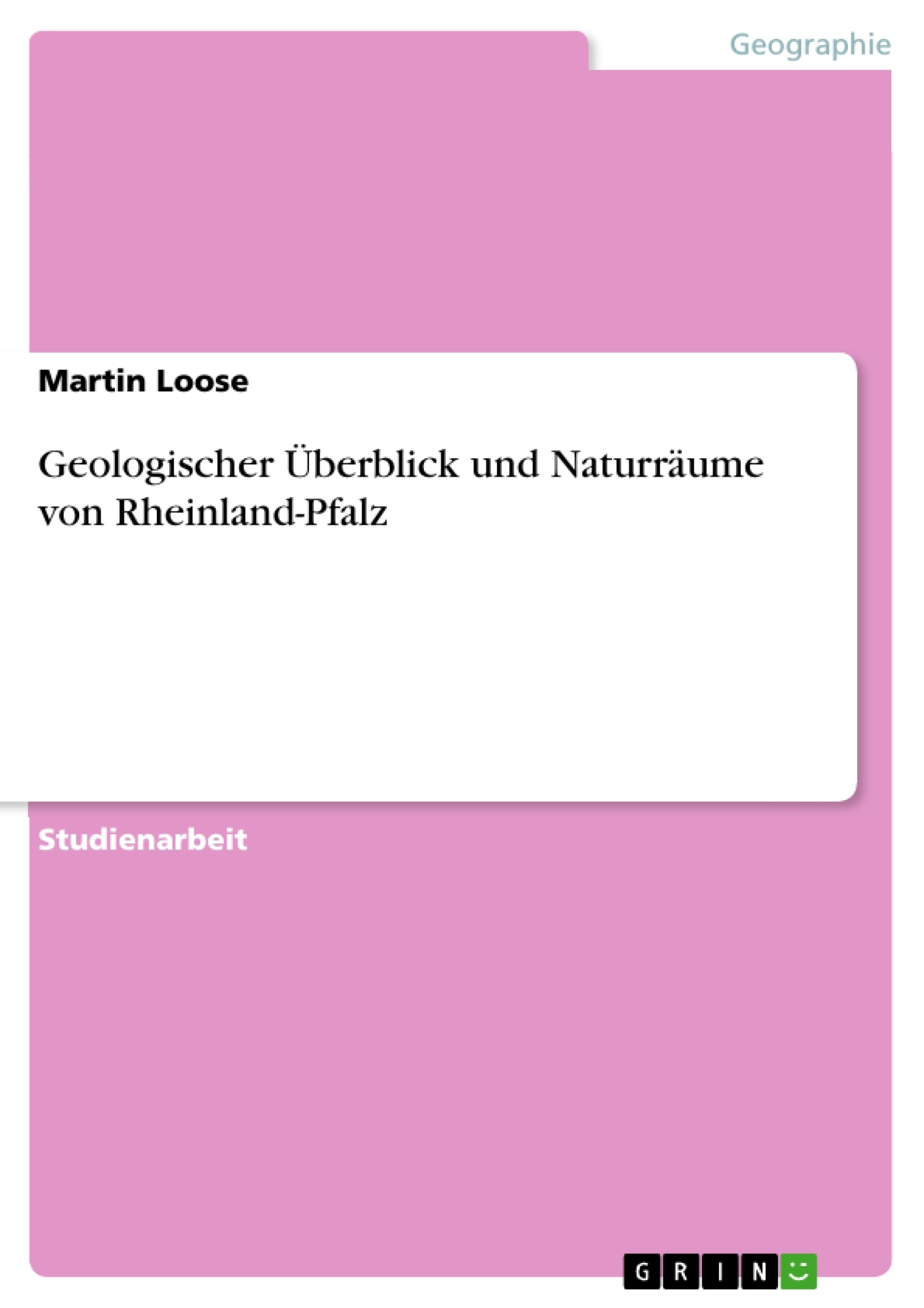In bündiger Schreibweise wird in die Geologie und in die naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz eingeführt. Die Ausarbeitung richtet sich an Studenten der Geographie sowie an geographisch interessierte Leser.
Geologischer Überblick und Naturräume
1 Geologischer Überblick
Betrachtet man die geologische Karte von Rheinland-Pfalz, so fallen der einheitlich gestaltete Norden und die scharfe Grenze zum uneinheitlichen Süden auf. Im Norden befindet sich das Rheinische Schiefergebirge, welches ein Bereich aus dem Rhenoherzynikum ist. Das Saxothuringikum, repräsentiert durch die Mitteldeutsche Kristallinschwelle, bildet den südlichen Landesteil, wobei die Grenze der Variskischen Gebirge an der Hunsrück-Taunus-Südrandstörung verläuft (Rothe 2006). Im rhenoherzynischen Ozean wurden zwischen Silur und Devon Sedimente gebildet. Mit der Schließung des rhenoherzynischen und des saxothuringischen Beckens im Oberdevon/Unterkarbon setzte die Variskische Faltung ein. Ab dem Oberkarbon wurde das Variskische Gebirge gehoben und es bildeten sich intermontane Becken wie die Wittlicher Senke und das Saar-Nahe-Becken (Steingötter 2005: 11).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Geologische Übersichtskarte von Rheinlandpfalz
(Norkowski 1995: 22)
1.1 Rheinisches Schiefergebirge
Das von Südwest nach Nordost streichende Rheinische Schiefergebirge wird in eine linksrheinische und eine rechtsrheinische Seite unterteilt, obwohl sich die geologischen Strukturen durchverfolgen lassen. Große Verbreitung haben Schiefer, Sandsteine und Quarzite als auch Massenkalke aus dem Devon (Henningsen 2007: 50).
Zum Landesgebiet von Rheinland-Pfalz gehört der Hintertaunus mit schwarzen Gesteinsserien des Hunsrückschiefers. Nördlich schließt sich das tertiäre Vulkangebiet des Westerwaldes an. Das unterdevonische Grundgebirge wird von Verwitterungsprodukten, hier von Tonen, und von überwiegend Basalten überlagert (Rothe 2006).
Neben dem Streifen metamorpher Gesteine am Südrand des Hunsrücks besteht das Gebirge zu großen Teilen aus sandigen und tonigen Gesteinen des Unterdevons. Die Taunuskamm-Überschiebung wird in der Überschiebung zwischen Hunsrück-Schuppenzone und Soonwald-Antiklinorium fortgesetzt. Die Wittlicher Rotliegendsenke ist Teil der Moselmulde. Im Untergrund der Senke verläuft die Fortsetzung der Bopparder Überschiebung, welche die Grenze zwischen Eifel und Hunsrück anzeigt (Rothe 2006).
Das Grundgebirge der Eifel ist ebenfalls durch sandiges und toniges Unterdevon bestimmt, wobei die gefalteten Schichten im Gegensatz zum Hunsrück nur gering geschiefert sind (Rothe 2006). Die Eifeler Nord-Süd-Zone ist eine Depression zwischen dem Stavelot-Venn-Antiklinorium und dem Osteifeler Hauptsattel. Sie besitzt verbreitet mitteldevonische Kalkmulden, die von Buntsandstein bedeckt sind. Die Trierer Bucht bildet den Südteil der Eifeler Nord-Süd-Zone. Sie ist mit mesozoischen Sedimenten verfüllt. Die vulkanische Aktivität der Eifel erstreckt sich in mehreren Phasen vom tertiären Vulkanismus in der Hocheifel bis zum quartären in West- und Osteifel (Walter 2007). Charakteristisch für das Quartär sind die wassergefüllten oder verlandeten Maare (Steingötter 2005: 14).
Das im tertiären Eozän gebildete Neuwieder Becken ist eine der größten Depressionen im Rheinischen Schiefergebirge. Die wahrscheinlich bis heute andauernde Absenkung wird durch limnische (im Süßwasser ablaufend) als auch durch marine Sedimente ausgeglichen (Rothe 2006: 53) (Gwinner 1979: 56).
1.2 Pfälzer Mulde und Saar-Nahe-Becken
Die Pfälzer Mulde und das Saar-Nahe-Becken sind Teil der Mitteldeutschen Kristallinschwelle.
Das variskische Grundgebirge der Pfälzer Mulde ist durch Sedimente verborgen und ist nur an wenigen Orten aufgeschlossen, da die linksrheinischen Gebiete am Oberrheingraben weniger gehoben wurden als die rechtsrheinischen. Daher beschränken sich die Aufschlüsse in der Pfalz auf einzelne Vorkommen am Ostrand des Pfälzer Waldes (Walter 2007: 224). Er besteht im Wesentlichen aus Unterem und Mittlerem Bundsandstein. Die nach Westen fallenden Schichten bilden ein Spiegelbild zur Süddeutschen Schichtstufenlandschaft (Rothe 2006: 138).
Das Saar-Nahe-Becken ist eine variskisch streichende jungpaläozoisch angelegte intramontane Senke. Der Binnentrog hat viele tausend Meter kontinentaler Sedimente aufgenommen (Walter 2007: 234). Über dem Devon und dem 4000m mächtigen Karbon liegen 3500m Rotliegend, in das Vulkanite eingeschaltet sind (Henningsen 2006: 89). Die Landschaft der Saar-Nahe-Mulde wird durch die Sedimente und Vulkanite der Rotliegendzeit bestimmt. Zwischen Unter- und Oberrotliegend bildeten sich Brüche und intermediäre als auch basische Magmen stiegen auf. Der so genannte Grenzlager-Vulkanismus war effusiv als auch intrusiv und führte zu einer großen Gesteinsvielfalt (Rothe 2006: 140ff).
[...]
- Quote paper
- Martin Loose (Author), 2008, Geologischer Überblick und Naturräume von Rheinland-Pfalz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199962