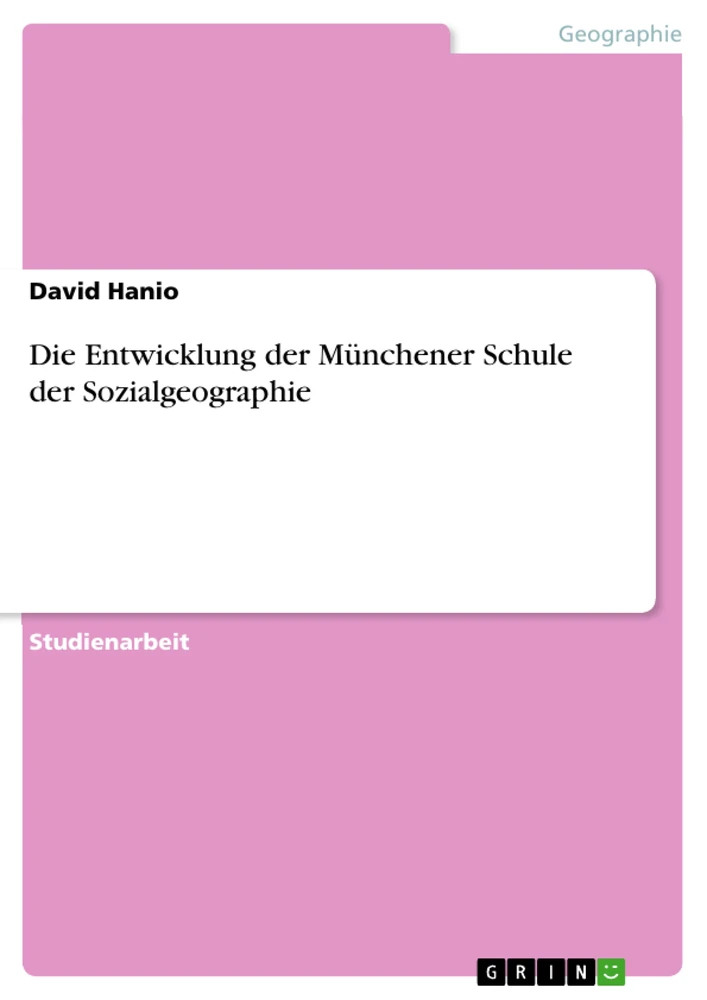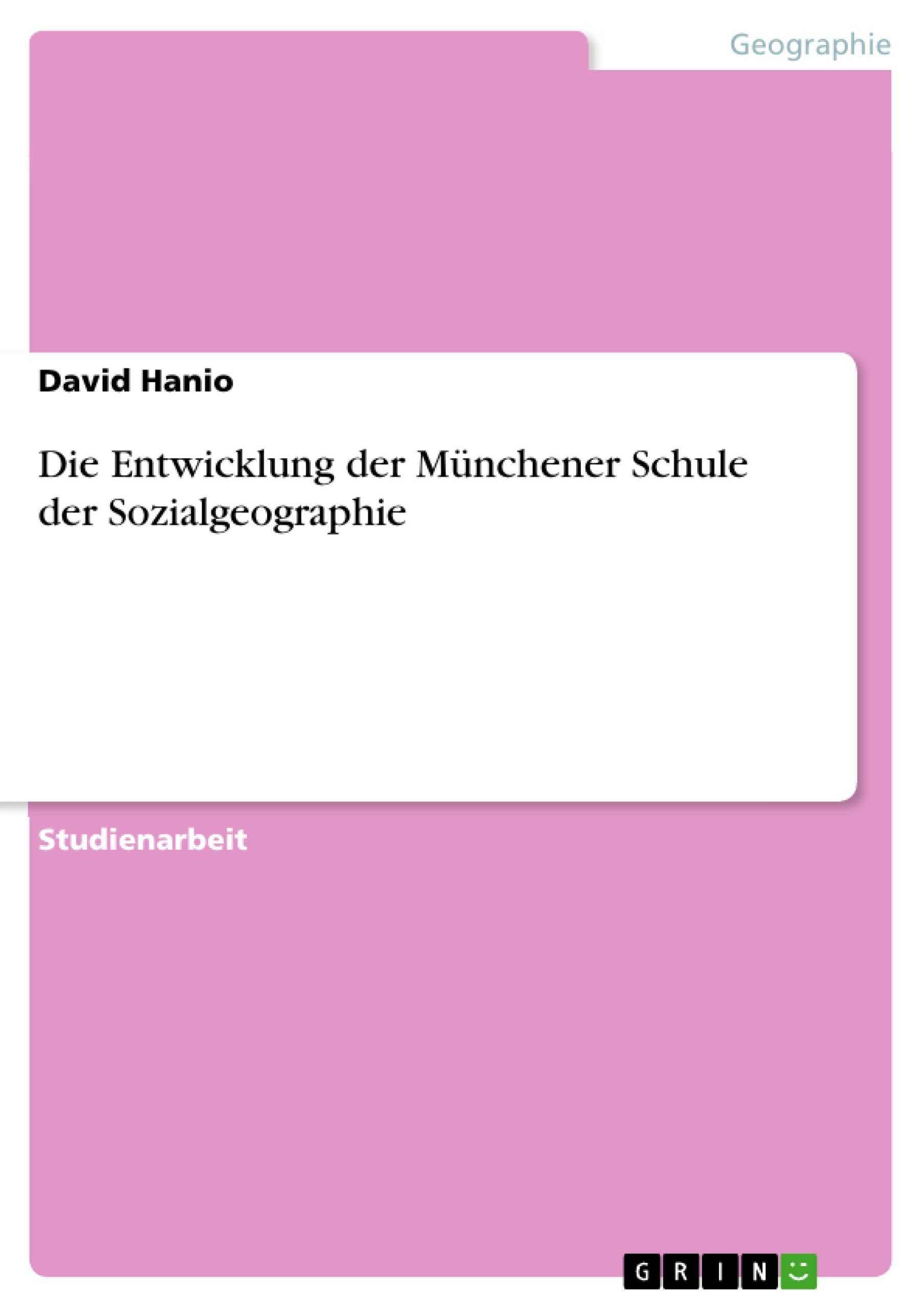In der folgenden Hausarbeit wird das Thema "Die Entwicklung der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie" thematisiert. Diese stellt eine Ausarbeitung des Referatsthemas „Daseinsgrundfunktionen der Münchener Schule“ dar. Allgemein lässt sich die „Münchener Schule“ als prägender Teil der Sozialgeographie in der Anthropogeographie beschreiben, die über Jahre hinweg die Strukturen der Wissenschaft beeinflusste. Ihren Ursprung hat die „Münchener Schule“ an dem sozialwissenschaftlichen geographischen Institut in München, wodurch sich die Sozialgeographie in der Humangeographie eingliederte und letztlich verankerte. Die Stadt München wurde circa ab 1952 das Zentrum der sozialgeographischen Forschung im deutschsprachigen Raum.
Als Grundgerüst der „Münchener Sozialgeographie“ ist der Funktionalismus zu betrachten, der im ersten Teil der Hausarbeit ausführlich bearbeitet wird. Dabei wird durch mich Bezug auf die ersten Entwicklungen in Richtung Sozialgeographie genommen und wichtige Akteure der Zeit vorgestellt. Darauffolgend wird das Hauptthema der Hausarbeit die Entwicklung der „Münchener Schule“ intensiv bearbeitet. Hierbei werden die ersten inhaltlichen Fakten zum historischen Kontext sowie der Zusammenhang zum Funktionalismus erläutert. Ebenfalls werden die genauen Ansichten von Ruppert, Schaffer, Paesler und Maier zur Sozialgeographie und deren Gruppenkonzept ausformuliert. Schließlich war der theoretische Ansatz von Ruppert, Maier, Paesler und Schaffer maßgeblich für die Entwicklung der Sozialgeographie innerhalb Deutschlands, der in von ihnen erschienenem Studienbuch niedergeschrieben ist.
Im nächsten Gliederungspunkt wird auf die Daseinsgrundfunktionen eingegangen, die als relevanter Inhalt der „Münchener Schule“ betrachtet werden muss. Anschließend wird die „Münchener Schule“ als wichtiges Konzept der heutigen Sozialgeographie und auf den Bezug der vorherigen Gliederungspunkte zusammengefasst. Zusätzlich erfolgt die Kritik an dem Konzept der „Münchener Schule“, die nach einigen Kritikern nicht ausführlich ausgearbeitet wurde und erhebliche Fehler aufweist. Am Ende der Hausarbeit erfolgt das Fazit, das die Ergebnisse der Hausarbeit bündelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Funktionalismus
- Die Entwicklung der „Münchener Schule“
- Die Daseinsgrundfunktionen
- Die „Münchener Schule“
- Die Kritik an dem Ansatz der „Münchener Schule“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie. Sie beschreibt die Entstehung und den Einfluss dieser Schule auf die sozialgeographische Forschung im deutschsprachigen Raum. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zum Funktionalismus und analysiert die Beiträge wichtiger Akteure.
- Der Einfluss des Funktionalismus auf die „Münchener Schule“
- Die Entwicklung der „Münchener Schule“ und ihre zentralen Konzepte
- Die Rolle der Daseinsgrundfunktionen in der „Münchener Schule“
- Wichtige Akteure und ihre Beiträge zur Sozialgeographie
- Kritik an dem Ansatz der „Münchener Schule“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, die Entwicklung der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie, und erläutert den Zusammenhang zum Referatsthema „Daseinsgrundfunktionen der Münchener Schule“. Sie beschreibt die „Münchener Schule“ als prägenden Teil der Sozialgeographie in der Anthropogeographie und ihren Ursprung am sozialwissenschaftlichen geographischen Institut in München ab ca. 1952. Die Arbeit skizziert die Struktur, beginnend mit dem Funktionalismus, der Entwicklung der „Münchener Schule“, den Daseinsgrundfunktionen, einer Zusammenfassung der „Münchener Schule“, der Kritik an ihrem Ansatz und schließlich dem Fazit.
Der Funktionalismus: Dieses Kapitel behandelt den Funktionalismus als Grundlage der „Münchener Sozialgeographie“. Es beginnt mit der „Charta von Athen“ (1942) als Manifest der modernen Städteplanung und beschreibt deren Ziel, mittelalterliche Stadtstrukturen an moderne Bedürfnisse anzupassen. Es werden zwei Ansätze der Wirtschaftsraumforschung diskutiert: die struktur-funktionale und die funktional-strukturelle Richtung. Letztere betont sozial-ökonomische Bedingungen und leitet die sozialgeographische Betrachtungsweise ein. Das Kapitel führt bedeutende Persönlichkeiten wie Emile Durkheim und Bronislaw Malinowski ein und diskutiert deren Beitrag zum funktionalistischen Denken. Der Einfluss von Wolfgang Hartke und Hans Bobek auf die Entwicklung der Sozialgeographie im deutschsprachigen Raum wird hervorgehoben, wobei Bobeks sechs Sozialfunktionen (biosoziale, oikosoziale, politische, toposoziale, migrosoziale und Kulturfunktion) als zentraler Aspekt seiner Arbeit dargestellt werden. Schließlich wird der Zusammenhang zwischen der funktionalen Stadtplanungstheorie und der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse im Kontext des Konflikts zwischen Privatinteressen und funktionellen Erfordernissen beleuchtet.
Die Entwicklung der „Münchener Schule“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der „Münchener Schule“ selbst, beginnend mit einem historischen Überblick und der Verbindung zum Funktionalismus. Es stellt die Ansichten von Ruppert, Schaffer, Paesler und Maier zur Sozialgeographie und deren Gruppenkonzept vor. Die Bedeutung ihres theoretischen Ansatzes für die Entwicklung der Sozialgeographie in Deutschland und ihre Niederschrift in einem Studienbuch wird hervorgehoben.
Die Daseinsgrundfunktionen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Daseinsgrundfunktionen als zentralen Bestandteil der „Münchener Schule“. Es beschreibt die Relevanz dieser Funktionen innerhalb des Gesamtkonzepts und stellt einen wichtigen inhaltlichen Aspekt der Schule dar. Die Diskussion der Daseinsgrundfunktionen erfolgt im Kontext der vorherigen Kapitel und bildet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der „Münchener Schule“.
Die „Münchener Schule“: Dieses Kapitel fasst die „Münchener Schule“ als wichtiges Konzept der heutigen Sozialgeographie zusammen. Es integriert die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel und liefert eine umfassende Betrachtung des Konzepts. Der Fokus liegt auf der Synthese der verschiedenen Aspekte und ihrer Bedeutung für das Verständnis der Sozialgeographie.
Die Kritik an dem Ansatz der „Münchener Schule“: Dieses Kapitel präsentiert die Kritik an der „Münchener Schule“, die von einigen Kritikern als unzureichend ausgearbeitet und fehlerhaft angesehen wird. Es beleuchtet die Schwachstellen und kontroversen Aspekte des Konzepts.
Schlüsselwörter
Münchener Schule, Sozialgeographie, Funktionalismus, Daseinsgrundfunktionen, Anthropogeographie, Stadtplanung, Wirtschaftsraumforschung, Hans Bobek, Wolfgang Hartke, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, Stadtstruktur, Raumforschung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die Münchener Schule der Sozialgeographie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung und den Einfluss der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie im deutschsprachigen Raum. Sie beleuchtet den Zusammenhang zum Funktionalismus und analysiert die Beiträge wichtiger Akteure. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Funktionalismus, zur Entwicklung der „Münchener Schule“, zu den Daseinsgrundfunktionen, eine Zusammenfassung der „Münchener Schule“, Kritikpunkte und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss des Funktionalismus auf die „Münchener Schule“, die Entwicklung der Schule und ihrer zentralen Konzepte, die Rolle der Daseinsgrundfunktionen, wichtige Akteure und deren Beiträge, sowie die Kritik an dem Ansatz der „Münchener Schule“.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Der Funktionalismus, Die Entwicklung der „Münchener Schule“, Die Daseinsgrundfunktionen, Die „Münchener Schule“, Die Kritik an dem Ansatz der „Münchener Schule“ und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der „Münchener Schule“ und ihren Kontext.
Was ist der Funktionalismus im Kontext der „Münchener Schule“?
Das Kapitel „Der Funktionalismus“ beschreibt den Funktionalismus als Grundlage der „Münchener Sozialgeographie“. Es beleuchtet die „Charta von Athen“, diskutiert Ansätze der Wirtschaftsraumforschung (struktur-funktional und funktional-strukturell) und den Einfluss von Persönlichkeiten wie Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, Wolfgang Hartke und Hans Bobek (mit seinen sechs Sozialfunktionen). Der Zusammenhang zwischen funktionaler Stadtplanung und der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wird ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielen die Daseinsgrundfunktionen?
Die Daseinsgrundfunktionen werden als zentraler Bestandteil der „Münchener Schule“ dargestellt. Das Kapitel beschreibt ihre Relevanz im Gesamtkonzept und ihren Beitrag zum Verständnis der Schule.
Wer sind die wichtigsten Akteure der „Münchener Schule“?
Die Arbeit erwähnt wichtige Akteure wie Ruppert, Schaffer, Paesler und Maier und deren Beitrag zur Entwicklung der Sozialgeographie und dem Gruppenkonzept der „Münchener Schule“. Der Einfluss von Hartke und Bobek im Kontext des Funktionalismus wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Kritikpunkte werden an der „Münchener Schule“ geäußert?
Die Hausarbeit widmet ein Kapitel der Kritik an der „Münchener Schule“, die von manchen als unzureichend ausgearbeitet oder fehlerhaft angesehen wird. Konkrete Schwachstellen und kontroverse Aspekte des Konzepts werden beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Münchener Schule, Sozialgeographie, Funktionalismus, Daseinsgrundfunktionen, Anthropogeographie, Stadtplanung, Wirtschaftsraumforschung, Hans Bobek, Wolfgang Hartke, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, Stadtstruktur, Raumforschung.
- Quote paper
- David Hanio (Author), 2010, Die Entwicklung der Münchener Schule der Sozialgeographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199943