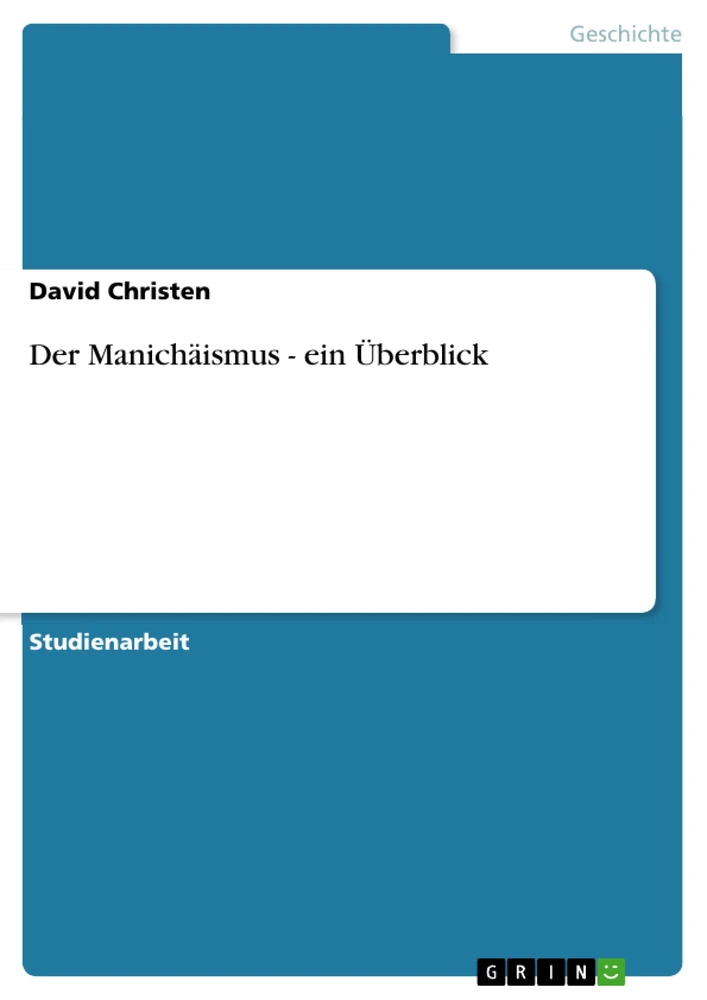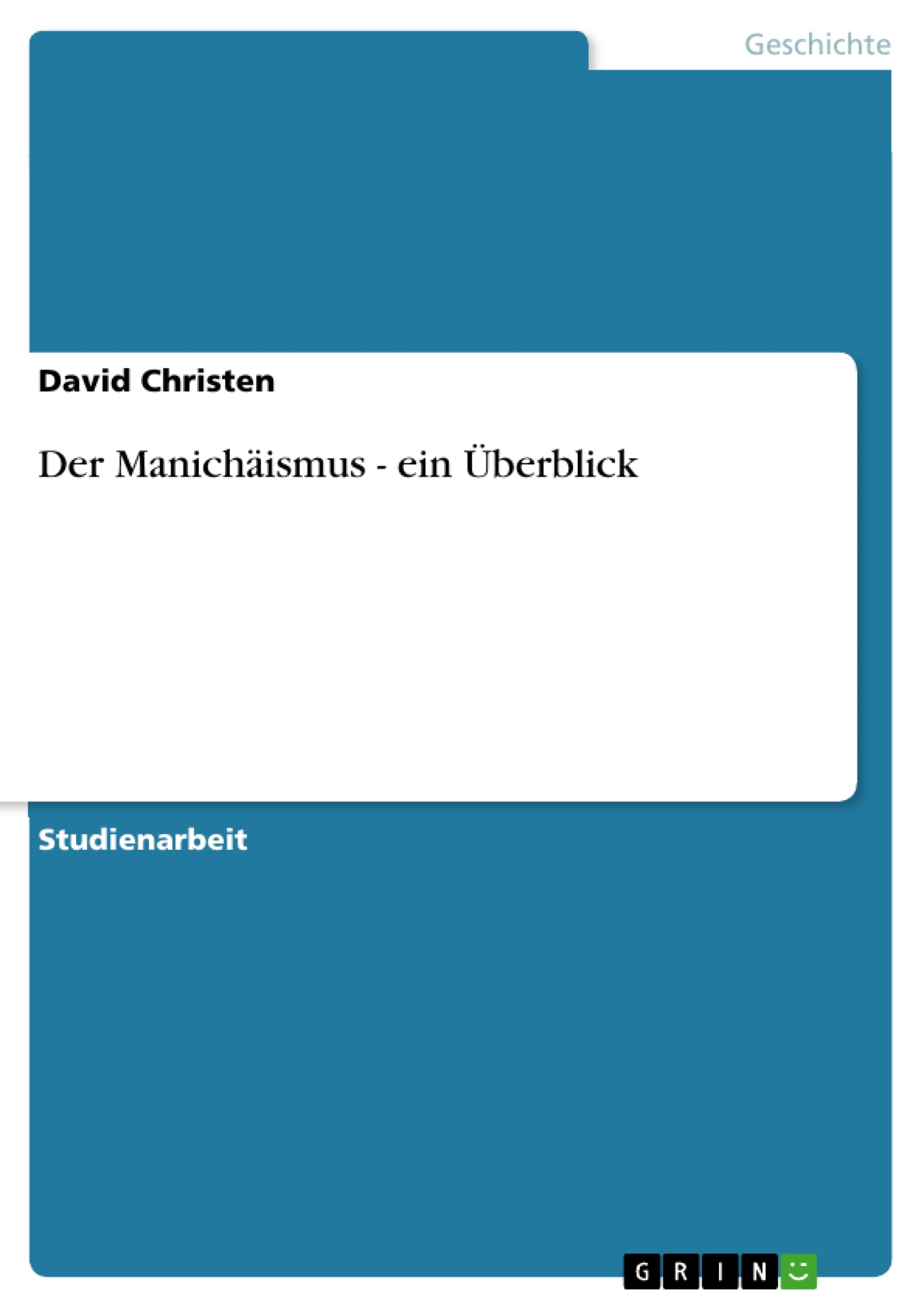„Die Religion, die ich erwählt habe, ist in zehn Dingen viel besser als die anderen, früheren Religionen. Erstens: [...] meine Religion ist in jedem Lande und in allen Sprachen bekannt und wird in den fernsten Ländern gelehrt.“
Mani hat also bewusst versucht eine Religion zu begründen, die sich von den bestehenden Religionen dadurch unterscheidet, dass sie in verschiedenen Sprachen und Regionen gelehrt werden konnte. Seine Idee war, aus verschiedenen Elementen der zu der Zeit verbreiteten Religionen eine neue, bessere Religion zu kreieren, die alle Anhänger der anderen Religionen anspricht und diese als neue Weltreligion ersetzen kann. Dieser synkretistische Ansatz hat auch über eine gewisse Zeitspanne funktioniert, was man an der grossen Verbreitung ablesen kann, allerdings nicht überdauert. Schlussendlich wurde die Stärke der Religion zur Schwäche und trug zum Untergang bei.
Bei der Untersuchung einer ausgestorbenen Weltreligion stellen sich viele interessante Fragen. Was braucht eine Religion, um eine so grosse geographische Verbreitung, von Westeuropa über Nordafrika und Arabien bis nach China, zu erfahren, und was fehlt einer Religion, so dass sie schlussendlich wieder verschwindet? Und zwar so sehr, dass sich heute kaum jemand unter dem Begriff Manichäismus etwas vorstellen kann. Natürlich trägt unsere christlich geprägte Kultur und Geschichtsschreibung dazu bei, dass die von dem Christentum „besiegten“ Religionen nicht im Zentrum des Interesses stehen. Dass diese Religion an so vielen Orten bekämpft und verboten wurde, zeigt die Bedeutung, die sie einmal hatte und vor allem die Gefahr, die sie für andere Religionen darstellte. Deshalb ist sie es auch auf jeden Fall wert, sich mit ihr zu befassen.
Diese Arbeit versucht im folgenden einen Überblick über die Religion und deren Verbreitung und Untergang zu geben. Ausserdem wird sie in den grösseren Zusammenhang der Gnosis gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Quellen über den Manichäismus
- 2. Die Gnosis
- 2.1. Der Begriff
- 2.2. Eine Definition
- 3. Der Religionsstifter Mani
- 4. Die Lehre Manis
- 4.1. Der Schöpfungsmythos
- 4.2. Die manichäische Kirche
- 4.3. Lebenspraxis und Kult
- 4.4. Die manichäischen Schriften
- 5. Verbreitung und Untergang
- 5.1. Mission
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über den Manichäismus, eine ausgestorbene Weltreligion. Sie untersucht die Faktoren, die zu seiner weiten Verbreitung und seinem späteren Untergang führten. Dabei wird der Manichäismus in den Kontext der Gnosis eingeordnet.
- Die Quellenlage zum Manichäismus
- Der Manichäismus im Kontext der Gnosis
- Die Lehre Manis und ihr synkretistischer Charakter
- Die Verbreitung des Manichäismus
- Die Gründe für den Untergang des Manichäismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Manichäismus ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Faktoren, die sowohl zur weiten Verbreitung als auch zum Untergang dieser Religion beitrugen. Mani's bewusster Versuch, eine Religion zu schaffen, die verschiedene Sprachen und Regionen umfasste, wird als synkretistischer Ansatz hervorgehoben, der zwar zunächst erfolgreich war, letztendlich aber auch zum Untergang beitrug. Die Arbeit kündigt eine umfassende Darstellung der Religion, ihrer Verbreitung und ihres Untergangs an, eingebettet in den größeren Kontext der Gnosis.
1.1. Quellen über den Manichäismus: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Herausforderungen der Quellenlage für die Erforschung des Manichäismus. Er beschreibt die Abhängigkeit von christlichen Kampfschriften (Augustin wird als besonders kenntnisreiche Quelle hervorgehoben), syrischen Quellen und islamischen Berichten. Der Abschnitt hebt die Bedeutung des Fundes eines griechischen manichäischen Kodex in Köln hervor, der die Forschung maßgeblich bereichert hat.
2. Die Gnosis: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Begriff der Gnosis, der in der Antike und der heutigen Forschung unterschiedlich definiert wird. Es erläutert die Bedeutung von Gnosis als Erkenntnis in philosophisch-religiösen Kontexten und deren Rolle in verschiedenen Traditionen (griechische Philosophie, Judentum). Der Abschnitt hebt die elitäre Natur der Gnostischen Erkenntnis hervor und diskutiert die zunehmende Komplexität der Definition des Begriffs im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Christentums und seiner Verwendung in modernen Strömungen.
2.2. Eine Definition: Aufbauend auf der vorherigen Diskussion, wird hier ein Definitionsmodell der Gnosis nach Christoph Markschies vorgestellt, bestehend aus acht Kriterien. Diese Kriterien umfassen Aspekte wie die Erfahrung eines fernen Gottes, die Welt als böse Schöpfung, einen Demiurgen, ein mythologisches Drama der Weltschöpfung, die Erlösung durch Gnosis und den Dualismus. Der Manichäismus wird als Religion identifiziert, die all diese Kriterien erfüllt.
Schlüsselwörter
Manichäismus, Gnosis, Mani, Religion, Weltreligion, Verbreitung, Untergang, Synkretismus, Quellen, Christentum, Islam, Sprachen, Regionen, Mythos, Dualismus, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Manichäismus
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über den Manichäismus, eine ausgestorbene Weltreligion. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Faktoren, die zur Verbreitung und zum Untergang des Manichäismus führten, wobei der Kontext der Gnosis berücksichtigt wird.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Kernbereiche: Die Quellenlage des Manichäismus (mit Herausforderungen und wichtigen Funden), den Manichäismus im Kontext der Gnosis (inkl. Definition und Kriterien), die Lehre Manis (Schöpfungsmythos, Kirche, Lebenspraxis, Schriften), die Verbreitung und der Untergang des Manichäismus, sowie Mani's synkretistischen Ansatz.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert in Einleitung, Kapitel über die Gnosis, Mani, seine Lehre und die Verbreitung/den Untergang des Manichäismus, sowie einen Schluss. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Es werden die Herausforderungen der Quellenlage (christliche Kampfschriften, syrische und islamische Quellen, der Kölner Kodex) und ein Definitionsmodell der Gnosis nach Christoph Markschies (acht Kriterien) vorgestellt.
Welche Quellen werden für die Erforschung des Manichäismus verwendet?
Die Erforschung des Manichäismus stützt sich auf diverse Quellen, darunter christliche Kampfschriften (Augustin als wichtige Quelle), syrische Texte und islamische Berichte. Der Fund eines griechischen manichäischen Kodex in Köln wird als besonders bedeutsam hervorgehoben.
Wie wird die Gnosis im Text definiert?
Der Text beschreibt die Gnosis als einen vielschichtigen Begriff mit unterschiedlichen Definitionen in der Antike und der modernen Forschung. Es wird ein Definitionsmodell nach Christoph Markschies präsentiert, welches acht Kriterien umfasst, darunter die Erfahrung eines fernen Gottes, die Welt als böse Schöpfung, ein Demiurg, ein mythologisches Weltschöpfungsdrama, Erlösung durch Gnosis und Dualismus. Der Manichäismus wird als Religion identifiziert, die all diese Kriterien erfüllt.
Was waren die Gründe für den Untergang des Manichäismus?
Der Text untersucht die Faktoren, die zum Untergang des Manichäismus beitrugen. Mani's synkretistischer Ansatz, der zunächst zur weiten Verbreitung beitrug, wird als ein möglicher Faktor genannt, jedoch werden weitere Gründe nicht explizit benannt. Dies ist ein Thema, welches im Text weiter untersucht werden müsste.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Manichäismus, Gnosis, Mani, Religion, Weltreligion, Verbreitung, Untergang, Synkretismus, Quellen, Christentum, Islam, Sprachen, Regionen, Mythos, Dualismus, Geschichte.
- Quote paper
- David Christen (Author), 2010, Der Manichäismus - ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199425