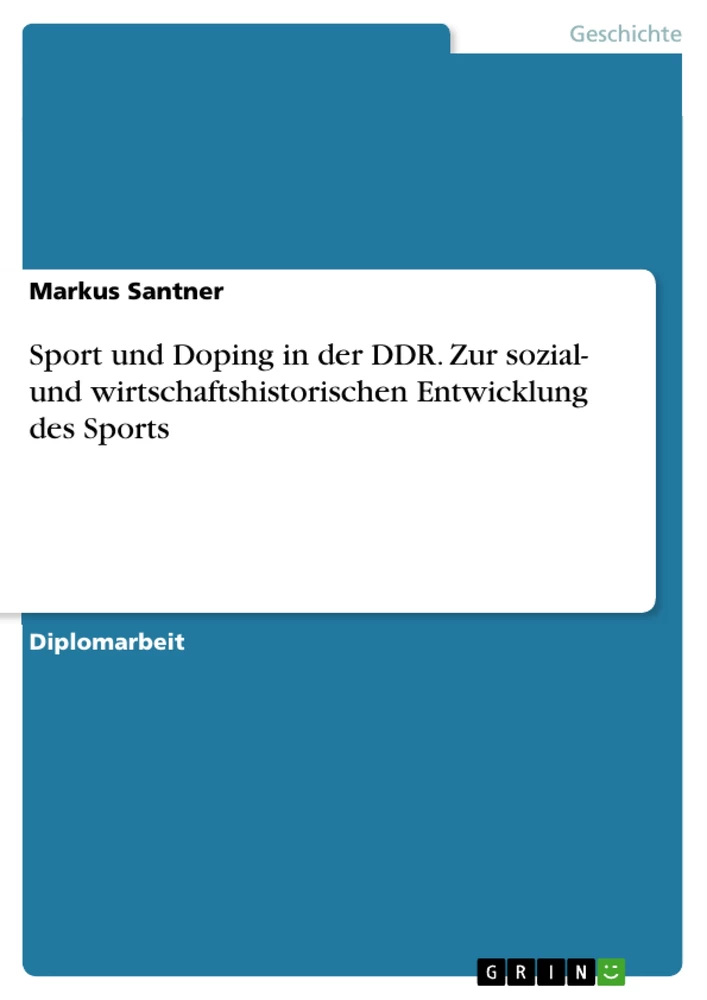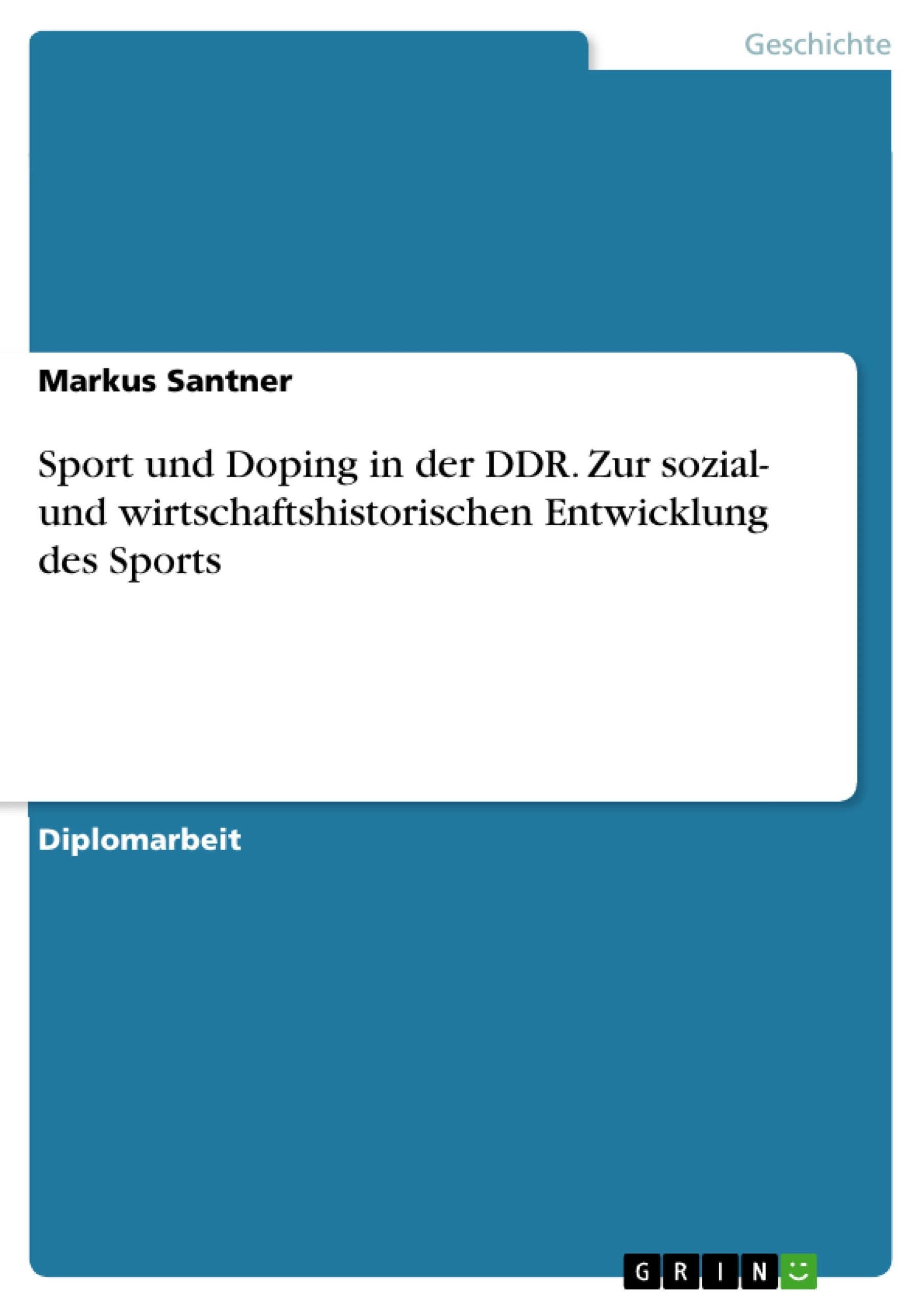Ziel dieser Arbeit ist es, das staatlich organisierte Doping in der Deutschen Demokratischen Republik aufzuzeigen. Dass die Leistungssportler in der DDR bei internationalen Wettkämpfen gedopt waren, ist unbestritten. Nach der Wende wurde dieses Thema umfassend aufgearbeitet.
Der Sport genoss in der DDR hohe Wertschätzung, sowohl in der Bevölkerung wie auch unter den Regierenden. Der Breitensport wurde im Sozialismus auf staatlicher Ebene organisiert und wurde durch Schulen, Betriebe und Massenorganisationen erheblich gefördert. Sport galt als Quelle und Ausdruck eines positiven Lebensgefühls.
Der Leistungssport in der DDR hatte von Anfang an einen klaren Auftrag. Die internationale Anerkennung der DDR sollte vorangetrieben werden und der Alleinvertretungsanspruch der BRD untergraben werden. Das Verhältnis der DDR zu den Olympischen Spielen war von Anfang an durch politische Ambitionen der Staats- und Parteiführung geprägt. In kaum einem anderen Land waren Sport und Politik so eng verflochten wie in der DDR.
Die Gründe für die Erfolge waren vielfältiger Natur. Die systematische Talentsichtung kann als Eckpfeiler für die DDR-Sporterfolge angesehen werden. Der Einsatz von sogenannten „Unerlaubten Mitteln“ zur Leistungssteigerung, die Wirksamkeit dieser Präparate ist unbestritten, ist eine weitere Säule der DDR-Sporterfolge.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zielsetzung der Arbeit
- 3 Die Funktion der Sozialistischen Einheitspartei (SED)
- 3.1 Die Leistungssportbeschlüsse des Politbüros der SED
- 3.2 Verlautbarungen der Leistungssportbeschlüsse
- 4 Die Gründung des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport
- 5 Der Deutsche Turn- und Sportbund (DTSB)
- 6 Die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK)
- 6.1 Das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS)
- 6.2 Der Sportmedizinische Dienst (SMD)
- 7 Talentsichtung
- 7.1 Kreis- sowie Bezirksspartakiaden
- 7.2 Die drei Kaderstufen
- 7.3 Die drei Förderstufen
- 8 Der Einsatz von sogenannten UM (Unerlaubte Mittel) zur Leistungssteigerung im Rahmen des Staatsplanthemas 14.25 und deren Auswirkungen
- 8.1 Die Definition von Doping
- 8.2 Verabreichung der UM an Minderjährige
- 8.3 Das Dopinglabor in Kreischa
- 8.4 Körperliche Schäden an Sportlern durch Einsatz von UM
- 9 Das Ministerium für Staatssicherheit im DDR-Sport
- 10 Die Finanzierung
- 11 Interview mit einer Zeitzeugin
- 12 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die sozial- und wirtschaftshistorische Entwicklung des Sports in der DDR, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Dopings. Die Arbeit zielt darauf ab, die Verflechtung von Politik, Sport und Doping aufzuzeigen und die Auswirkungen auf Sportler zu analysieren.
- Die Rolle der SED im DDR-Sport
- Die Organisation und Finanzierung des DDR-Sportsystems
- Der systematische Einsatz von Dopingmitteln
- Die Talentsichtung und -förderung im DDR-Sport
- Die gesundheitlichen Folgen des Dopings für Sportler
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des zerstörten Nachkriegsdeutschland und die Entstehung der DDR, um den historischen Hintergrund für die Entwicklung des Sports im sozialistischen System zu liefern. Sie legt die Grundlage für das Verständnis der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, welche den DDR-Sport prägten und den systematischen Dopinggebrauch ermöglichten. Die Erwähnung der hohen Opferzahlen des Zweiten Weltkriegs betont die allgemeine Notlage und den Wunsch nach nationalen Erfolgen im Sport als Mittel der Propaganda.
3 Die Funktion der Sozialistischen Einheitspartei (SED): Dieses Kapitel beleuchtet die zentrale Rolle der SED in der Steuerung und Kontrolle des DDR-Sports. Es analysiert die Leistungssportbeschlüsse des Politbüros und deren Einfluss auf die Organisation und Finanzierung des Sports. Die Kapitel untersuchen, wie die SED den Sport als Instrument der Propaganda und zur Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins nutzte, und wie diese politische Instrumentalisierung den Weg für den systematischen Dopingmissbrauch ebnete. Die Analyse der Verlautbarungen der Beschlüsse verdeutlicht die politische Durchdringung des Sportsystems.
4 Die Gründung des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport: Die Gründung dieses Komitees wird hier als wichtiger Schritt in der Zentralisierung und Kontrolle des DDR-Sports dargestellt. Das Kapitel wird die Struktur und die Aufgaben des Komitees analysieren und dessen Beitrag zur Planung und Umsetzung der sportpolitischen Ziele der SED beleuchten. Es wird die Rolle des Komitees bei der Organisation von Sportveranstaltungen und der Förderung von Leistungssportlern untersuchen, sowie seinen Einfluss auf die Entwicklung des Dopingsystems.
5 Der Deutsche Turn- und Sportbund (DTSB): Dieses Kapitel behandelt den DTSB als zentrale Organisation des Sports in der DDR. Es analysiert die Struktur und Funktion des DTSB und seine Beziehung zur SED und dem Staatlichen Komitee für Körperkultur und Sport. Die Untersuchung umfasst die Rolle des DTSB bei der Umsetzung der sportpolitischen Ziele, die Organisation von Sportwettbewerben und die Rekrutierung und Förderung von Talenten. Die Analyse wird aufzeigen, wie der DTSB zum systematischen Doping beitrug und die Kontrolle über den Sport sicherstellte.
6 Die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die DHfK und ihre Bedeutung für die Ausbildung von Sportlern und Trainern. Die Analyse umfasst die Forschungsarbeit des Instituts für Körperkultur und Sport (FKS) und die Rolle des Sportmedizinischen Dienstes (SMD). Es wird untersucht, wie die DHfK zum wissenschaftlichen Fortschritt im Dopingbereich beitrug und die Entwicklung und Anwendung von Dopingmethoden unterstützte. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von Wissenschaft, Sport und Politik.
7 Talentsichtung: Dieses Kapitel beschreibt die systematische Talentsichtung und -förderung im DDR-Sport. Es analysiert die verschiedenen Stufen der Kader- und Förderstrukturen und untersucht die Methoden der Auswahl und Ausbildung von jungen Sportlern. Die Analyse wird aufzeigen, wie frühzeitig Kinder und Jugendliche in das System eingebunden wurden und wie der Druck zur Leistungssteigerung die Akzeptanz und den Gebrauch von Dopingmitteln begünstigte. Die Kapitel behandelt Kreis- und Bezirksspartakiaden als wichtige Elemente im Auswahlprozess.
8 Der Einsatz von sogenannten UM (Unerlaubte Mittel) zur Leistungssteigerung: Dieses Kapitel analysiert den systematischen Einsatz von Dopingmitteln im DDR-Sport im Kontext des Staatsplanthemas 14.25. Es untersucht die Definition von Doping in der DDR und die Methoden der Verabreichung von unerlaubten Mitteln, insbesondere an Minderjährige. Die Analyse des Dopinglabors in Kreischa und die körperlichen Schäden, die durch den Dopinggebrauch entstanden sind, werden detailliert dargestellt. Das Kapitel zeigt auf, wie der staatlich gelenkte Dopingmissbrauch die Gesundheit der Sportler gefährdete.
Schlüsselwörter
DDR-Sport, Doping, SED, Leistungssport, Staatsplanthema 14.25, Talentsichtung, Sportmedizin, Staatliche Kontrolle, Propaganda, Gesundheitsschäden, Zeitzeugenbericht.
FAQ: DDR-Sport und Doping – Eine sozial- und wirtschaftshistorische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die sozial- und wirtschaftshistorische Entwicklung des Sports in der DDR, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Dopings. Sie analysiert die Verflechtung von Politik, Sport und Doping und deren Auswirkungen auf Sportler.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der SED im DDR-Sport, die Organisation und Finanzierung des DDR-Sportsystems, den systematischen Einsatz von Dopingmitteln, die Talentsichtung und -förderung, sowie die gesundheitlichen Folgen des Dopings für Sportler. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Staatsplanthema 14.25 und dem Dopinglabor in Kreischa.
Welche Institutionen spielen eine Rolle?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport, des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB), der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK) mit ihrem Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS) und dem Sportmedizinischen Dienst (SMD), sowie des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).
Wie war die Talentsichtung und -förderung organisiert?
Die Talentsichtung erfolgte systematisch über Kreis- und Bezirksspartakiaden und umfasste drei Kader- und drei Förderstufen. Kinder und Jugendliche wurden frühzeitig in das System eingebunden, was den Druck zur Leistungssteigerung und die Akzeptanz von Doping begünstigte.
Welche Rolle spielte Doping im DDR-Sport?
Doping wurde systematisch eingesetzt, insbesondere im Rahmen des Staatsplanthemas 14.25. Die Arbeit analysiert die Definition von Doping in der DDR, die Verabreichung unerlaubter Mittel (UM) an Minderjährige, die Aktivitäten des Dopinglabors in Kreischa und die daraus resultierenden gesundheitlichen Schäden bei Sportlern.
Wie war der DDR-Sport finanziert?
Die Arbeit beleuchtet die Finanzierung des DDR-Sports, die eng mit der politischen Steuerung durch die SED verknüpft war. Konkrete Details zur Finanzierung werden im Kapitel 10 näher erläutert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf verschiedenen Quellen, darunter die Analyse von Leistungssportbeschlüssen des Politbüros der SED, Verlautbarungen, sowie einem Zeitzeugeninterview (Kapitel 11). Weitere Quellen werden im Text benannt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zielsetzung der Arbeit, Die Funktion der SED, Gründung des Staatlichen Komitees, Der DTSB, Die DHfK (inkl. FKS und SMD), Talentsichtung, Einsatz von unerlaubten Mitteln (UM), Das MfS im DDR-Sport, Finanzierung, Interview mit einer Zeitzeugin und Resümee.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Resümee (Kapitel 12) fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse für das Verständnis der Geschichte des DDR-Sports und der Auswirkungen des staatlich gelenkten Dopings.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Diplomarbeit (genaue Quelle wird hier nicht angegeben, da es sich um exemplarische Daten handelt).
- Quote paper
- Mag. Markus Santner (Author), 2010, Sport und Doping in der DDR. Zur sozial- und wirtschaftshistorischen Entwicklung des Sports, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199384