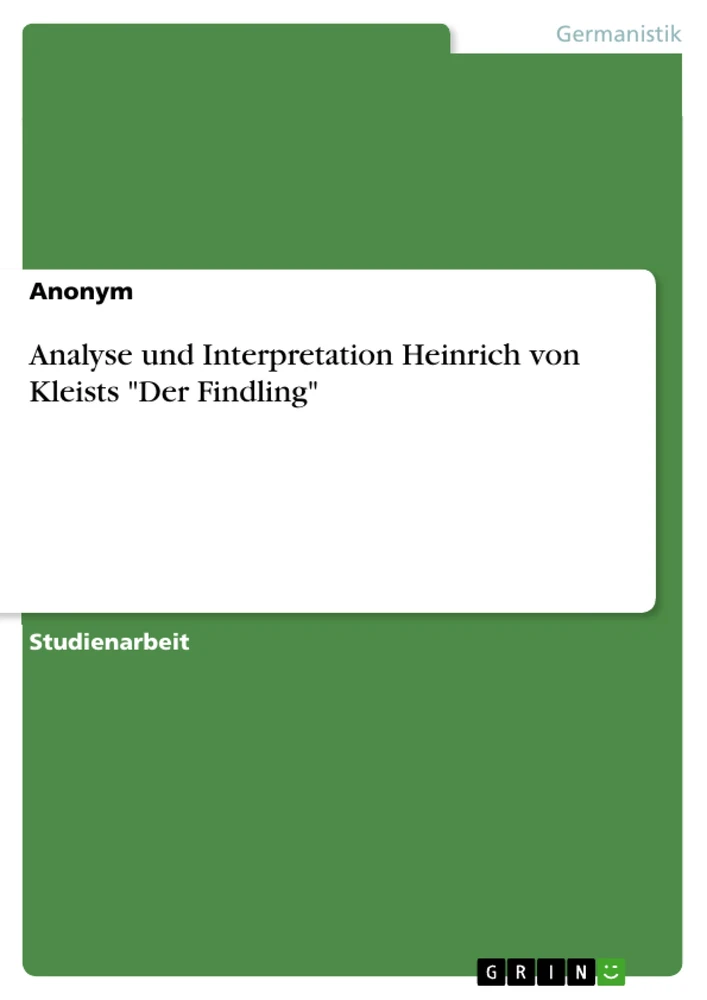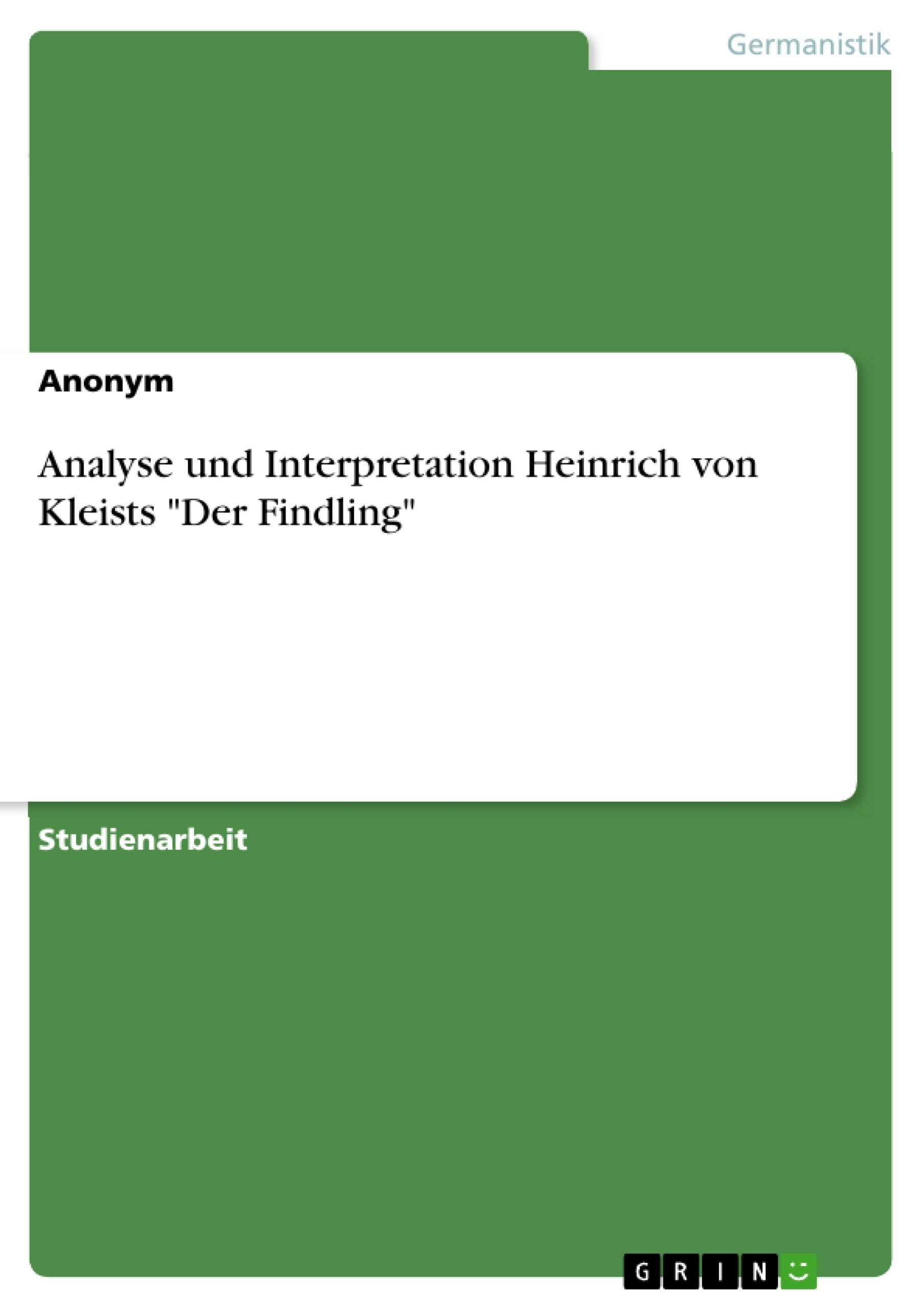Der Verlauf der Handlung in Heinrich von Kleists Novelle „Der Findling“ dürfte bei den meisten Lesern zunächst für einen Schock sorgen. Anstatt sich sei- nen Adoptiveltern gegenüber loyal und dankbar zu zeigen, sorgt die Hauptfi- gur Nicolo innerhalb der Familie Piachi so lange für Tod und Verzweiflung, bis am Ende nur noch der ,alte Piachi‘ lebt und schließlich einen Mord begeht, wofür er die Todesstrafe erhält. Fühlt man sich also am Ende der Novelle, wenn dieser seinen Sohn umbringt und sich von der Kirche abwendet, eher mit ihm verbunden, so ist dies nicht weiter verwunderlich.
Doch was passiert, wenn man den Text anschließend mit etwas Abstand nochmals genauer liest? Bleibt der Eindruck, dass nur Nicolo die Schuld am Handlungsverlauf trägt, oder trifft die Familienmitglieder der Piachis gar ein gewisser Grad der Mitschuld?
Lange Zeit war nicht zuletzt der auktoriale Erzähler selbst das Problem, wel- ches bei den Interpretationsansätzen der Rezipienten für Verwirrung sorgte. Die Erzählweise, welche die Novelle vor allem als Bewährungsprobe der gu- ten Piachis vor dem Wirken des „absolut Bösen“1, vertreten durch Adoptiv- sohn Nicolo, darzustellen schien, erschwerte es lange Zeit, den Kern der No- velle aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Erst als in den siebziger Jahren Einigkeit darüber herrschte, dass „Der Find- ling“ obgleich der Meinung, dass es ein sehr frühes, daher unausgereiftes Werk Kleists gewesen sein muss, historisch korrekt eingeordnet werden konnte, und auf Kleists Todesjahr 1811 datiert wurde, begann man, den Text ,anders‘ zu lesen. Fragen nach der Bösartigkeit Piachis, der Bedeutung der Kirche im Findling, der Mitschuld der Kirche am tragischen Ende und das kri- tische Betrachtung vergangener Textauslegungen führten schließlich dazu, dass das Werk Kleists langsam mit einer völlig anderen Sichtweise betrach- tet wurde. Durch die Hinzuziehung von Briefen Kleists, die in dieser Arbeit noch thematisiert werden sollen, klarten die zunächst unsichtbaren Hinter- gründe des „Findlings“ langsam auf und wurden fassbarer. Die Frage, inwie- fern Kleists eigenes Leben und seine Psyche in die Deutung des Findlings einfließen können, soll Ziel dieser Arbeit sein. Ferner soll der Versuch unter- nommen werden, die Novelle einzuordnen und die Familienstrukturen, sowie die Schuldfrage im „Findling“ zu behandeln.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Heinrich von Kleist
- 1. Familiäre Hintergründe
- 2. Kleists Weltbild
- III. Der Findling
- 1. Einordnung und Inhalt der Novelle
- 2. Familiäre Strukturen und Kommunikation
- 3. Charakter und Leben des Nicolo
- 4. Die Schuldfrage im Findling
- IV. Schlusswort
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich von Kleists Novelle „Der Findling“ und zielt darauf ab, die Handlung, die Charaktere und die zugrundeliegenden Themen zu analysieren. Besonders im Fokus steht die Frage nach der Schuldzuweisung im Kontext der familiären Strukturen und der Darstellung des Bösen. Die Arbeit berücksichtigt auch Kleists Biografie und sein Weltbild, um einen umfassenderen Interpretationsansatz zu ermöglichen.
- Die Rolle der Familie und familiärer Beziehungen in der Handlung
- Die Darstellung des Bösen und die Frage nach Schuld und Verantwortung
- Der Einfluss von Kleists Biografie und Weltanschauung auf die Novelle
- Die Interpretation der Erzählperspektive und ihrer Wirkung
- Die Einordnung der Novelle in das Werk Kleists
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert den anfänglichen Schockeffekt der Handlung des „Findlings“, in der der Adoptivsohn Nicolo für Tod und Verderben in der Familie Piachi sorgt. Sie stellt die zentrale Frage nach der Schuldzuweisung – liegt diese allein bei Nicolo oder tragen auch die Piachis eine Mitschuld? Die Einleitung verweist auf die Schwierigkeiten früherer Interpretationen aufgrund der auktorialen Erzählweise und erwähnt die veränderte Lesart der Novelle seit den 1970er Jahren, die eine kritischere Auseinandersetzung mit den Figuren und den Hintergründen ermöglicht.
II. Heinrich von Kleist: Dieses Kapitel beleuchtet die biographischen Hintergründe Heinrich von Kleists. Es beschreibt seine Herkunft aus einer angesehenen Familie des pommerschen Uradels, seine frühe Bildung, seine Militärzeit und sein Studium. Der Fokus liegt auf den Brüchen in Kleists Leben, dem Konflikt zwischen seinen familiären Verpflichtungen und seinem Wunsch nach freier geistiger Bildung und künstlerischer Entfaltung. Seine Reise nach Frankreich und die dort erfahrenen Enttäuschungen, die zu einer tiefen Krise und einem psychischen Zusammenbruch führten, werden ausführlich dargestellt. Das Kapitel zeigt die persönlichen Kämpfe und die inneren Konflikte Kleists auf, die seine Werke beeinflussten.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Der Findling, Novelle, Schuldfrage, Familiäre Strukturen, Kommunikation, Bösartigkeit, Erzählperspektive, Biographischer Kontext, Weltbild, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Der Findling"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle „Der Findling“. Sie untersucht die Handlung, die Charaktere und die zugrundeliegenden Themen, insbesondere die Frage nach der Schuldzuweisung im Kontext familiärer Strukturen und der Darstellung des Bösen. Die Arbeit bezieht Kleists Biografie und Weltbild mit ein, um eine umfassendere Interpretation zu ermöglichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Familie und familiärer Beziehungen in der Handlung, die Darstellung des Bösen und die Frage nach Schuld und Verantwortung, den Einfluss von Kleists Biografie und Weltanschauung, die Interpretation der Erzählperspektive und die Einordnung der Novelle in Kleists Gesamtwerk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Heinrich von Kleist (inklusive familiärer Hintergründe und Weltbild), ein Kapitel über „Der Findling“ (mit Unterkapiteln zu Handlung, familiären Strukturen, Nicolos Charakter, und der Schuldfrage), ein Schlusswort und ein Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den anfänglichen Schockeffekt der Handlung, stellt die zentrale Frage nach der Schuldzuweisung (Nicolo vs. die Piachis) und verweist auf Schwierigkeiten früherer Interpretationen und die veränderte Lesart seit den 1970er Jahren.
Was wird im Kapitel über Heinrich von Kleist behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet Kleists Biografie, seine Herkunft, seine Bildung, seine Militärzeit, seine Reise nach Frankreich und die damit verbundenen Krisen. Es konzentriert sich auf die Brüche in seinem Leben und die inneren Konflikte, die seine Werke beeinflussten.
Was sind die zentralen Fragen im Kapitel über "Der Findling"?
Das Kapitel zu "Der Findling" untersucht die Einordnung und den Inhalt der Novelle, analysiert die familiären Strukturen und Kommunikation, den Charakter und das Leben Nicolos und vor allem die komplexe Schuldfrage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Der Findling, Novelle, Schuldfrage, Familiäre Strukturen, Kommunikation, Bösartigkeit, Erzählperspektive, Biographischer Kontext, Weltbild, Aufklärung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Analyse und Interpretation Heinrich von Kleists "Der Findling", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199263