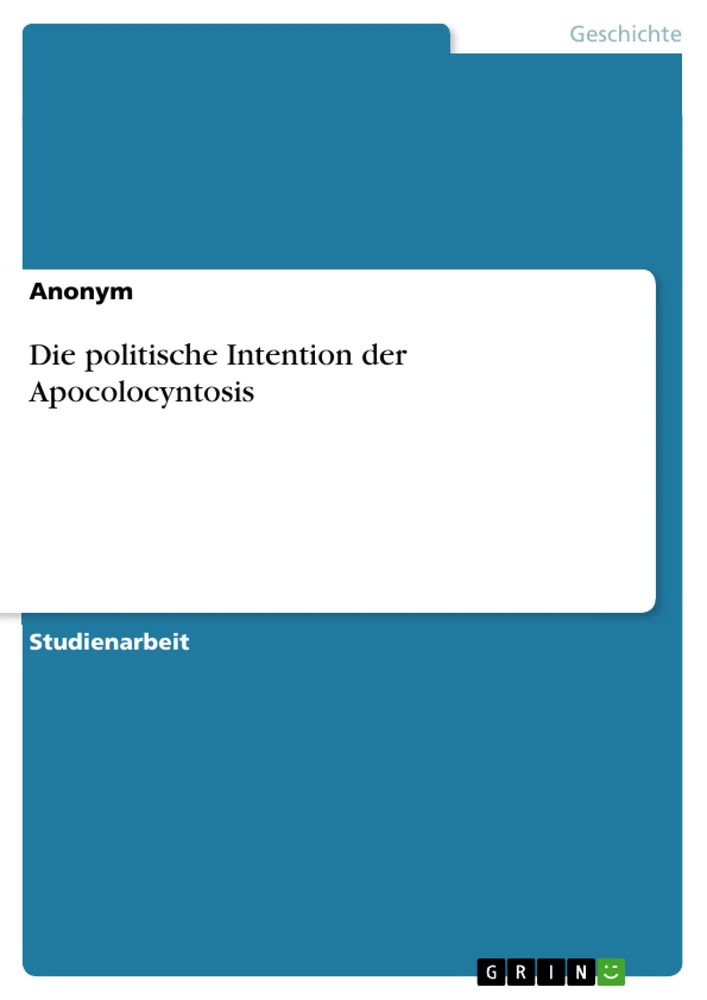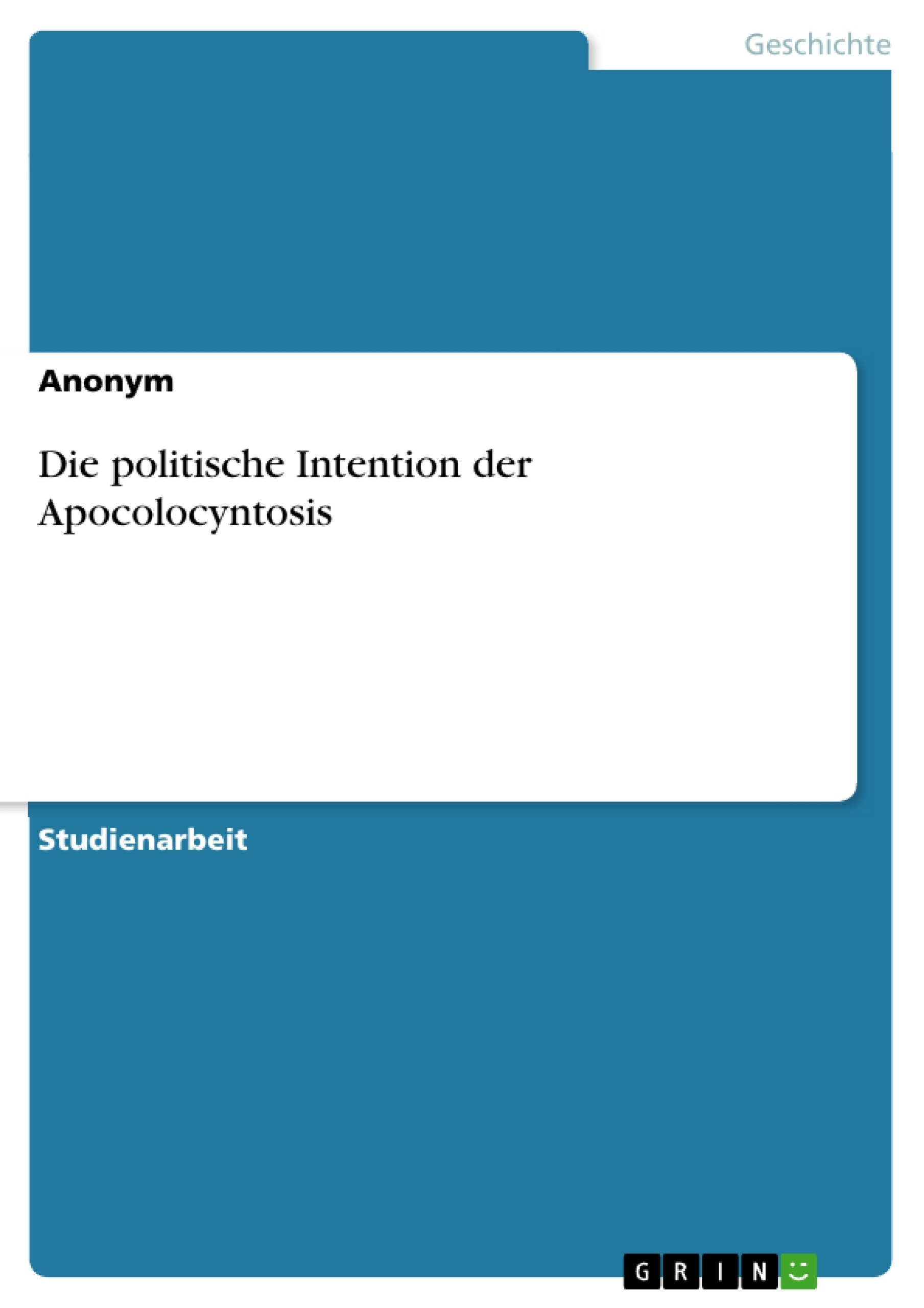1. Einleitung
Vae me, puto, concacavi me! Mit diesen Worten beendet Kaiser Claudius in der vom Philo-sophen, Staatsmann und Dichter Seneca verfassten Satire Apocolocyntosis sein Leben und begibt sich folgend auf eine Himmel- und Höllenfahrt. Claudius starb am 13. Oktober 54 und wurde wenige Zeit später als divus Claudius konsekriert. Kurz nach seiner Apotheose erschien die Apocolocyntosis, in der Seneca auf schärfste Weise mit Claudius abrechnet. Dass Seneca die Satire zum einen aus persönlichem Interesse geschrieben hat, ist offenkun-dig und in der Forschung grundlegend anerkannt. Jedoch wirft das Werk noch eine Frage bezüglich einer politischen Absicht auf, die in dieser Arbeit untersucht wird. Diese Frage nach der politischen Intention der Apocolocyntosis wurde in der Forschung kontrovers dis-kutiert und brachte noch keine endgültige Lösung hervor. So vertritt beispielsweise KRAFT die These, dass Seneca die Satire verfasst hat, um sich in der politischen Auseinandersetzung zwischen dem neuen Kaiser Nero und dem leiblichen Sohn des Claudius, Britannicus, auf die Seite Neros zu schlagen. Weiterhin behaupten eine Reihe von Forschern, beispielsweise MÜNSCHER und neuerdings HORSTKOTTE , dass die Apocolocyntosis gegen Agrippina ge-richtet sei. BRINGMANN und KLOFT verbinden mit der Schmähschrift eher eine Kritik der politischen Wirklichkeit und eine Verschmähung des Claudius allgemein als Herrscher. Diese Arbeit soll zeigen, dass Senecas politische Intention darin bestand, seine Einstellung be-züglich der Politik des Claudius darzustellen und ihn allgemein in seiner Herrscherfunktion zu kritisieren, wobei eine vorsichtige Tendenz aristokratischer Einflüsse möglich gewesen wäre. Neben diesem sollen die beiden Interpretationen bezüglich Agrippina und der politi-schen Propaganda widerlegt werden.
Zunächst wird der historisch-politische Hintergrund der Apocolocyntosis dargestellt, wobei die beiden wichtigsten Akteure Seneca und Claudius näher vorgestellt werden. Anschließend soll anhand einer kurzen Darstellung der wichtigsten Inhalte der Satire ihre Wirkung andeutungsweise gezeigt werden. Im Anschluss wird die politische Intentionsabsicht Senecas in der Apocolocyntosis aus den obengenannten Perspektiven diskutiert.
Die wichtigsten Quellen zur Deutung der Intentionsabsicht des Werkes sind Senecas Apocolocyntosis selbst und weiterhin die historiographischen Darstellungen in Tacitus‘ ‚Annales‘ und Suetons ‚De vita Caesarum‘.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund der Apocolocyntosis
- Seneca und seine politische Geisteshaltung
- Kaiser Claudius
- Seneca und Claudius
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Apocolocyntosis - Verkürbissung
- Inhalt der Apocolocyntosis
- Darstellung des Claudius
- Die politische Intention Senecas in der Apocolocyntosis
- Die Agrippina - Problematik
- Die Apocolocyntosis als politische Propagandaschrift?
- ,,Negativer Fürstenspiegel“ und aristokratische Kritik
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Intention von Senecas Apocolocyntosis und will zeigen, dass Senecas Ziel darin bestand, seine Einstellung zur Politik des Claudius darzustellen und ihn allgemein in seiner Herrscherfunktion zu kritisieren. Dabei wird eine vorsichtige Tendenz aristokratischer Einflüsse diskutiert. Die beiden Interpretationen bezüglich Agrippina und der politischen Propaganda werden widerlegt.
- Die politische Intention von Senecas Apocolocyntosis
- Senecas Kritik an Claudius' Herrschaft
- Mögliche aristokratische Einflüsse in der Satire
- Widerlegung der Interpretationen bezüglich Agrippina und politischer Propaganda
- Historisch-politischer Hintergrund der Apocolocyntosis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der politischen Intention der Apocolocyntosis vor und gibt einen kurzen Überblick über die kontroversen Interpretationen in der Forschung.
Das zweite Kapitel beleuchtet den historisch-politischen Hintergrund der Apocolocyntosis. Es werden Seneca, seine politische Geisteshaltung und seine Beziehung zu Claudius sowie Kaiser Claudius selbst und seine Herrschaft vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die Apocolocyntosis und ihr Inhalt kurz dargestellt und die Darstellung des Claudius in der Satire beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die politische Intention von Senecas Apocolocyntosis. Es werden die verschiedenen Interpretationen, wie z.B. die These, dass Seneca die Satire als politische Propagandaschrift für Nero verfasst hat, oder die Kritik an Agrippina, diskutiert.
Schlüsselwörter
Apocolocyntosis, Seneca, Claudius, politische Intention, Satire, Herrscherkritik, aristokratische Kritik, Agrippina, Propaganda, Tacitus, Annales, Suetonius, De vita Caesarum.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Die politische Intention der Apocolocyntosis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198873