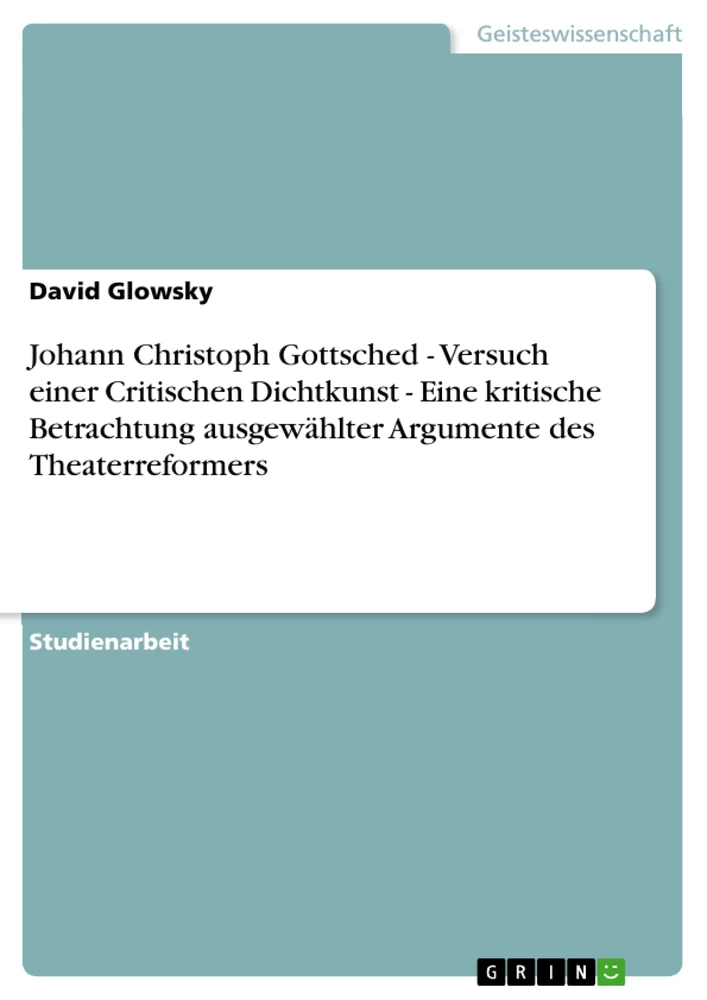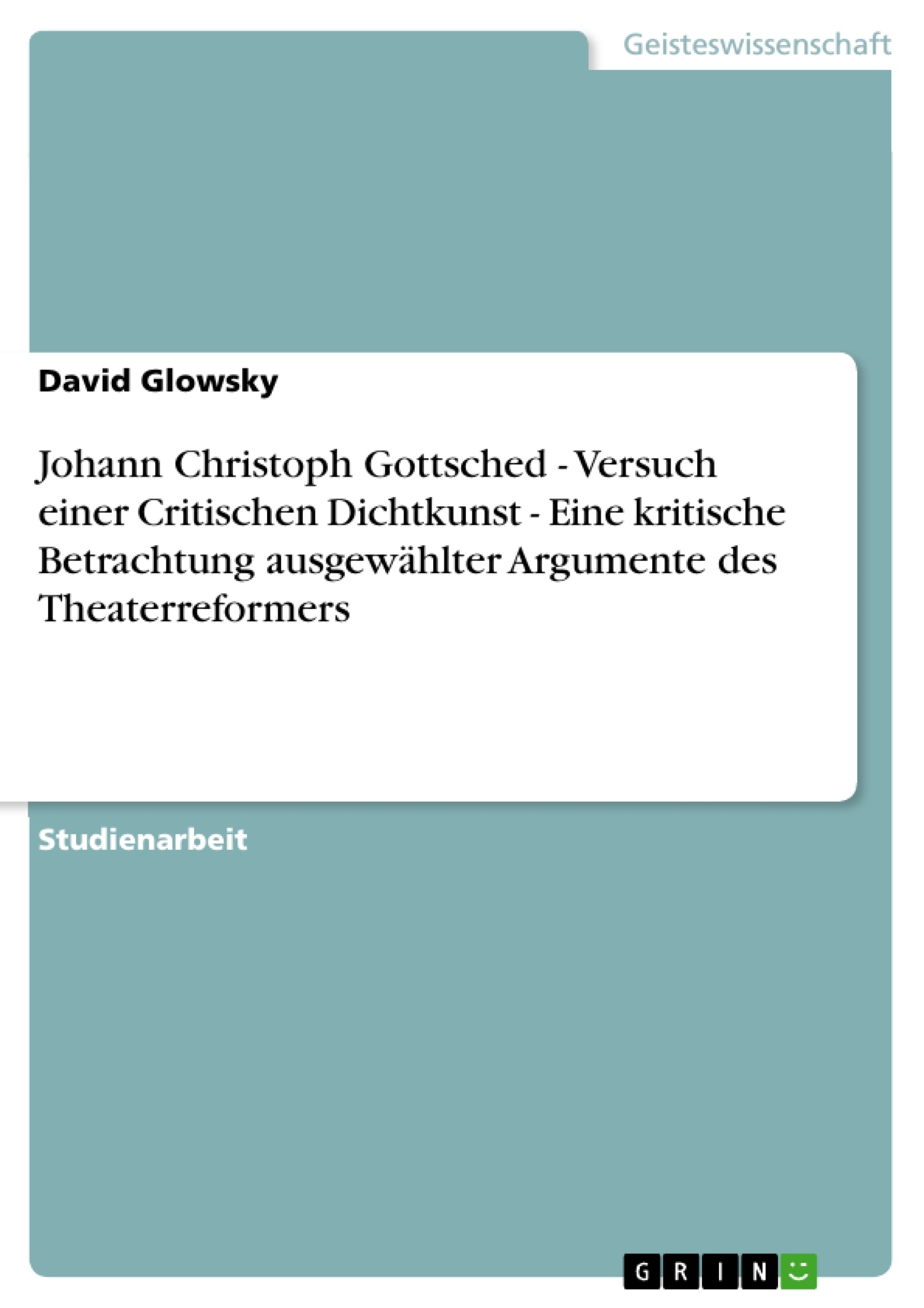Johann Christoph Gottsched, geboren am 2. Februar 1700 als Sohn eines Pastors in
der Nähe von Königsberg, beginnt 1714 das Studium der Theologie und Philosophie an der
Universität Königsberg, das er 1723 mit der Magisterprüfung abschließt. 1724 flieht er als
potentieller „langer Kerl“ vor den Werbern der preußischen Armee nach Leipzig, wo er am
12. Dezember 1766 stirbt.
Seine Entwicklung in Leipzig ist überraschend erfolgreich: Bereits 1725/26 ist er
Herausgeber der „Moralischen Wochenzeitschrift“ »Die vernünftigen Tadlerinnen«, von
denen zwei Bände erscheinen. Sie bilden den Anfang eines sein ganzes Leben überdauernden
Kampfes für die deutsche Sprache und ihren „regelmäßigen“ Gebrauch; 1727/28 erscheinen
zwei Bände der Moralischen Wochenzeitschrift »Der Biedermann«.
1726 (also im Alter von 26 Jahren!) wird Gottsched Senior der „Teutschübendenpoetischen
Gesellschaft“ in Leipzig, die im darauffolgenden Jahr in „Deutsche Gesellschaft“
umbenannt wird. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die deutsche Sprache von ihren Dialekten
zu befreien, um sie für den überregionalen Gebrauch zu vereinheitlichen. Die Arbeit
der D. G. hat entscheidenden Anteil an unseren heute gültigen Rechtschreib- und Grammatikregeln.
Mit dem Aufstieg an ihre Spitze gelingt Gottsched also ein wichtiger Schritt bei
seinen Bemühungen um die deutsche Sprache.
An der Universität Leipzig ist Gottsched ebenfalls recht erfolgreich, denn nachdem
er 1730 eine außerordentliche Professur für Poesie und Beredsamkeit erhalten hat, wird er
1734, dies bis zu seinem Lebensende, ordentlicher Professor für Logik und Metaphysik.
Zwischen den Jahren 1738-56 ist er fünf mal Rektor der Universität, jeweils für ein Wintersemester;
noch häufiger amtiert er als Dekan der Philosophischen Fakultät, nämlich
insgesamt acht mal zwischen 1738 bis 1766.
Inhaltsverzeichnis
- Angaben zum Leben und Werk Gottscheds
- Gottscheds Bemühung um die deutsche Schaubühne
- »Critische Dichtkunst«, 3. Kapitel: Vom gesunden Geschmacke eines Poeten
- »Critische Dichtkunst«, 10. Kapitel: Von Tragödien oder Trauerspielen
- »Critische Dichtkunst«, 11. Kapitel: Von Komödien oder Lustspielen
- Kritik an der »Critischen Dichtkunst«
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Johann Christoph Gottscheds "Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen" (1730) und beleuchtet seine Bemühungen um die Reform des deutschen Theaters und der deutschen Sprache. Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Kapitel der "Critischen Dichtkunst" und der Einordnung von Gottscheds Ideen in den Kontext der Aufklärung.
- Gottscheds Leben und Wirken
- Gottscheds Beitrag zur Reform der deutschen Sprache und Literatur
- Die ästhetischen Prinzipien der "Critischen Dichtkunst"
- Gottscheds Vorstellung von gutem Geschmack und dessen Regeln
- Analyse der Kapitel zu Tragödien und Komödien
Zusammenfassung der Kapitel
Angaben zum Leben und Werk Gottscheds: Dieses Kapitel bietet eine biografische Skizze Gottscheds, von seiner Geburt bis zu seinem Tod in Leipzig. Es hebt seine akademische Laufbahn an der Universität Königsberg und Leipzig hervor, seine Rolle als Herausgeber wichtiger Zeitschriften ("Die vernünftigen Tadlerinnen," "Der Biedermann") und sein Aufstieg zum Senior der "Teutschübenden poetischen Gesellschaft" (später "Deutsche Gesellschaft"), welche die Vereinheitlichung der deutschen Sprache zum Ziel hatte. Gottscheds erfolgreiche akademische Karriere, inklusive seiner Professuren und Rektorate an der Universität Leipzig, wird detailliert dargestellt und in den Kontext seiner Zeit eingeordnet, wobei die Bedeutung seiner Arbeit für die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur betont wird. Die Rolle der "Deutschen Gesellschaft" wird hervorgehoben, um zu zeigen, wie Gottsched die Sprachnormierung aktiv vorantrieb. Der biografische Überblick dient als Grundlage für das Verständnis von Gottscheds späteren literaturtheoretischen Arbeiten und seiner Reformbestrebungen.
Gottscheds Bemühung um die deutsche Schaubühne: Das Kapitel beschreibt Gottscheds Engagement für die Reform des deutschen Theaters. Es schildert seine Zusammenarbeit mit der Schauspieltruppe von Friederike Caroline Neuber und die Aufführung französischer Stücke als ein Mittel zur Verbesserung des deutschen Theaters. Die Veröffentlichung der "Critischen Dichtkunst" im Jahr 1730 wird als Meilenstein in Gottscheds Bemühungen um die Etablierung von Regeln für das deutsche Drama dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Gottscheds Sprachreformen und seinen Bestrebungen, das deutsche Theater zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Neuber wird als entscheidend für die Umsetzung seiner Ideen dargestellt. Die Kapitel verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Gottsched stand, und die Bedeutung seiner Arbeit für die Entwicklung des deutschen Theaters im 18. Jahrhundert.
»Critische Dichtkunst«, 3. Kapitel: Vom guten Geschmacke eines Poeten: Dieses Kapitel analysiert Gottscheds Ausführungen zum "guten Geschmack" eines Dichters. Gottsched verbindet den Begriff "Geschmack" mit Vernunft und Logik und argumentiert, dass ein guter Geschmack nicht subjektiv, sondern auf objektiven, naturgegebenen Regeln beruhe. Er bezieht sich auf die klassische griechische Ästhetik und Aristoteles' Poetik, um seine Argumentation zu stützen. Gottsched vertritt die Ansicht, dass der Dichter die Aufgabe hat, den Geschmack des Publikums zu "läutern" und es an die Regeln der klassischen Kunst heranzuführen. Der Bezug auf die Natur und die Vernunft zeigt Gottscheds aufklärerische Denkweise. Die Kapitel erklärt, wie Gottsched den "guten Geschmack" als einen zentralen Aspekt dichterischer Produktion betrachtet, der sich auf der Grundlage von Vernunft und Naturgesetzen definieren lässt. Die pädagogische Dimension dieser Argumentation wird herausgestellt.
»Critische Dichtkunst«, 10. Kapitel: Von Tragödien oder Trauerspielen: In diesem Kapitel untersucht Gottsched die Regeln der Tragödie, beginnend mit einer historischen Betrachtung des Ursprungs der Gattung bei den Griechen. Er legt Wert auf die Einhaltung bestimmter Regeln und betont die Bedeutung von Wahrscheinlichkeit und Natürlichkeit. Gottscheds Ausführungen zeigen seine Überzeugung, dass die Kunst den Gesetzen der Vernunft und der Natur folgen muss, um als "gut" oder "schön" zu gelten. Die Analyse der Kapitel betont die Bedeutung von Gottscheds Regeln für die Gestaltung der Tragödie. Die klassische Tradition wird als Vorbild dargestellt und mit der Entwicklung des deutschen Theaters in Verbindung gebracht. Seine Prinzipien zur Gestaltung von Tragödien werden im Detail dargestellt und erläutert.
Schlüsselwörter
Johann Christoph Gottsched, Critische Dichtkunst, deutsche Sprache, Theaterreform, Aufklärung, Ästhetik, Regelpoetik, klassische Tradition, Geschmack, Tragödie, Komödie.
Häufig gestellte Fragen zu Gottscheds "Versuch einer Critischen Dichtkunst"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Johann Christoph Gottscheds "Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen" (1730) und beleuchtet seine Bemühungen um die Reform des deutschen Theaters und der deutschen Sprache. Sie untersucht ausgewählte Kapitel der "Critischen Dichtkunst" und ordnet Gottscheds Ideen in den Kontext der Aufklärung ein. Die Arbeit enthält Angaben zu Gottscheds Leben und Werk, eine Zusammenfassung seiner Bemühungen um die deutsche Schaubühne, detaillierte Analysen ausgewählter Kapitel der "Critischen Dichtkunst" (Kapitel 3, 10 und 11) und eine Kritik an der "Critischen Dichtkunst".
Welche Kapitel der "Critischen Dichtkunst" werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere Kapitel 3 ("Vom gesunden Geschmacke eines Poeten"), Kapitel 10 ("Von Tragödien oder Trauerspielen") und Kapitel 11 ("Von Komödien oder Lustspielen") der "Critischen Dichtkunst". Diese Kapitel werden im Detail untersucht und ihre Bedeutung für Gottscheds ästhetische Theorie erläutert.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind Gottscheds Leben und Wirken, sein Beitrag zur Reform der deutschen Sprache und Literatur, die ästhetischen Prinzipien seiner "Critischen Dichtkunst", seine Vorstellung von gutem Geschmack und dessen Regeln, sowie eine Analyse seiner Ansichten zu Tragödien und Komödien. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung der klassischen Tradition und die Herausforderungen, vor denen Gottsched bei seinen Reformbemühungen stand.
Welche Rolle spielte Gottsched für die deutsche Sprache und Literatur?
Gottsched spielte eine entscheidende Rolle bei der Reform der deutschen Sprache und Literatur. Er engagierte sich stark für die Normierung der deutschen Sprache und die Verbesserung des deutschen Theaters. Seine "Critische Dichtkunst" gilt als Meilenstein in diesen Bemühungen. Seine Zusammenarbeit mit der Schauspieltruppe von Friederike Caroline Neuber war ebenfalls maßgeblich für die Umsetzung seiner Ideen.
Wie beschreibt Gottsched den "guten Geschmack"?
Gottsched verbindet "guten Geschmack" mit Vernunft und Logik. Er argumentiert, dass guter Geschmack nicht subjektiv, sondern auf objektiven, naturgegebenen Regeln basiert. Er bezieht sich auf die klassische griechische Ästhetik und Aristoteles' Poetik, um seine Argumentation zu stützen und sieht die Aufgabe des Dichters darin, den Geschmack des Publikums zu "läutern".
Welche Rolle spielt die klassische Tradition in Gottscheds Werk?
Die klassische Tradition, insbesondere die griechische Ästhetik und Aristoteles' Poetik, spielt eine zentrale Rolle in Gottscheds Werk. Er verwendet klassische Prinzipien als Vorbild für seine Regeln der Dichtkunst und sieht sie als Grundlage für einen "guten Geschmack" und die Gestaltung von Tragödien und Komödien.
Welche Kritikpunkte werden an Gottscheds "Critische Dichtkunst" geübt?
Die Arbeit erwähnt auch die Kritik an Gottscheds "Critischen Dichtkunst", jedoch werden die konkreten Kritikpunkte nicht detailliert ausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt dieser Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Johann Christoph Gottsched, Critische Dichtkunst, deutsche Sprache, Theaterreform, Aufklärung, Ästhetik, Regelpoetik, klassische Tradition, Geschmack, Tragödie, Komödie.
- Quote paper
- David Glowsky (Author), 2000, Johann Christoph Gottsched - Versuch einer Critischen Dichtkunst - Eine kritische Betrachtung ausgewählter Argumente des Theaterreformers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19865