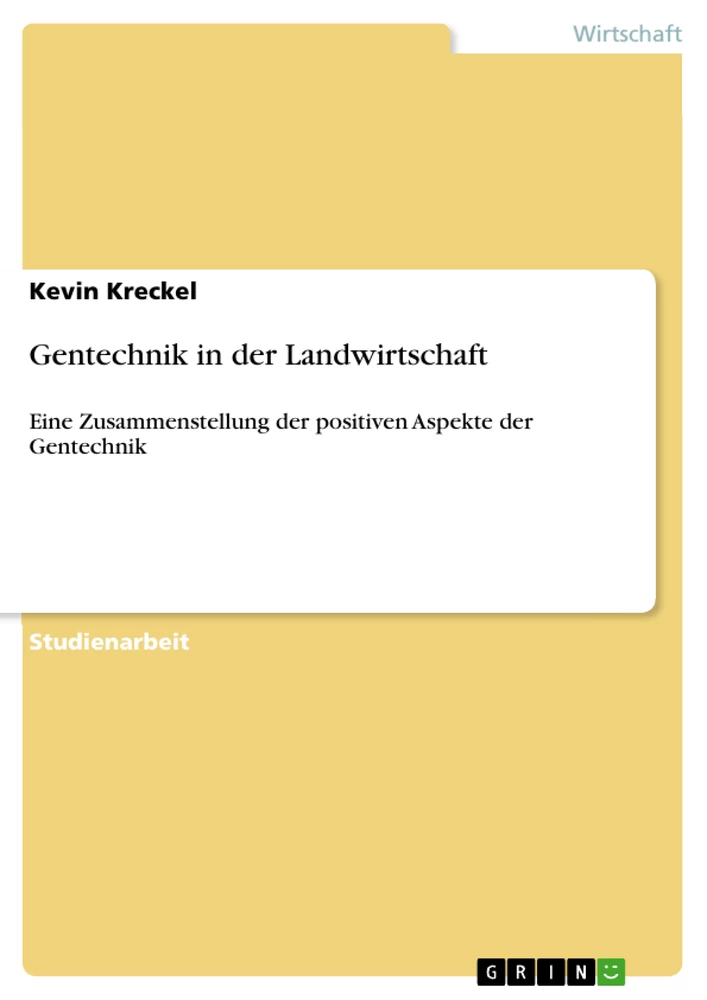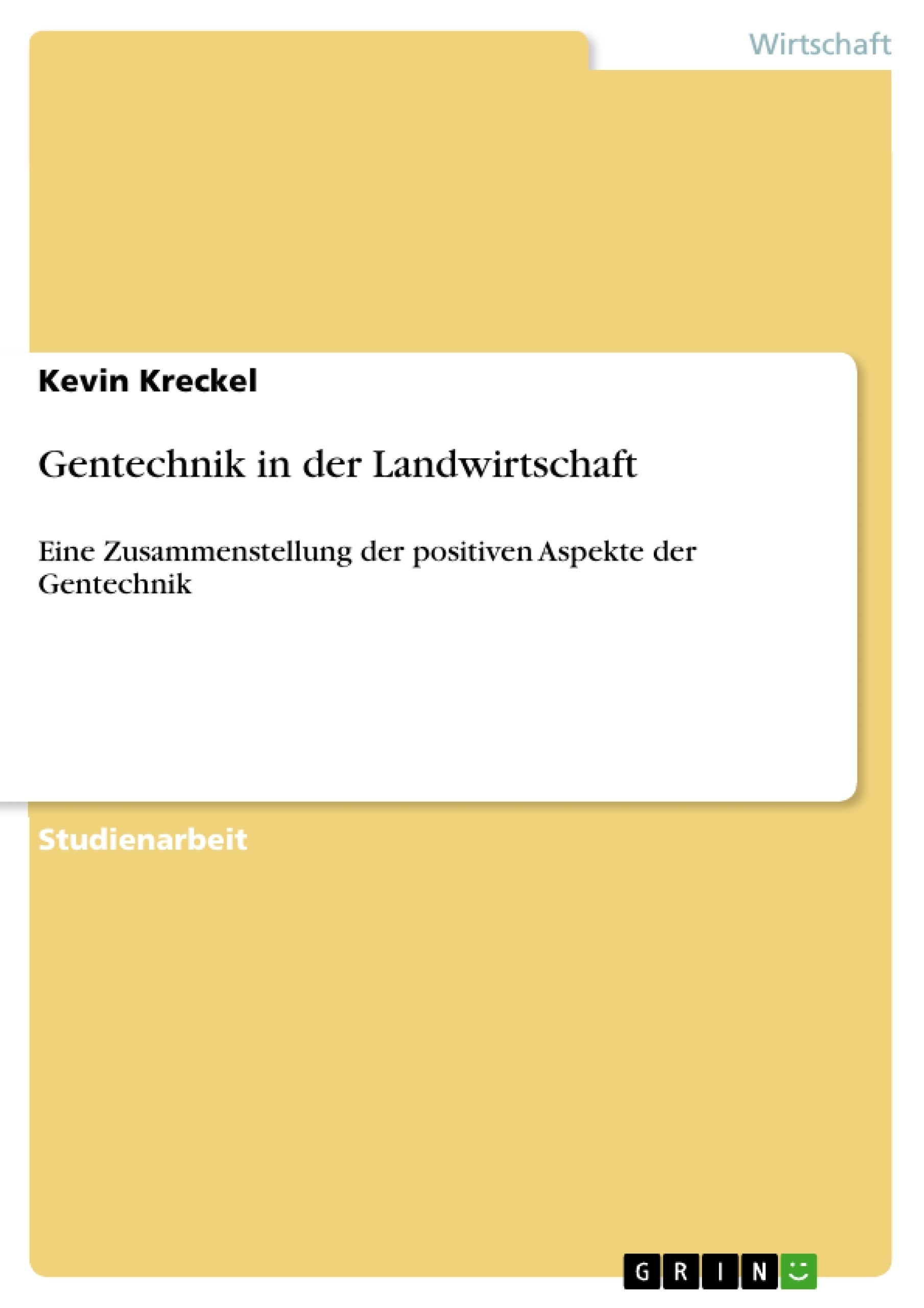Dieser Text ist eine Ausarbeitung zu den positiven Aspekten der gentechnologie im Bezug auf die Bekämpfung des Welthungers. Er entstand im Rahmen eines Seminares zur Welternährungspolitik an der JLU Gießen.
1.Einleitung
Die Ernährungssituation in den Entwicklungsländern ist derzeit gravierend. Ein Großteil der Bevölkerung, vor allem arme Kleinbauern, hungert. Dies hängt mit den veralteten landwirtschaftlichen Methoden und der Ineffektivität bestehender Systeme zusammen. In meinem Teil der Ausarbeitung möchte ich speziell auf die Chancen eingehen, welche eine moderne Landwirtschaft im Vergleich zu den aktuellen Methoden bringt und Ansätze aufzeigen, welche eine deutliche Verbesserung der Ernährungssituation der Bevölkerung sowie eine Weiterentwicklung der Gesellschaft bewirken können.
2.Grundlagen der Gentechnik in der Landwirtschaft
Die Beeinflussung des Erbgutes der Pflanzen ermöglicht eine Vielzahl von Eingriffen in ihren Stoffwechsel und verändert somit die Ausprägung diverser Merkmale. Diese Einflussnahme kann sich auf verschiedenste Bereiche erstrecken. So kann eine Pflanze durch den Einbau der entsprechenden Erbgutsequenz Resistenzen gegen Schädlinge entwickeln oder neue Stoffe synthetisieren. Außerdem kann die Pflanze allgemein robuster werden und somit höhere Erträge sichern. (Kempken, 2004) Wird eine entsprechende Gensequenz in das Erbgut implementiert wird die Pflanze resistent gegen Herbizide. So kann das Pflanzenschutzmittel „Round Up“ auf das Feld angewandt werden, wobei alle unerwünschten Pflanzen sterben. Somit kommen die Nährstoffe der Düngemittel nur den Nutzpflanzen zu gute.
Im Zusammenhang mit Gentechnologie ist jedoch zu erwähnen dass diese Eingriffe in das Erbgut der Pflanze erfordert und keinesfalls mit dem kreuzen zweier Arten verglichen werden darf. Beim Kreuzen findet ein horizontaler Gentransfer statt, wobei die DNA der Elterngeneration auf die nachfolgende Generation übertragen werden kann. Diese Rekombination von Erbgut findet bei der geschlechtlichen Vermehrung statt und unterliegt teilweise dem Zufall. Diese Rekombination findet regulär bei der Fortpflanzung und Kreuzung von Arten statt, ist jedoch bei weitem nicht so effektiv wie die Anwendung der Gentechnik, da die Arten relativ ähnlich sein müssen.(Kempken, 2004)
Bei der Gentechnik werden DNA-Sequenzen aus einer für die Landwirtschaft interessanten Pflanze übernommen und zielgerichtet in das Erbgut anderer Pflanzen mit Hilfe von entsprechenden Enzymen eingesetzt. Hier spricht man von einem vertikalen Gentransfer. Oft wird diese Gensequenz aus Mutanten entnommen, da diese besondere Resistenzen, hohe Erträge oder sonstige positive Eigenschaften aufweisen. Diese Methode kann jedoch auch insofern angewendet werden, dass Gensequenzen aus anderen Lebewesen extrahiert werden und in die DNA der Zielpflanze eingebaut werden, damit diese die entsprechenden Produkte herstellt.
Gegen die erneute Aussaat von geerntetem Saatgut sind die manipulierten Pflanzen mit einer sogenannten GURT-Sequenz ausgestattet welche dafür sorgt, dass die Keimzellen der Samen nach dem Sprießen eine Art Selbstmordsequenz ausführen. Diese führt dazu, dass das Saatgut jedes Jahr neu erworben werden muss, schützt aber gleichzeitig vor einer Einkreuzung in Wildpflanzen und eine breite Verteilung der veränderten Gensequenz. Das Saatgut kann in seiner Verbreitung also kontrolliert werden und ist für wildlebende Arten ungefährlich.
Problematisch ist allerdings eine Monokultur mit gentechnisch manipulierten Pflanzen, da resistente Schädlinge somit eine ideale Verbreitungsgrundlage hätten.
Als Beispiel kann hier die Dessertbananenpflanze genannt werden von welcher zwei kommerziell genutzte Arten existieren. Von diesen beiden Arten, Cavendish und Gros Michel, ist bereits eine Art der Fusarium-Welke zum Opfer gefallen. Dieser Pilz kann sich besonders gut in Monokulturen ausbreiten und nutzt dabei die Nähe der Plantagenpflanzen. Resistenzzüchtungen sind in diesem Fall zwar auch denkbar, jedoch schwierig umzusetzen und ebenfalls nach einer Anpassungsphase des Pilzes bedroht (Crüger, 2002).
Auf die Möglichkeiten, welche mit diesen Verfahren ermöglicht werden, möchte ich in den folgenden Abschnitten genauer eingehen und Argumente einbringen, welche für eine komplette Abkehr der Kleinbauernwirtschaft zugunsten von industriell betriebenen Grobauernhöfen sprechen und diese erörtern. Außerdem möchte ich die Perspektiven für die gesellschaftliche und industrielle Entwicklung aufzeigen und diese mit der Modernisierung der Landwirtschaft in Einklang bringen.
3.Chancen der Gentechnik im Bezug auf Mangelernährungen und Unterversorgung:
Eines der größten Probleme in den Entwicklungsländern stellen Mangelerkrankungen dar. Diese können entweder durch eine Unterversorgung mit Kalorien bedingt sein oder daher rühren, dass bestimmte Stoffe (Proteine, Vitamine etc.) fehlen und der Körper nicht in der Lage ist, diese Selbst herzustellen.
Im Folgenden gehe ich auf die häufigsten Mangelerkrankungen ein und zeige Möglichkeiten auf, wie die moderne Gentechnik zusammen mit landwirtschaflichem Fortschritt diese Probleme lösen kann.
3.1 Kalorienmangel:
Die Hauptursache für Hungersnöte und durch Unterversorgung bedingte Todesfälle ist ein Mangel an Kohlenhydraten oder Fetten. Dieser ist durch die Armut der Bevölkerung oder durch Dürren und Ernteausfälle begründet. Jährlich leiden 925000000 Menschen an den Folgen der Unterernährung (Trentman, 2011).
Dem Kalorienmangel könnte mit einer Preissenkung bei Lebensmitteln oder der Verbesserung der Ernteerträge bekämpft werden. Gentechnik kann durch die hiermit verbundenen Ertragssteigerungen sowie die Resistenz gegen Schädlinge und Schädlingsbekämpfungsmittel einen großen Beitrag leisten (Kempken, 2004).
Die schon in der Einführung beschriebenen Resistenzen gegen Herbizide können in diesem Zusammenhang angewendet werden, um die Konkurrenzpflanzen, welche den Nutzpflanzen wertvolle Rohstoffe entziehen, abzutöten. Somit stehen mehr Nährstoffe für die Pflanzen und damit auch im Endeffekt für die Bauern zur Verfügung.
Zusätzlich zur Beseitigung der Schadpflanzen können diese Mechanismen auch auf Insekten angewandt werden. Dabei werden die Pflanzen mit entsprechenden Gensequenzen ausgestattet, welche dafür sorgen dass die Pflanze ein Fraßgift produziert. Dadurch werden Schadinsekten schnell und pestizidfrei beseitigt. Eine erfolgreiche Anwendung dieses Mechanismus wurde bereits bei Raupen gezeigt. Als bekanntestes Beispiel kann hierbei ein von der Firma Monsanto hergestellter Mais gesehen werden, welcher das Gift gegen die Larve des Maiszünslers selbst herstellt und ihn somit pestizidfrei abtötet (Kempken, 2004). Die Unabhängigkeit von Pestiziden ist einem Land wie Afrika mit einer mangelhaften Infrastruktur durchaus wünschenswert und eine Möglichkeit, den Boden vor Pestizideinschwemmungen zu schützen und gleichzeitig die Ernteerträge vor Fraßschädlingen zu sichern.
Da Afrika des Weiteren über sehr salzige und dürre Böden verfügt wären an diese Umstände angepasste Pflanzen dementsprechend ideal dazu geeignet, um diese Ackerflächen zu erschließen und damit die ausgezehrten Böden zu entlasten (Kempken, 2004).
3.2 Proteinmangel:
Ein bekanntes Phänomen bei Eiweißmangel ist der so genannte Hungerbauch, welcher durch die Einlagerung von Wasser Im Gewebe nach dem Abbau der Albumine im Blut deutlich sichtbar wird. Diese Krankheit wird in der Fachterminologie als Kwashiorkor bezeichnet (Pschyrembel, 2007). Ursache der Symptome ist das Fehlen der Aminosäure Methionin, welche für viele Stoffwechselprozesse unverzichtbar ist. Methionin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und ist ein Baustein vieler Proteine, unter anderem des Albumins (Clauss, 2009). Der Mangel an Methionin ist durch die vorwiegend aus Mais bestehende Ernährung begründet. Ein gentechnisches Projekt konnte erfolgreich die Möglichkeit aufweisen, die Gensequenz für das Speicherprotein der Paranuss in die Sojabohne zu integrieren. Dieses Protein ist reich an der benötigten Aminosäure, hatte jedoch aufgrund der Herkunft die Auslösung von allergischen Reaktionen (Nussallergien) zur Folge. Die Versuche wurden daraufhin eingestellt, jedoch ist die Möglichkeit, Aminosäuren aus transgenen Pflanzen zu gewinnen, bewiesen (Schütte, 2001).
Gegen den Proteinmangel könnte auch mit der Züchtung von effektiveren Nutztieren vorgegangen werden. Zwar benötigt man pro Kalorie Fleisch ungefähr 7-10 Kalorien Futtermittel, jedoch wären auch mehrere Mangelkrankheiten (Vitaminmangel, Eisenmangel und Proteinmangel) durch die erhöhte Fleischproduktion leicht zu beseitigen.
3.3 Vitaminmangel:
Der bestehende Vitaminmangel in unterernährten Gebieten ist in der Ernährung der Bevölkerung zu suchen. Die Nahrungsgrundlage besteht häufig nur aus einer Getreide bzw. Maisart oder aus Hirse. Diese Pflanzen sind zwar relativ energiereich was Kalorien angeht, jedoch enthalten sie nur eine begrenzte Anzahl an Vitaminen. Oft besteht aber auch das Problem der Unterversorgung mit Fetten, welche für die Aufnahme der Vitamine entscheidend sind. Die Vitamine E, D, K und A können nur zusammen mit Lipiden aufgenommen und Verarbeitet werden (Clauss, 2009). Besonders der Vitamin A Mangel manifestiert sich bei den Kindern in Entwicklungsländern, wobei dieser zur Erblindung führt, da Sehpigmente nicht hergestellt werden können. Ein Projekt, bei dem die Sequenz des Beta-Carotins in Reiskörner eingesetzt werden soll, dürfte daher bei Erfolg auch eine merkliche Verbesserung darstellen. Beta-Carotin ist auch als Provitamin A bekannt und würd für dessen Herstellung benötigt.
Erste Studienergebnisse zeigen auf, dass der Vitamingehalt einer Tagesportion des „Golden Rice 2“ ausreichend wäre, um 50% des Bedarfs an Vitamin A zu decken. Ein weiterer Vorteil dieser Reissorte ist, dass die herstellenden Firmen auf alle Patentrechte verzichteten und somit der Reis kostengünstig die Mangelernährung beseitigen kann. In Relation zur Herstellung von Ersatzstoffen ist der gentechnisch veränderte Reis um ein vielfaches günstiger. Somit könnten andere Projekte, zum Beispiel Impfkampagnen, stärker finanziert werden (Schütte, 2001).
4. Gentechnisch veränderte Grundnahrungsmittel und Leistungsvergleich
In diesem Abschnitt stelle ich den Erträgen gentechnisch veränderter Pflanzen denen der ursprünglichen Pflanzen gegenüber und Vergleiche diese. Als Beispiele sollen hierbei Mais und Weizen sowie Reis betrachtet werden.
Der Mais ist, zusammen mit Soja, die am häufigsten gentechnisch veränderte und wirtschaftlich genutzte Pflanze. Sein Erbgut ist gut bekannt und daher existieren viele Verfahren, um die Gensequenz gezielt zu verändern. Kommerzielle Maispflanzen tragen, wie bereits beschrieben, meistens Resistenzen gegen Schädlingsbekämpfungsmittel sowie gegen bestimmte Fraßfeinde (Bommert, 2009).
Die häufigste Anwendung dieser Maissorten erstreckt sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier können selbst auf kargen Böden bei entsprechender Versorgung mit Düngemitteln sehr hohe Erträge erzielt werden. In Europa ist aus der Produktpalette der Firma Monsanto lediglich eine Maissorte für den kommerziellen Anbau zugelassen. Dies hängt auch mit der größeren Skepsis der europäischen Bevölkerung im Bezug auf genmanipulierte Nahrungsmittel zusammen.
Weizen ist ein ideales Beispiel für eine Pflanzenart, welche schon vor der Entdeckung der Gentechnik durch Kreuzung stark verändert und viel Ertragreicher wurde. Zum Vergleich: Weizensorten des Mittelalters lieferten pro eingepflanztem Samen drei Körner als Ertrag, heute erstreckt sich der Ertrag auf das Fünf- bis Zehnfache (je nach Art). Weizen ist in der aktuellen Landwirtschaft gentechnisch vergleichsweise wenig verändert worden. Man forscht jedoch an Trockenheits- und Pilzresistenzen. (http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/78.weizen.html)
Reis wird vor allem im asiatischen Raum angebaut und dient ca. 26% der Weltbevölkerung als Grundnahrungsmitte. Hierbei existieren ebenfalls viele verschiedene Sorten, welche sich in Ertrag und Dürreresistenz unterscheiden. Der Reisanbau selbst ist einer der Hauptquellen für Methanemissionen, wobei diese durch effektive Gentechnik massiv reduziert werden könnten. Die Reispflanzenart IR 36 ist die landwirtschaftlich am häufigsten genutzte Reissorte. 1982 wurden bereits 11000000 Hektar mit dieser Nutzpflanze bewirtschaftet (Bommert, 2009). Derzeit versuchen Forscher Reispflanzen dahingehend zu verändern dass der Photosynthesemechanismus verbessert wird. (http://www.sueddeutsche.de/wissen/gruene-gentechnik-super-reis-und-turbo-mais-1.174345). Photosynthese ist die Herstellung von Energie für die Pflanzenzellen unter Aufwendung von Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht. Hierbei gibt es mehrere unterschiedliche Mechanismen. Geling es den Forschern, den wesentlich effektiveren C4-Metabolismus in die Reispflanzen zu implementieren, ist eine Verdopplung der Erträge möglich bei gleichzeitig geringerem Wasserbedarf (Schopfer, 2010).
5. Integration der Gentechnik in die Entwicklungshilfe und mögliche Anwendungen
Eine mögliche Anwedung erstreckt sich auf viele Bereiche. Der Idealfall wäre, dass sämtliche Agrargüter optimiert werden und protektionistische Mechanismen der Länder abgeschafft werden. So könnte in Regionen, in denen günstig Mais, Getreide und andere Nahrungsmittel gut gedeihen, ein Schwerpunkt auf deren Anbau gelegt werden. In den Entwicklungsländern könnte ebenfalls mit Hybridsaatgut gearbeitet werden oder der Welthandel dahingehend verändert werden, dass jedes Land nur die Güter herstellt die es auch möglichst günstig Produzieren kann. Ökonomen sprechen hier vom sogenannten komparativen Kostenvorteil. Eine Optimierung aller Feldfrüchte würde den Wohlstand der Länder steigern und somit ermöglichen, dass Grundnahrungsmittel von der Bevölkerung, vor allem von den Bauern, erworben werden können. Teure Agrargüter wie Kakaobohnen oder Kaffee können ebenfalls im Ertrag gesteigert werden und somit, durch die verhältnismäßig hohen Erlöse, freies Einkommen für Grundnahrungsmittel bereitstellen (Kempken, 2004)
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang jedoch eine Abkehr von der ineffektiven kleinbäuerlichen Landwirtschaft und eine Modernisierung Richtung Großbauerntum und gentechnischer Erzeugung der Agrargüter. Die Wirtschaft der Entwicklungsländer könnte sich dahingehend entwickeln, dass die Landbevölkerung in die verarbeitenden Gewerbe eingegliedert wird und sich somit die Gesellschaft ebenfalls weiterentwickelt, da ein Mittelstand entsteht.
Eine Abkehr von modernen Verfahren zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft würde einen Rückschritt bedeuten. Die aktuelle Versorgungslage in Afrika zeigt jedoch auch, dass Kleinbauern mit ihren Höfen nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Die hungernde Bevölkerung ist vor allem in ländlichen Regionen zu finden.
[...]
- Quote paper
- Kevin Kreckel (Author), 2012, Gentechnik in der Landwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198638