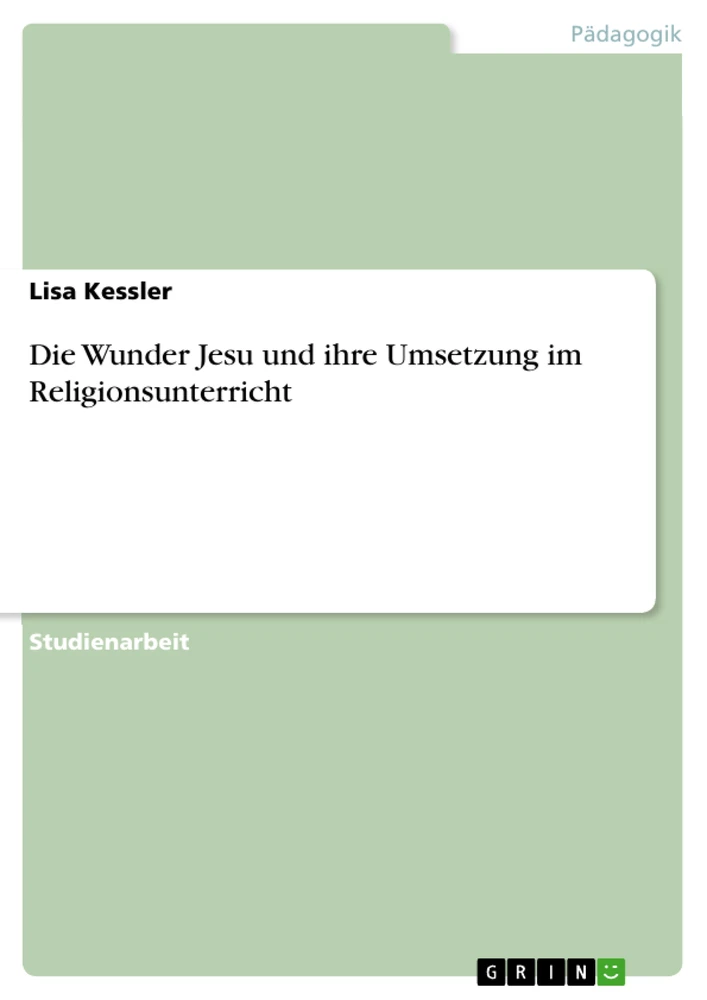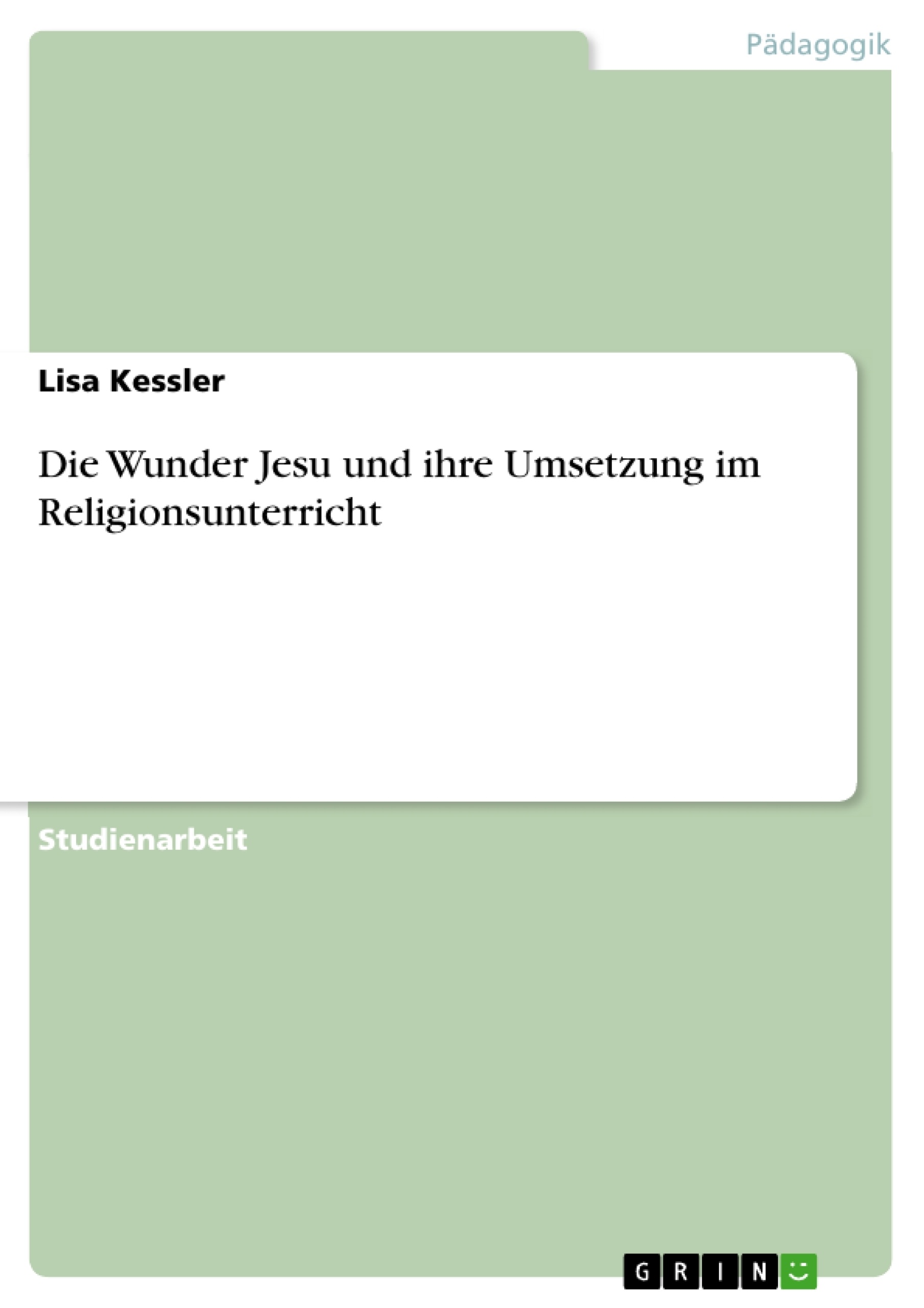In der vorliegenden Arbeit wird erläutert, was man heutzutage unter Wundern versteht und wie sich diese Definition mit der Ansicht im Neuen Testament deckt. Desweiteren werden die verschiedenen Wundergattungen näher vorgestellt. In Bezug zur Schule werden Vor- und Nachteile von der Umsetzung von Wundergeschichten in der Schule erörtert. Abschließend folgt ein ausführlicher Unterrichtsentwurf zu der Wundergeschichte: "Der wundersame Fischfang".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Wunderbegriffs
- 3. Wundergattungen im Neuen Testament
- 3.1 Dämonenaustreibungen
- 3.2 Heilungswunder
- 3.3 Naturwunder
- 3.4 Totenerweckungen
- 3.5 Normenwunder
- 4. Einsatz von Wundergeschichten im Religionsunterricht der Grundschule
- 5. Unterrichtliche Umsetzung der Wundergeschichte: Der wundersame Fischzug
- 5.1 Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen
- 5.2 Klärung des Unterrichtsgegenstands
- 5.3 Didaktisch-methodische Überlegungen
- 5.4 Bezug zum Bildungsplan und Einordnung in die Unterrichtseinheit
- 5.5 Ziele des Unterrichts - Kompetenzerwerb der Schüler/innen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wunder Jesu und deren mögliche Umsetzung im Religionsunterricht der Grundschule. Sie zielt darauf ab, den Wunderbegriff zu definieren, verschiedene neutestamentliche Wundergattungen zu beleuchten und die Eignung des Themas für den Grundschulunterricht zu evaluieren. Ein fiktiver Unterrichtsentwurf zur Wundergeschichte des wundersamen Fischzugs dient als Beispiel für eine mögliche Umsetzung.
- Definition des Wunderbegriffs und seine Interpretation im Kontext des christlichen Glaubens.
- Kategorisierung und Analyse verschiedener neutestamentlicher Wundergeschichten (Dämonenaustreibungen, Heilungen, Naturwunder etc.).
- Didaktische und methodische Überlegungen zur Implementierung von Wundergeschichten im Grundschulunterricht.
- Prüfung der Eignung des Themas "Wunder und Wundergeschichten" für die Grundschule und möglicher Herausforderungen.
- Entwicklung eines konkreten Unterrichtsbeispiels (Der wundersame Fischzug).
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wunder Jesu und deren didaktische Relevanz im Religionsunterricht ein. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen dar, wobei der Fokus auf der Umsetzung der Wundergeschichten in der Grundschule liegt. Die Arbeit verweist auf die Auswahl der verwendeten Literatur, die sich auf autoren wie Josef Epping, Bernd Kollmann, Reinhard Kratz und Rudolf Pesch sowie Gerd Theißen konzentriert, und begründet diese Auswahl mit deren Verständlichkeit und Praxisnähe.
2. Definition des Wunderbegriffs: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Wunder“. Es wird die Schwierigkeit einer eindeutigen Definition herausgestellt und verschiedene Perspektiven beleuchtet, von der subjektiven Erfahrung eines unerklärlichen Ereignisses bis hin zur theologischen Interpretation als Zeichen des göttlichen Handelns. Eppings Definition von Wundern als „auffallende Ereignisse, die von glaubenden Menschen als Zeichen des Heilshandelns Gottes verstanden werden“ wird als Ausgangspunkt verwendet und diskutiert. Die Unterscheidung zwischen Wundern und Wundergeschichten im Neuen Testament wird angedeutet.
3. Wundergattungen im Neuen Testament: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Kategorien von Wundern im Neuen Testament. Es beginnt mit einer detaillierten Darstellung von Dämonenaustreibungen, unterteilt in sieben Phasen nach Pesch und Kratz, und führt exemplarisch verschiedene Berichte aus den Evangelien an (z.B. die Heilung des Besessenen aus Gerasa). Die Kapitel 3.2, 3.3, 3.4, und 3.5 behandeln weitere Wundergattungen (Heilungswunder, Naturwunder, Totenerweckungen und Normenwunder), deren jeweilige Besonderheiten und theologische Bedeutung für den weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind.
4. Einsatz von Wundergeschichten im Religionsunterricht der Grundschule: Kapitel 4 erörtert die Frage der Eignung von Wundergeschichten für den Religionsunterricht in der Grundschule. Es werden mögliche didaktische Ansätze und Herausforderungen im Umgang mit diesem Thema im Grundschulkontext diskutiert. Die Frage nach der altersgerechten Präsentation und dem Verständnis von Wundern durch Kinder steht im Mittelpunkt dieser Betrachtung.
5. Unterrichtliche Umsetzung der Wundergeschichte: Der wundersame Fischzug: Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten, fiktiven Unterrichtsentwurf zur Wundergeschichte vom wundersamen Fischzug. Es beschreibt die Rahmenbedingungen, Lernvoraussetzungen, den Unterrichtsgegenstand und die didaktisch-methodischen Überlegungen zur Durchführung des Unterrichts. Die Einordnung in den Bildungsplan und die angestrebten Lernziele (Kompetenzerwerb der Schüler) werden ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Wunder, Wundergeschichten, Jesus Christus, Neues Testament, Religionsunterricht, Grundschule, Didaktik, Methoden, Dämonenaustreibungen, Heilungswunder, Naturwunder, Totenerweckungen, Unterrichtsentwurf, Bildungsplan, Kompetenzerwerb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umsetzung von Wundergeschichten im Religionsunterricht der Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wunder Jesu und deren didaktische Umsetzung im Religionsunterricht der Grundschule. Sie definiert den Wunderbegriff, analysiert verschiedene neutestamentliche Wundergattungen und evaluiert die Eignung des Themas für den Grundschulunterricht. Ein fiktiver Unterrichtsentwurf zum wundersamen Fischzug dient als Beispiel.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition des Wunderbegriffs im christlichen Kontext, die Kategorisierung und Analyse neutestamentlicher Wundergeschichten (Dämonenaustreibungen, Heilungen, Naturwunder etc.), didaktische und methodische Überlegungen zur Implementierung im Grundschulunterricht, die Prüfung der Eignung des Themas für die Grundschule und die Entwicklung eines konkreten Unterrichtsbeispiels (der wundersame Fischzug).
Wie wird der Wunderbegriff definiert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeit einer eindeutigen Definition des Wunderbegriffs und beleuchtet verschiedene Perspektiven, von der subjektiven Erfahrung bis zur theologischen Interpretation als Zeichen Gottes. Eppings Definition von Wundern als „auffallende Ereignisse, die von glaubenden Menschen als Zeichen des Heilshandelns Gottes verstanden werden“ dient als Ausgangspunkt.
Welche Wundergattungen im Neuen Testament werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Dämonenaustreibungen (unterteilt in sieben Phasen nach Pesch und Kratz), Heilungswunder, Naturwunder, Totenerweckungen und Normenwunder. Es werden exemplarisch verschiedene Berichte aus den Evangelien angeführt.
Wie wird die Eignung von Wundergeschichten für den Grundschulunterricht bewertet?
Kapitel 4 erörtert die Eignung von Wundergeschichten für den Religionsunterricht in der Grundschule. Es werden didaktische Ansätze und Herausforderungen im Umgang mit diesem Thema im Grundschulkontext diskutiert, mit dem Fokus auf altersgerechter Präsentation und Verständnis von Wundern durch Kinder.
Was beinhaltet der fiktive Unterrichtsentwurf zum wundersamen Fischzug?
Der fiktive Unterrichtsentwurf beschreibt die Rahmenbedingungen, Lernvoraussetzungen, den Unterrichtsgegenstand und didaktisch-methodische Überlegungen. Die Einordnung in den Bildungsplan und die angestrebten Lernziele (Kompetenzerwerb der Schüler) werden ebenfalls erörtert.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Autoren wie Josef Epping, Bernd Kollmann, Reinhard Kratz, Rudolf Pesch und Gerd Theißen. Die Auswahl begründet sich auf Verständlichkeit und Praxisnähe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wunder, Wundergeschichten, Jesus Christus, Neues Testament, Religionsunterricht, Grundschule, Didaktik, Methoden, Dämonenaustreibungen, Heilungswunder, Naturwunder, Totenerweckungen, Unterrichtsentwurf, Bildungsplan, Kompetenzerwerb.
- Quote paper
- Lisa Kessler (Author), 2012, Die Wunder Jesu und ihre Umsetzung im Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198599