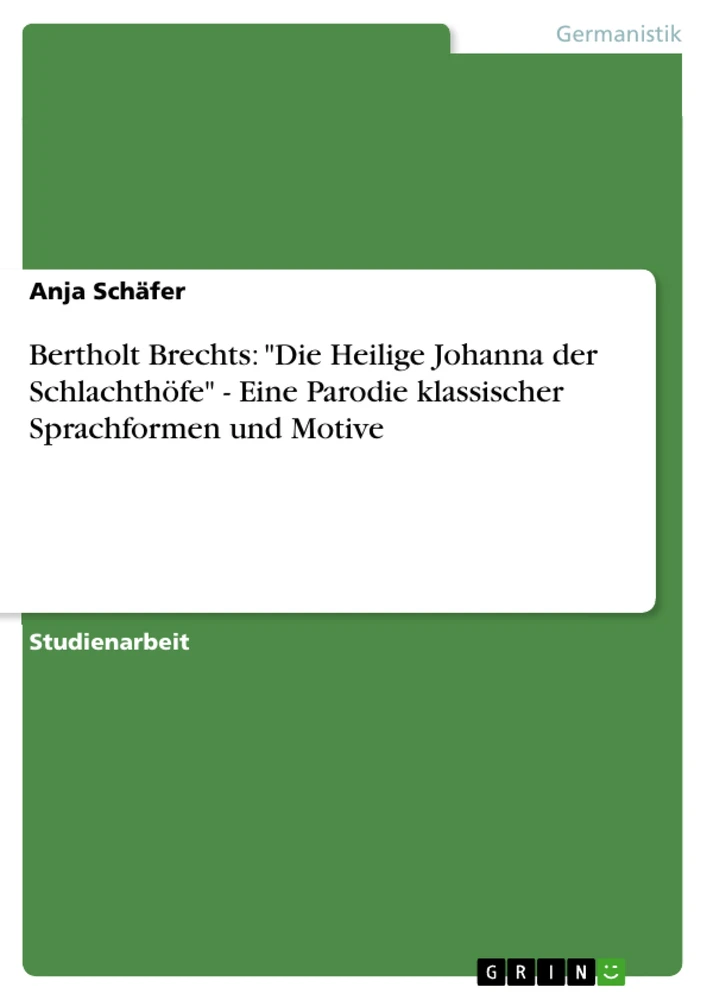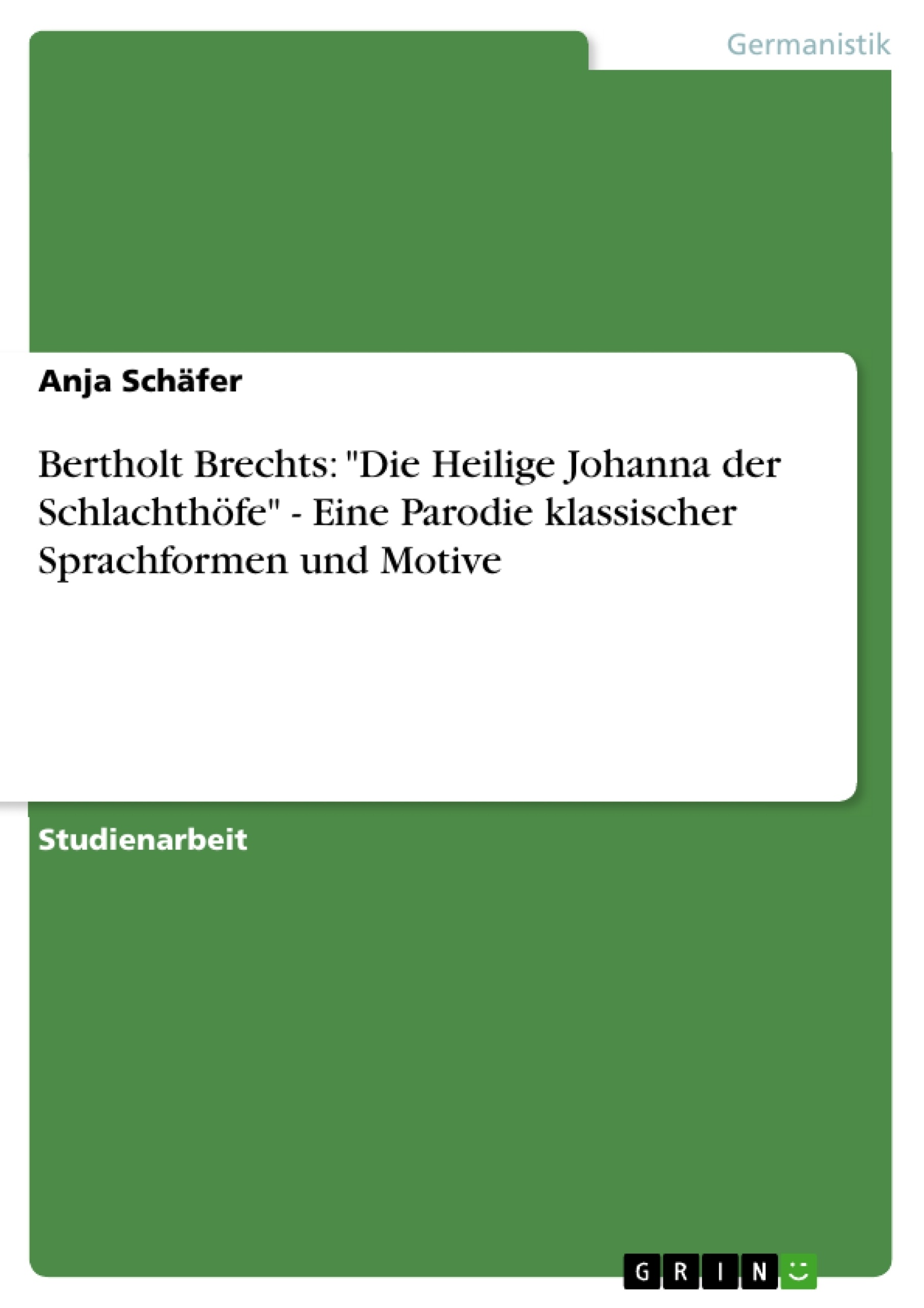Bertolt Brechts Drama „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“, 1929 in Berlin entstanden, ist in sprachlicher Hinsicht eines der größten Meisterwerke des Autors. Durch die Übernahme und Mischung von Elementen klassischer Dramen sowie Brechts eigener sprachschöpferischen Kraft ragt dieses Lehrstück weit aus seinen früheren experimentellen Dramen hervor. Dazu kommt der für Brecht ungewöhnliche intertextuelle Beziehungsreichtum: Passagen von Goethe, Schiller und Hölderlin sind in den Text eingearbeitet, ebenso die Sprache der Bibel und einige Liedtexte. Neben rein literarischen Quellen und klassischen Stoffvorlagen verarbeitet Brecht auch aktuelle Wirtschaftsdaten seiner Zeit, die einen gesellschaftlich-historischen Bezug des Stücks herstellen und ihm Modernität verleihen.
Doch kann man im Falle einer Mischung diverser deutscher Klassiker und der verfremdeten Übernahme von Verssprache, Zitaten, Songtexten und Bibelzitaten überhaupt von einer Parodie sprechen? Der Autor spielt nicht nur auf Inhalte der großen, klassischen, deutschen Werke an. Durch die Übernahme von Elementen und Gestaltungsprinzipien des idealistischen, klassischen Theaters sucht Brecht die verklärende bürgerliche Ideologie der deutschen Klassik zu entlarven. Allein das epische Theater scheint ihm für diesen Zweck geeignet, da hier mittels Verfremdung Kritik geübt wird. „[Brechts] Heilige Johanna der Schlachthöfe ist in Zitat, Montage und Verfremdung offenkundig eine Parodie, aber auch eine Travestie von Schillers klassischem Drama“ . Brecht warnt jedoch davor, sein Stück als bloße Schiller-Parodie zu verstehen, da sich sein Werk auf die gesamte Weimarer Klassik bezieht und nicht nur auf diesen einzelnen Autor.
Im Folgenden soll vorerst die Frage des Parodiebegriffs geklärt werden. Anschließend werden Brechts parodistische Techniken in einem Vergleich zwischen epischem und klassischem Theater besprochen, um daraufhin in einer ausführlichen Textanalyse die intertextuellen Bezüge zwischen Brechts "Heiliger Johanna" und den dafür verwendeten klassischen Vorlagen herauszuarbeiten. Die parodistischen Anspielungen auf Goethe und Schiller werden daraufhin separat behandelt. Auf die Imitation der Vorlagen wird dabei ebenso viel Wert gelegt wie auf die vom Autor vorgenommenen Veränderungen. Zum Schluss soll noch die Intention des Autors und seiner Parodie geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Parodiebegriff
- Episches Theater vs. Klassisches Theater
- Parodie klassischer Sprachformen und Motive
- Parodie der Klassiker Goethe und Schiller
- Die Johanna-Gestalt bei Schiller und Brecht
- Intentionen des parodistischen Verfahrens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Bertolt Brechts „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“ analysiert die Verklärung der bürgerlichen Ideologie im klassischen Theater anhand von parodistischen Elementen und Techniken. Das Stück nutzt Verfremdungseffekte, um Kritik an der Überholtheit der deutschen Klassik zu üben und die menschenverachtenden Machenschaften der herrschenden Klasse aufzudecken.
- Parodie klassischer Sprachformen und Motive
- Vergleich zwischen epischem und klassischem Theater
- Intertextuelle Bezüge zwischen Brechts „Heiliger Johanna“ und klassischen Vorlagen
- Intentionen des parodistischen Verfahrens
- Verfremdungseffekt als Mittel der Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Brechts „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“ als ein Meisterwerk der sprachlichen Verfremdung vor, das Elemente klassischer Dramen mit Brechts eigener Sprachschöpferischen Kraft verbindet. Das Kapitel analysiert die intertextuellen Bezüge des Stücks zu Werken von Goethe, Schiller und Hölderlin sowie zur Bibel und Liedtexten.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Parodiebegriff und dessen Anwendung auf Brechts „Heilige Johanna“. Es erklärt, dass Brecht durch die Übernahme und Umdeutung klassischer Formen eine Kritik an deren verklärender Ideologie anstrebt. Die Verwendung des epischen Theaters als Mittel der Verfremdung und Kritik wird hier ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Parodie, episches Theater, klassisches Theater, Verfremdung, Goethe, Schiller, intertextuelle Bezüge, Zitate, Kritik, bürgerliche Ideologie, „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“.
- Quote paper
- Anja Schäfer (Author), 2007, Bertholt Brechts: "Die Heilige Johanna der Schlachthöfe" - Eine Parodie klassischer Sprachformen und Motive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198317