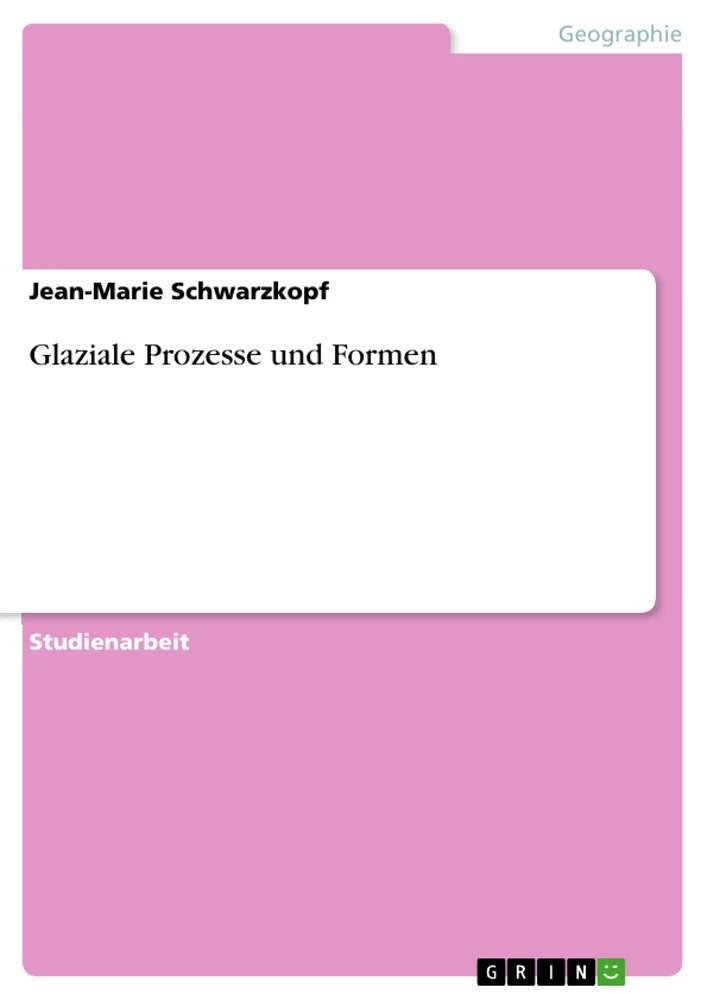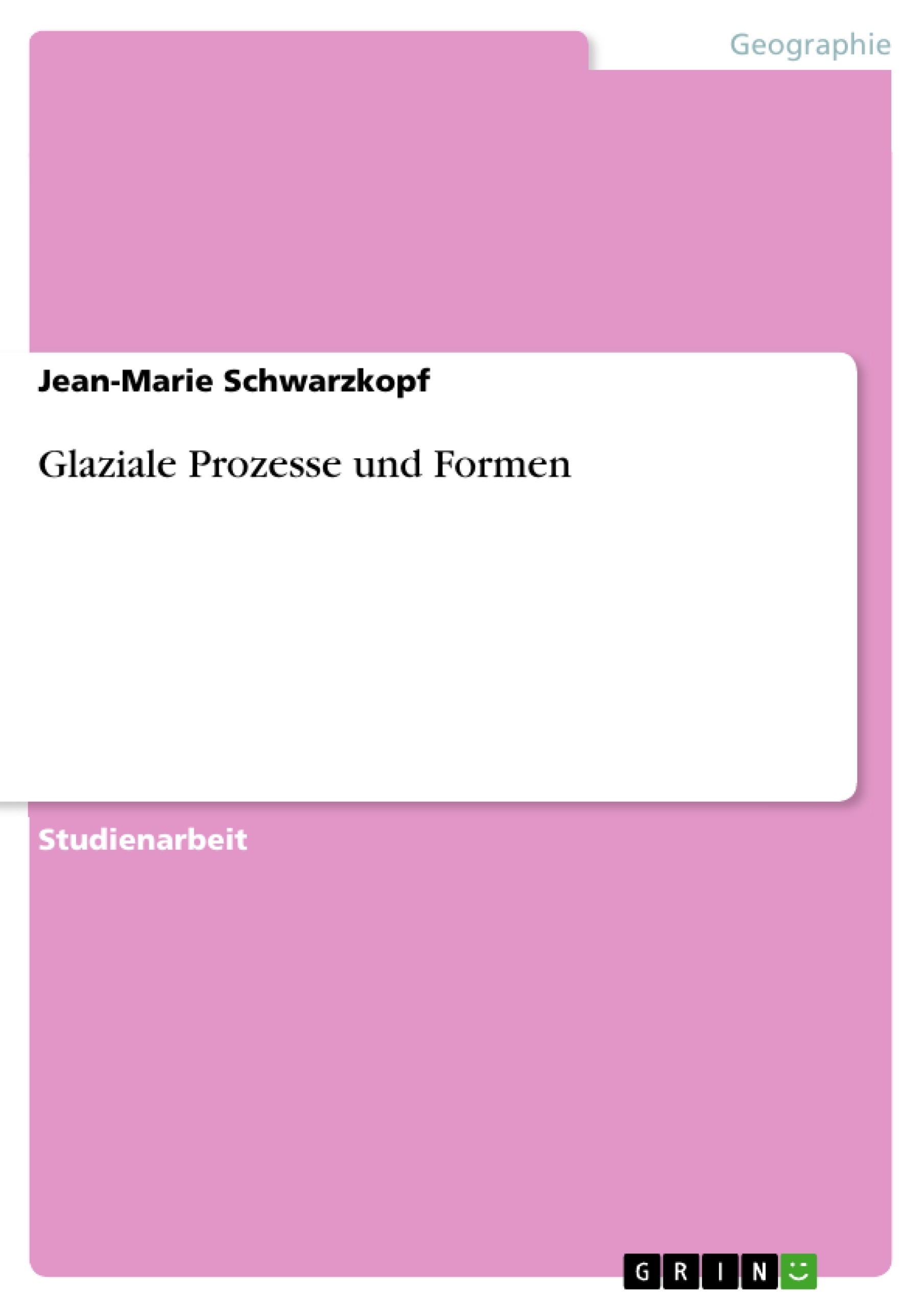Ungefähr 77% des Süßwasseranteils der Erde ist gefroren und befindet sich nahezu ruhend an zwei Orten – Grönland und Antarktis. Weitaus kleinere Süßwasserspeicher sind in den Hochgebirgen zu finden. Dieses Gletschereis bedeckt fast 10% der Festlandsfläche (14,9 Mio. km²). Als im Pleistozän eine letzte große Vereisung vorherrschte, wurde mehr als 30% der Landmasse durch die Gletscher abgedeckt (44,4 Mio. km²). Diese Zahlen machen deutlich, welch starke Massen in Gletschergebieten auf den Boden wirken. Wenn man das unmittelbare Umfeld eines Gletschers, also den Eisrand, betrachtet, wird die Morphodynamik ziemlich schnell erkennbar. Entweder wirkt das vorrückende oder abschmelzende Eis direkt am Untergrund oder das Schmelzwasser, das durch den Gletscher verursacht wurde, prägt den Untergrund indirekt. Weitgehend verborgen bleiben allerdings die geomorphologischen Auswirkungen innerhalb des Gletschers unter dem Eis. Wenn der Gletscher abschmilzt, werden diese offengelegt. Erst jetzt kann man die Wirkungen des Eises und des Schmelzwassers auf der Erdoberfläche genauer studieren.
In diesen Fällen entsteht ein Formenschatz, der auch als glazialer Formenschatz bezeichnet wird. Obwohl die Wirkung des fließenden Wassers großen Anteil an dieser Entstehung hat, denn überall da, wo es Gletscher gibt, gibt es auch Schmelzwasser, ist dies eine sinnvolle Bezeichnung. Die formschaffende Wirkung von Schmelzwasser rechtfertigt überdies, dass man sie als fluvioglazial oder glazifluvial nennt.
Großen Einfluss auf die Wärme- und Strahlungsbilanz der Erde übt das Gletschereis Grönlands und Antarktis aus. Wie oben schon erwähnt sind die riesigen Eismassen im festen Aggregatzustand gespeichertes Wasser, die einen großen Bestandteil der Wasserbilanz auf der Erde bilden. Kommt es aufgrund von Umwelteinflüssen zu Veränderungen der gespeicherten Eismassen, könnte dies große Auswirkungen auf das Niveau des Meeresspiegels im Vergleich zu den Landgebieten haben. Nach der letzten Vereisung der Eiszeit im Pleistozän kam es zu Abschmelzungsprozessen, die dazu geführt haben, dass der Meeresspiegel angestiegen ist und dabei haben sich die heutigen Küstenformen entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Gletscher
- Gletscherentstehung
- Gletscherdefinition
- Massenbilanz
- Gletscherbewegung
- Gletschertypen
- Nach der Orographie
- Nach thermischen Eigenschaften
- Glaziale Prozesse
- Glaziale Erosionsformen
- Glaziale Akkumulationsformen
- Glaziale Akkumulation
- Glazifluviale Akkumulation
- Glaziale Serie
- Eiszeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit behandelt die Thematik der glazialen Prozesse und Formen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Entstehung, Bewegung, Massenbilanz und der typischen Formen von Gletschern zu vermitteln.
- Entstehung und Entwicklung von Gletschern
- Gletscherdynamik und Massenbilanz
- Glaziale Erosions- und Akkumulationsformen
- Bedeutung von Gletschern für die Landschaftsentwicklung
- Die Rolle von Gletschern im Klimasystem der Erde
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Gletscher: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Gletscher ein und beleuchtet die Bedeutung dieser Eismassen für das Süßwasserhaushalt der Erde. Es werden die globalen Vorkommen von Gletschern sowie die Auswirkungen von Eiszeit und Gletscherschmelze auf die Landformen und den Meeresspiegel erläutert.
- Kapitel 2: Gletscherentstehung: Hier wird der Prozess der Gletscherbildung vom Schneefall bis zur Entstehung von Firn und Gletschereis beschrieben. Die Rolle von Temperatur, Niederschlag und Druck bei der Metamorphose von Schnee zu Eis wird detailliert erklärt.
- Kapitel 3: Gletscherdefinition: Dieses Kapitel definiert den Begriff Gletscher und beschreibt die wichtigsten Eigenschaften und Merkmale dieser Eismassen, einschließlich ihres Aufbaus und ihrer Bestandteile.
- Kapitel 4: Massenbilanz: In diesem Kapitel wird die Massenbilanz von Gletschern erläutert, welche die Differenz zwischen Akkumulation und Ablation beschreibt. Die Bedeutung dieser Bilanz für das Vorrücken oder den Rückzug von Gletschern sowie die Faktoren, die die Massenbilanz beeinflussen, werden diskutiert.
- Kapitel 5: Gletscherbewegung: Hier wird die Bewegung von Gletschern beschrieben, die durch die Gravitation und die innere Spannung des Eises verursacht wird. Die unterschiedlichen Arten der Gletscherbewegung, wie beispielsweise die Gleitbewegung und die interne Deformation, werden erläutert.
- Kapitel 6: Gletschertypen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Gletschertypen nach ihrer Lage, ihrer Entstehung und ihren thermischen Eigenschaften.
- Kapitel 7: Glaziale Prozesse: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Prozesse, die durch die Bewegung und das Abschmelzen von Gletschern entstehen, behandelt. Dazu gehören Erosion, Abtragung, Transport und Akkumulation von Gesteinsmaterial.
- Kapitel 8: Glaziale Erosionsformen: Dieses Kapitel beschreibt die typischen Erosionsformen, die durch Gletscher entstehen, wie beispielsweise Kare, Trogtäler und U-förmige Täler.
- Kapitel 9: Glaziale Akkumulationsformen: Dieses Kapitel behandelt die glazialen Akkumulationsformen, die durch die Ablagerung von Gesteinsmaterial durch Gletscher entstehen, wie Moränen, Drumlins und Sander.
- Kapitel 10: Glaziale Serie: In diesem Kapitel wird die glaziale Serie, also die Abfolge von glazialen Formen in einem bestimmten Gebiet, vorgestellt.
- Kapitel 11: Eiszeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Eiszeiten der Erdgeschichte und ihre Auswirkungen auf die Landschaftsentwicklung und das Klima.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit behandelt die wichtigsten Schlüsselbegriffe der Glaziologie. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Gletscherentstehung, Gletscherdynamik, Massenbilanz, glaziale Prozesse und Formen sowie der Rolle von Gletschern im Klimasystem der Erde. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind Akkumulation, Ablation, Erosionsformen, Akkumulationsformen, Firn, Gletschereis und Eiszeit.
- Quote paper
- Jean-Marie Schwarzkopf (Author), 2008, Glaziale Prozesse und Formen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198245