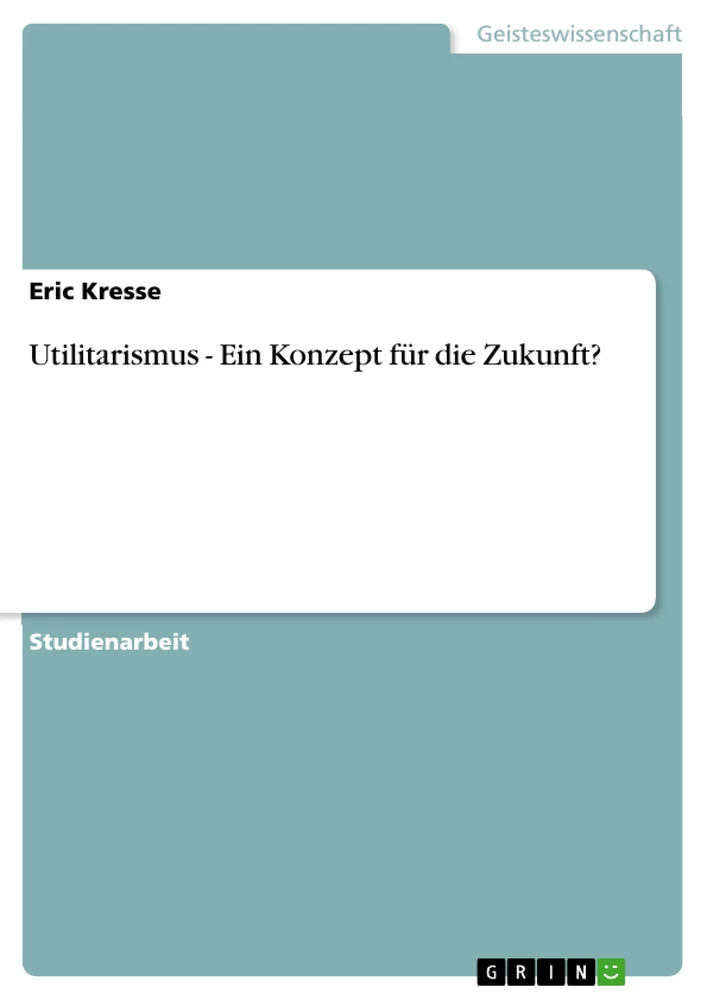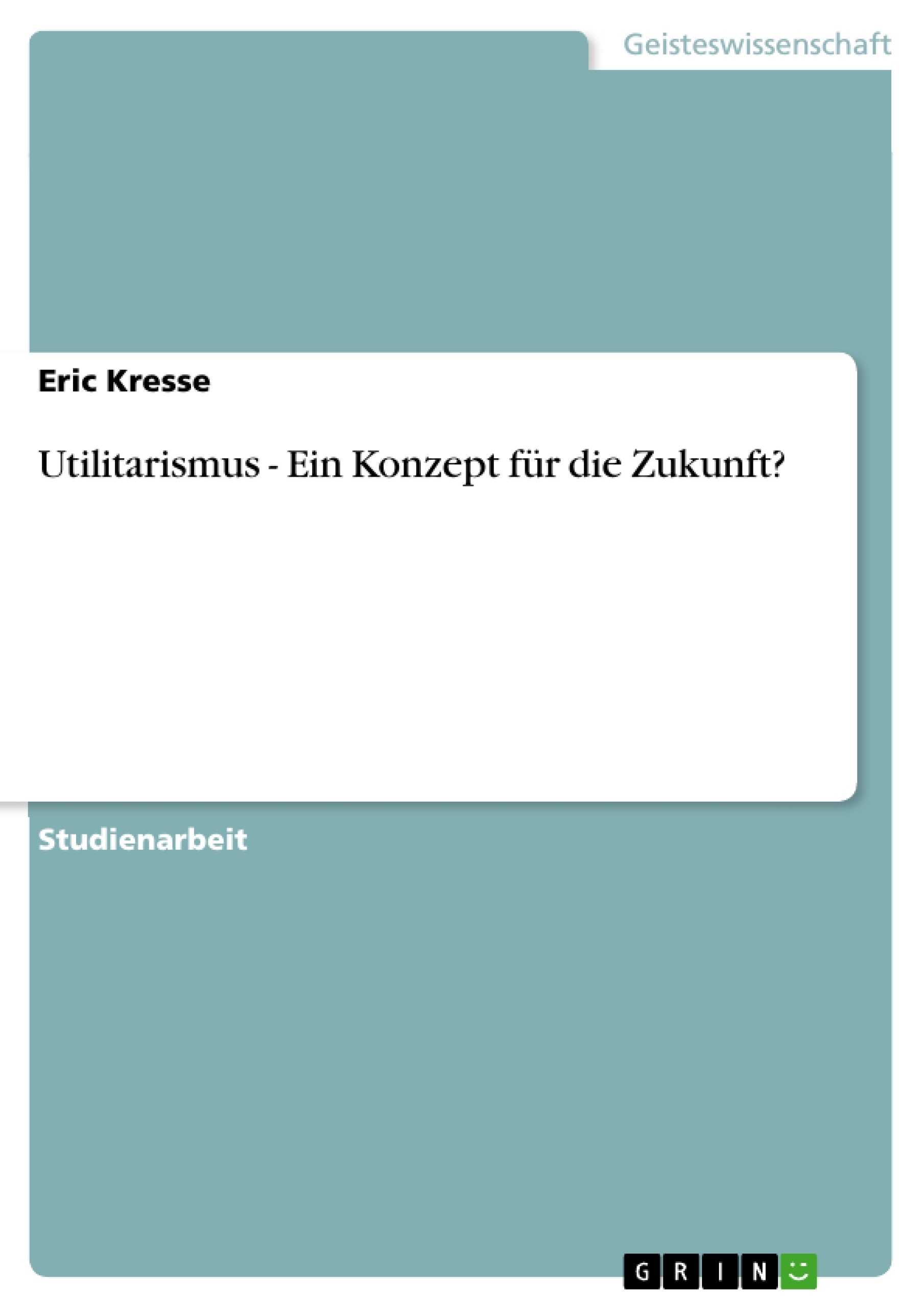In der heutigen von Globalisierung und Kapitalismus geprägten westlichen Welt, deren stringente Entwicklung in gewisser Weise vorgezeichnet, deren Richtung jedoch noch nicht eindeutig erkennbar ist, wird die Besinnung auf grundlegende Werte fundamental. Doch eine pluralistische Gesellschaft bietet hierzu unzählige Ansätze. Ist eine Rückbesinnung auf biblische Gebote die zukunftsweisende Antwort – wäre dies überhaupt mit der Macht des Geldes vereinbar? Diese bewusste Umwertung der Werte scheint kaum realisierbar.
Diese Ausarbeitung soll sich einem der Aspekte, der Betrachtung des Prinzips der Nützlichkeit, annehmen und diesen zunächst entwicklungs-historisch und folgend bewertend auf die moderne Gesellschaft betrachten. Somit wird dieser Arbeit neben dem sachlichen „Lexikon der Ethik“ das Hauptwerk des Utilitaristen John Stuart Mill „Utilitarismus“ sowie das interpretationsarme Buch „Zur Geschichte und Struktur der utilitaristischen Ethik“ von Wolfgang R. Köhler als Basisliteratur nutzen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Utilitarismus – eine erste definierende Betrachtung
2.1 Zur Entstehung des Utilitarismus
2.1.1 Jeremy Bentham
2.1.2 John Stuart Mill
2.1.3 Bentham und Mill im Vergleich
2.2 Eine utilitaristische Gesellschaft?
3. Utilitarismus – ein zukunftweisendes Konzept?
Verzeichnis verwendeter Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der heutigen von Globalisierung und Kapitalismus geprägten westlichen Welt, deren stringente Entwicklung in gewisser Weise vorgezeichnet, deren Richtung jedoch noch nicht eindeutig erkennbar ist, wird die Besinnung auf grundlegende Werte fundamental. Doch eine pluralistische Gesellschaft bietet hierzu unzählige Ansätze. Ist eine Rückbesinnung auf biblische Gebote die zukunftsweisende Antwort – wäre dies überhaupt mit der Macht des Geldes vereinbar? Diese bewusste Umwertung der Werte scheint kaum realisierbar.
Diese Ausarbeitung soll sich einem der Aspekte, der Betrachtung des Prinzips der Nützlichkeit, annehmen und diesen zunächst entwicklungs-historisch und folgend bewertend auf die moderne Gesellschaft betrachten. Somit wird dieser Arbeit neben dem sachlichen „Lexikon der Ethik“ das Hauptwerk des Utilitaristen John Stuart Mill „Utilitarismus“ sowie das interpretationsarme Buch „Zur Geschichte und Struktur der utilitaristischen Ethik“ von Wolfgang R. Köhler als Basisliteratur nutzen.
2. Utilitarismus – eine erste definierende Betrachtung
Zur Betrachtung utilitaristischer Tendenzen der Gesellschaft respektive ihrer futuristischen Möglichkeiten ist es zunächst erforderlich, den Gedanken des Utilitarismus in einen, wenn auch nicht zu eng gestalteten, Rahmen zu fassen. Ebenso ist die Darlegung fundamentaler Begriffe essentiell. Diese begründen sich im Folgenden vor allem auf das von Otfried Höffe verfasste „Lexikon der Ethik“. Der Begriff der „Nützlichkeitsmoral“[1] soll hierbei als definierender Leitfaden dienen.
Ein „Prinzip der Nützlichkeit“ lässt sich hierbei an den Auswirkungen einer Handlung für alle Betroffenen ableiten. Somit strebt der utilitaristische Grundgedanke nach dem größten Glück für die größtmögliche Zahl, um wiederum auf das Gemeininteresse zu wirken. Daher ist eine Handlung im Sinne des „Utilitätsprinzips“ dann als die wertvollste und unter mehreren als zweckmäßigste zu bewerten, wenn ihre Folgen den größten Nutzen erzielen. Ferner ist die moralische Richtigkeit einer Handlung nur an ihrem Folgen ableitbar – nicht aus der Handlung selbst. Durch dieses „Konsequenzen-Prinzip“ wird deutlich, dass dieser Ansatz keine einheitliche Theorie der Moral beinhaltet und der normativen Ethik zuzuordnen ist. Die Freude aus der Erfüllung menschlicher Bedürfnisse bildet hierbei die Maßeinheit des „hedonistischen Prinzips“.
Durch eine Konzentration auf das Glück aller rückt die bewusste Wahrnehmung des Selbstinteresses in den Hintergrund und verschwindet gar in Anbetracht breiter Massen.[2]
Und so versucht auch der Utilitarismus Antworten auf alte Fragen wie Was soll ich tun? oder Wie sollen wir leben? zu geben.
2.1 Zur Entstehung des Utilitarismus
2.1.1 Jeremy Bentham
„Jeder zählt als einer und keiner als mehr für einen“ – dieses Zitat Benthams verdeutlicht seine utilitaristischen Grundgedanken und soll fortführend als Richtschnur zu Darlegung seiner Philosophie dienen.
Der englische Philosoph und Jurist (1748-1832) vertrat zur Zeit der industriellen Revolution radikale Ansichten nach juristischen, sozialen und wirtschaftlichen Reformen. In Anbetracht dieser politischen Gedanken ist die enorme Bedeutung des Glücks nachzuvollziehen. Leid und Freude sieht er als naturgegebene Konstanten des Menschen an und nimmt diese als Maß, da sie - gleich welcher soziale Stand - für jeden Menschen gleichsam gewichten.[3]
Hieran definiert Bentham nun das Prinzip der Nützlichkeit anhand eines von ihm aufgestellten hedonistischen Nutzenkalküls, in dem er alle erdenklichen Empfindungen von Freude und Leid nach Stärke und Dauer gegeneinander aufrechnet und eine Gesamtbilanz des menschlichen Glücks aufstellt. Demnach operationalisiert er Empfindungen, um sie rechnerisch gegeneinander aufwiegen zu können. Ferner setzt er persönliches und allgemeines Wohlergehen gleich und schließt daraus das fundamentale Prinzip des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl. An dieser Stelle ist ein demokratischer Grundgedanke kaum abzuweisen und geht einher mit der menschlichen Sittlichkeit, resultierend aus einem bewussten menschlichen Streben nach Glück.
[...]
[1] Vgl. Otfried Höffe: Lexikon der Ethik, 5. neubearbeitete und erweiterte Auflage, München 1997, S. 312.
[2] Vgl. Otfried Höffe: [FN1], S.312.
[3] Vgl. Wilhelm Hofmann: Politik des aufgeklärten Glücks. Jeremy Benthams philosophisch-politisches Denken, Berlin 2002, S.157 – 158.
- Quote paper
- Eric Kresse (Author), 2009, Utilitarismus - Ein Konzept für die Zukunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198236