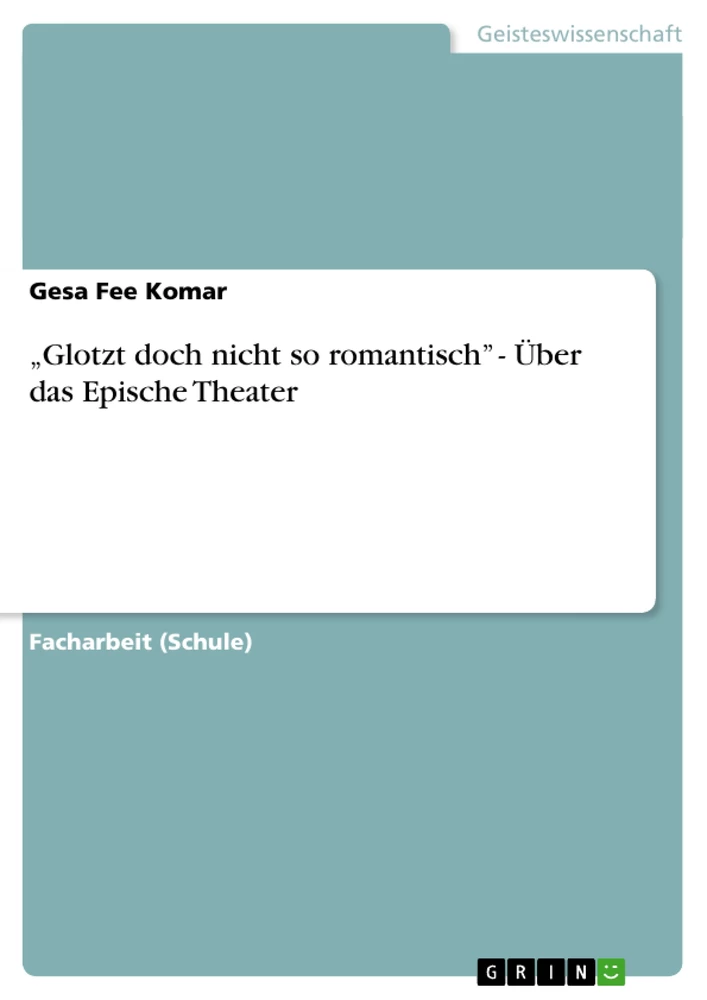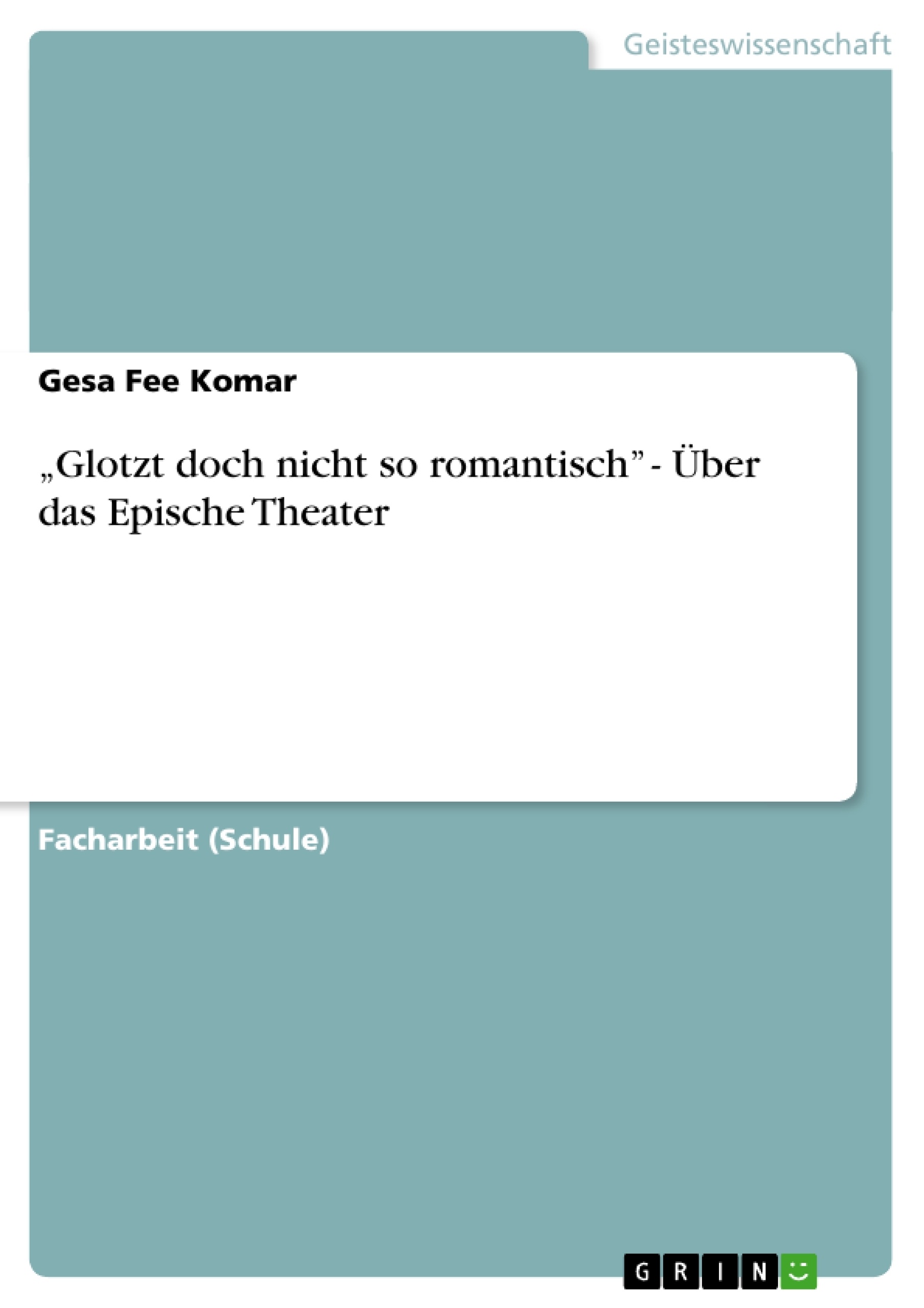Mit der Bezeichnung des epischen Theaters wird vor allem das Werk von Bertolt Brecht (1898-1956) verbunden. Brecht beabsichtigt mit seinen Stücken, die Wirklichkeit als veränderungsbedürftig darzustellen. Dabei geht es ihm weniger darum, die Zuschauer zum Mitfühlen anzuregen als vielmehr ihre kritische Haltung zu erwecken. Dies hat er mit dem Spruch „Glotzt doch nicht so romantisch“ exemplarisch zum Ausdruck gebracht. Er möchte damit sicherstellen, dass jegliche Illusion vermieden wird: „Nicht miterleben soll der Zuschauer, sondern sich auseinandersetzen.“
Brechts Theater ist ein radikaler Schnitt zu den zeitgenössischen Theatergewohnheiten und die Aufführungen sind als skandalös empfunden worden, wie folgendes Zitat aus der Badischen Volkszeitung vom 30. Juli 1929 verdeutlicht:
„Wenn Herr Brecht meint, mit dem Publikum Schindluder treiben zu können, so hat dasselbe das Recht, sich dagegen aufzulehnen, und wir freuen uns, daß es von diesem Recht der Selbsthilfe durch Pfeifen und Toben Gebrauch machte, […] weil mit einer Brutalität auf die Nerven der Leute, die ohnehin schon überreizt waren, herumgetrampelt wurde, die etwas geradezu Sadistisches hatte.“
Im Folgenden wird zunächst eine Definition des epischen Theaters angeführt, um die wichtigsten Elemente zu kennzeichnen. Die Entstehungsgeschichte dieser Gattung schließt sich an, bevor deren Merkmale erläutert und am Beispiel von Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ veranschaulicht werden. Den Schluss bildet ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Episches Theater
2.1 Definition
2.2 Entstehungsgeschichte
2.3 Merkmale
2.3.1 Der Verfremdungseffekt
2.4 Exemplarische Veranschaulichung: Mutter Courage und ihre Kinder
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mit der Bezeichnung des epischen Theaters wird vor allem das Werk von Bertolt Brecht (1898-1956) verbunden. Brecht beabsichtigt mit seinen Stücken, die Wirklichkeit als verände- rungsbedürftig darzustellen. Dabei geht es ihm weniger darum, die Zuschauer zum Mitfühlen anzuregen als vielmehr ihre kritische Haltung zu erwecken. Dies hat er mit dem Spruch „Glotzt doch nicht so romantisch“1 exemplarisch zum Ausdruck gebracht. Er möchte damit sicherstellen, dass jegliche Illusion vermieden wird: „Nicht miterleben soll der Zuschauer, sondern sich auseinandersetzen.“2
Brechts Theater ist ein radikaler Schnitt zu den zeitgenössischen Theatergewohnheiten und die Aufführungen sind als skandalös empfunden worden, wie folgendes Zitat aus der Badischen Volkszeitung vom 30. Juli 1929 verdeutlicht:
„Wenn Herr Brecht meint, mit dem Publikum Schindluder treiben zu können, so hat dasselbe das Recht, sich dagegen aufzulehnen, und wir freuen uns, daß es von diesem Recht der Selbsthilfe durch Pfeifen und Toben Gebrauch machte, […] weil mit einer Brutalität auf die Nerven der Leute, die ohnehin schon überreizt waren, herumgetrampelt wurde, die etwas geradezu Sadistisches hatte.“3
Im Folgenden wird zunächst eine Definition des epischen Theaters angeführt, um die wichtigsten Elemente zu kennzeichnen. Die Entstehungsgeschichte dieser Gattung schließt sich an, bevor deren Merkmale erläutert und am Beispiel von Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ veranschaulicht werden. Den Schluss bildet ein Fazit.
2. Episches Theater
2.1 Definition
Das epische Theater (gr. épos: erzählende Dichtung) ist ein Konzept Bertolt Brechts, in dem er die Behandlung gesellschaftlicher Fragen bezweckt.4 Entscheidendes Kriterium des epi- schen Theaters ist sein Realismus,5 weil es den Zeitbezug und die gesellschaftliche Relevanz betont.6 Das epische Theater will den Zuschauer aktivieren und zu politischen Entscheidun- gen drängen. Nicht primär die Einfühlung des Zuschauers wird angestrebt, sondern dessen Auseinandersetzung mit dem Geschehen und die Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten.
Um die Einfühlung des Zuschauers in das Bühnengeschehen zu verhindern, wird der Verfremdungseffekt (V-Effekt) eingesetzt. Mit dieser zentralen Kategorie appelliert das epische Theater an den Verstand des Zuschauers7 und möchte zu einem umfassenden Lernprozess beitragen.8 Dies ist ein dialektischer Vermittlungsprozess, den der Zuschauer selbst zwischen Wirklichkeit und Bühnenvorgängen aktiv vollziehen muss.9
Bertolt Brecht hat diese Form des Bühnenstücks nicht nur entwickelt, sondern auch theoretisch begründet. Er grenzt damit das epische Theater als distanzierende und demonstrierende Darstellung klar vom dramatischen Theater ab.10
2.2 Entstehungsgeschichte
Die Gattung „Episches Theater“ entwirft Brecht in Berlin zur Zeit der Weimarer Republik.11 Anregungen erhält er durch den Regisseur und Theaterleiter Erwin Piscator (1893-1966) und dessen Inszenierungen am 1919 gegründeten „Proletarischen Theater“, wo er selbst teilweise mitarbeitet.12 Im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ fordert er Nüchternheit auf der Bühne und im Zuschauerraum. Das Publikum soll „wie im Sportpalast“ die Vorgänge auf der Bühne verfol- gen.13
Brechts Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg und den damit verbundenen Massen- schlachten ist für sein Schaffen prägend. In seinen Werken verarbeitet er die Krisen der Zeit und möchte vor allem soziale Fragen für die Zuschauer durchschaubar machen.14 Er schreibt u.a. die Stücke „Mann ist Mann“, „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ und die „Dreigro- schenoper“. Zu dem Werk „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ verfasst er in den An- merkungen eine Grundkonzeption des epischen Theaters. In einem Schema stellt er die dra- matische Form und die epische Form einander gegenüber.15 Im Exil ab 1933 baut er seine Theorie weiter aus und es entsteht eine Reihe seiner Hauptwerke wie z.B. „Mutter Courage und ihre Kinder“. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ihm in Ostberlin ein eigenes Theater, das „Berliner Ensemble“, für die Aufführung seiner Stücke zur Verfügung gestellt worden.16
[...]
1 Brecht, zit. nach Gronemeyer, Theater, S. 148.
2 Brecht, zit. nach Simhandl, Theatergeschichte, S. 248.
3 Badische Volkszeitung, Baden-Baden, vom 30. Juli 1929, zit. nach Fischer-Lichte (2010), S. 229f.
4 Vgl. Kittstein, Brecht, S. 37.
5 Vgl. Simhandl, Theatergeschichte, S. 248.
6 Vgl. Art. „Episches Theater“, in: Fischer-Lichte et al., Theatertheorie, S. 90f.
7 Vgl. Art. „Episches Theater“, in: Duden Literatur (2006), S. 74.
8 Vgl. Kittstein, Brecht, S. 38.
9 Vgl. Fischer-Lichte, Drama, S. 239.
10 Vgl. Art. „Episches Theater“, in: Fischer-Lichte et al. (2005), S. 90.
11 Vgl. Simhandl, Theatergeschichte, S. 245-248.
12 Vgl. Gronemeyer, Theater, S. 144f.
13 Vgl. Simhandl, Theatergeschichte, S. 245-248.
14 Vgl. Art. „Episches Theater und Lehrstücke“, in: Duden Literatur (2006), S. 379.
15 Vgl. Simhandl, Theatergeschichte, S. 245-248.
16 Vgl. Gronemeyer, Theater, S. 148.
- Quote paper
- Gesa Fee Komar (Author), 2010, „Glotzt doch nicht so romantisch” - Über das Epische Theater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198195