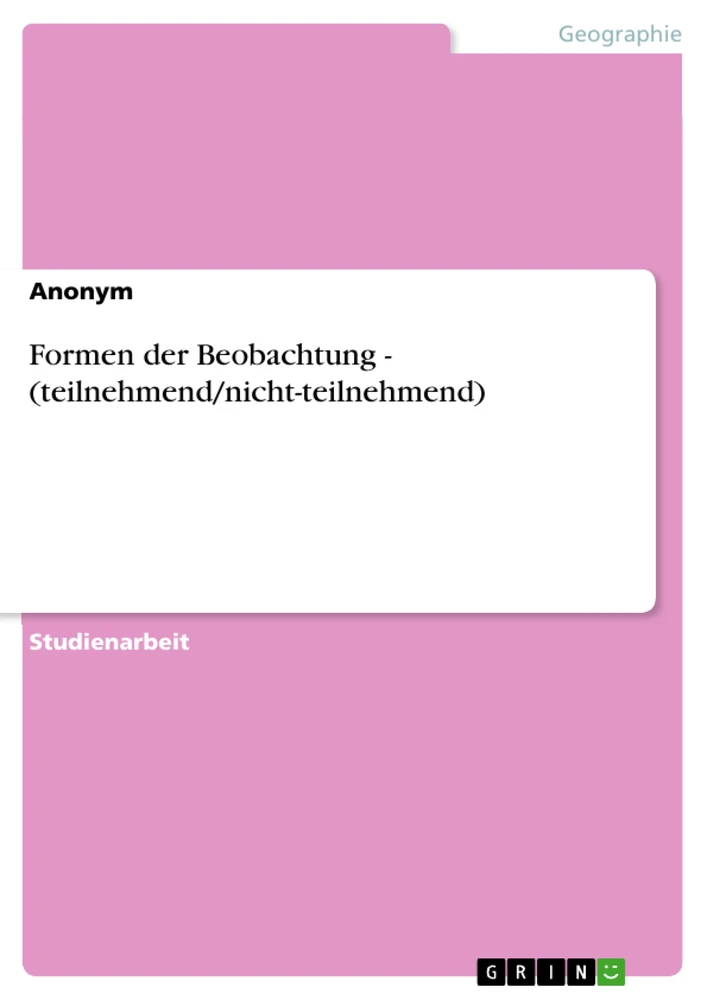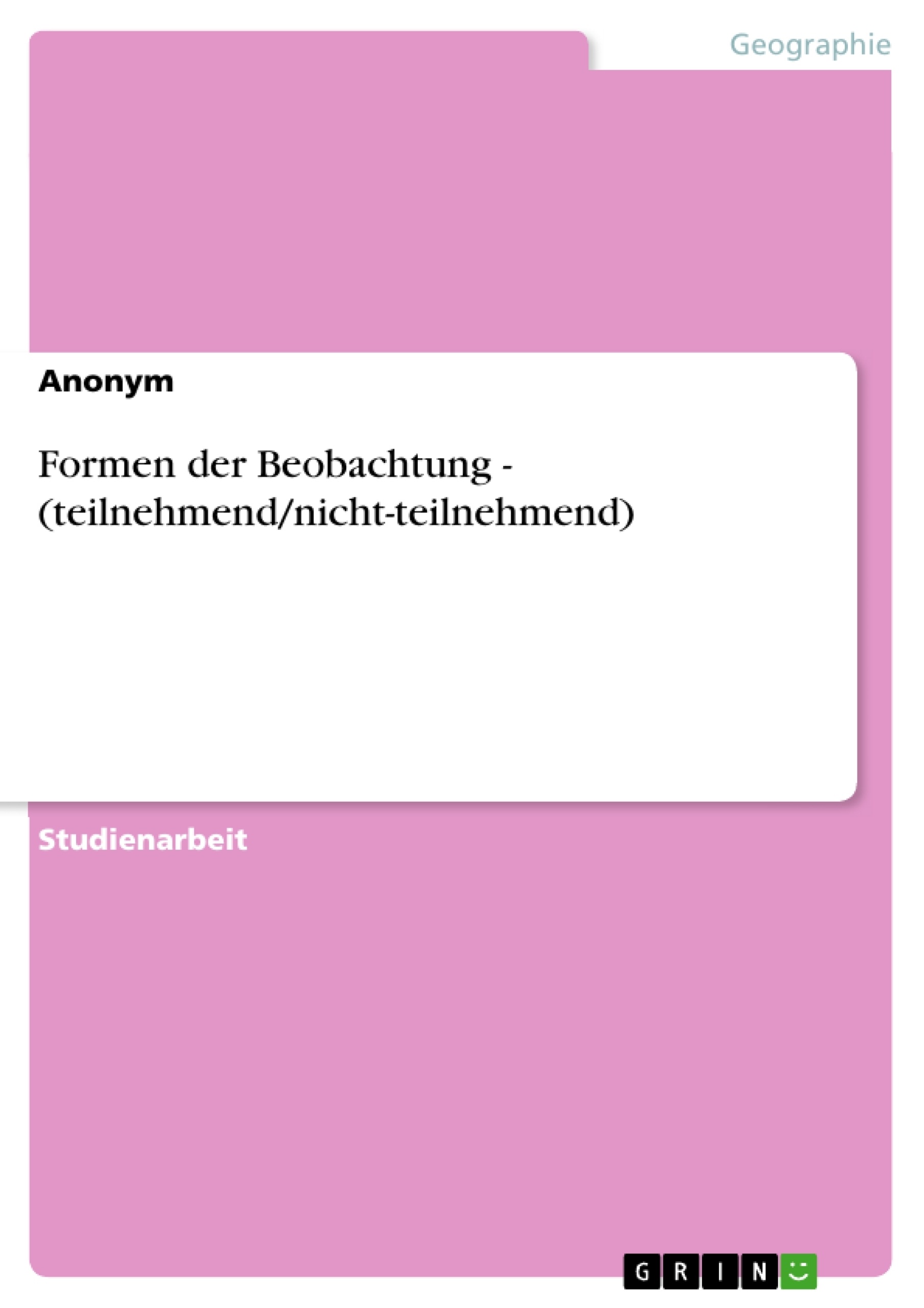Der Mensch beobachtet in seinem sozialen Leben täglich seine Umwelt und seine Mitmenschen, die Ihn umgeben. Dadurch verschafft er sich eine Rekonstruktion der Wirklichkeit, die er für sich individuell interpretiert und bewertet. Durch die eigene Kultur und Wertevorstellung selektiert er dabei die Wahrnehmung und kommt somit zu einem eigenen Bild der Wirklichkeit. Dabei kann eine selbe Situation von verschiedenen Beobachtern völlig anders wahrgenommen und interpretiert werden. So fällt beispielsweise die Bewertung eines Abends mit Freunden durchaus unterschiedlich zwischen den Anwesenden aus. Der eine empfand den gemeinsamen Abend beispielsweise als angenehm, wohingegen der andere durch eine bestimmte Situation die Stimmung als angespannt oder auch für sich persönlich als bedrohlich empfand. Daraus resultierend bewerten die zwei Personen in diesem Beispiel Beobachtungen, die beide an diesem Abend gemacht haben, völlig unterschiedlich.
Dieses kleine Beispiel zeigt die Problematik des Themas. Um die Kriterien einer wissenschaftlichen Beobachtung erfüllen zu können, muss eine gewisse Objektivität entstehen, welche es ermöglicht, Beobachtungen von verschiedenen Beobachtern zu vergleichen und auch zusammenfassen zu können. Zudem ist der Anspruch der objektiven Richtigkeit der Beobachtung zu gewährleisten.
Die vorliegende Seminararbeit soll versuchen, Kriterien für eine wissenschaftlich anwendbare Beobachtung zu formulieren. Dabei sollen zudem verschiedene Formen der Beobachtung erläutert werden, was jedoch aufgrund des Umfanges der Arbeit nur auf den Aspekt der strukturierten bzw. unstrukturierten und der teilnehmenden bzw. nicht- teilnehmenden Beobachtung ausgedehnt werden kann.
Trotzdem soll versucht werden, die Beobachtung schlussendlich in das Themengebiet der empirischen Methoden einzusortieren und den Stellenwert in diesem System zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Formen der Beobachtung
- 2.1 Abgrenzung zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung
- 2.2 Strukturierte und unstrukturierte Beobachtung
- 2.3 Teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtung
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, Kriterien für eine wissenschaftlich anwendbare Beobachtung zu formulieren und verschiedene Formen der Beobachtung zu erläutern. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen strukturierter/unstrukturierter und teilnehmender/nicht-teilnehmender Beobachtung. Die Arbeit versucht, die Beobachtung im Kontext empirischer Methoden einzuordnen und ihren Stellenwert zu bewerten.
- Abgrenzung zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung
- Unterscheidung verschiedener Beobachtungsformen (strukturiert/unstrukturiert, teilnehmend/nicht-teilnehmend)
- Kriterien für eine wissenschaftlich fundierte Beobachtung
- Einordnung der Beobachtung in empirische Methoden
- Bewertung des Stellenwerts der Beobachtung in der empirischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beobachtung ein und verdeutlicht die Unterschiede zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Beobachtung anhand eines Beispiels eines gemeinsamen Abends mit Freunden. Sie hebt die Notwendigkeit der Objektivität in der wissenschaftlichen Beobachtung hervor und benennt das Ziel der Arbeit: die Formulierung von Kriterien für eine wissenschaftlich anwendbare Beobachtung sowie die Erläuterung verschiedener Beobachtungsformen, beschränkt auf strukturierte/unstrukturierte und teilnehmende/nicht-teilnehmende Beobachtung. Die Einleitung betont die Einordnung der Beobachtung in empirische Methoden und die Bewertung ihres Stellenwerts.
2 Formen der Beobachtung: Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition von Beobachtung im Kontext von Wahrnehmung. Es wird der Unterschied zwischen allgemeiner Wahrnehmung und gezielter Beobachtung herausgestellt. Anhand eines Beispiels von Personen in einem Café wird der Übergang von Wahrnehmung zu Beobachtung verdeutlicht. Das Kapitel charakterisiert Beobachtung als das Erfassen von Handlungszusammenhängen und betont die Bedeutung verbaler und nonverbaler Signale sowie Kontextbedingungen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Unterscheidung verschiedener Beobachtungsformen, um die Komplexität des Beobachtungs-Prozesses wissenschaftlich zu greifen.
2.1 Abgrenzung zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung: Dieses Unterkapitel betont den Unterschied zwischen alltäglicher, naiver Beobachtung und wissenschaftlicher Beobachtung. Es wird hervorgehoben, dass alltägliche Beobachtungen oft Ausgangspunkt für wissenschaftliche Fragestellungen sind. Der Schlüssel zur Unterscheidung liegt in der Systematik: Wissenschaftliche Beobachtung ist geplant, kontrolliert und einer bestimmten Fragestellung verpflichtet, im Gegensatz zur zufälligen, alltäglichen Beobachtung. Die Notwendigkeit von Standards für wissenschaftliche Beobachtung wird betont, um Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Beobachtung, wissenschaftliche Beobachtung, naive Beobachtung, strukturierte Beobachtung, unstrukturierte Beobachtung, teilnehmende Beobachtung, nicht-teilnehmende Beobachtung, empirische Methoden, Objektivität, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Formen der Beobachtung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit den verschiedenen Formen der Beobachtung, insbesondere im wissenschaftlichen Kontext. Sie erläutert die Unterschiede zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung, strukturierter und unstrukturierter Beobachtung sowie teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtung. Die Arbeit formuliert Kriterien für eine wissenschaftlich anwendbare Beobachtung und bewertet deren Stellenwert in empirischen Methoden.
Welche Arten der Beobachtung werden behandelt?
Die Seminararbeit behandelt folgende Arten der Beobachtung: naive Beobachtung, wissenschaftliche Beobachtung, strukturierte Beobachtung, unstrukturierte Beobachtung, teilnehmende Beobachtung und nicht-teilnehmende Beobachtung. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung und Charakterisierung dieser Formen.
Wie unterscheidet sich naive von wissenschaftlicher Beobachtung?
Der Hauptunterschied zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung liegt in der Systematik. Naive Beobachtung ist zufällig und ungeplant, während wissenschaftliche Beobachtung geplant, kontrolliert und einer bestimmten Fragestellung verpflichtet ist. Wissenschaftliche Beobachtung strebt nach Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch festgelegte Standards.
Was sind die Kriterien für eine wissenschaftlich fundierte Beobachtung?
Die Seminararbeit formuliert Kriterien für eine wissenschaftlich anwendbare Beobachtung, die unter anderem die Planung, Kontrolle, Objektivität und die Orientierung an einer spezifischen Fragestellung beinhalten. Die Einhaltung dieser Kriterien gewährleistet die Vergleichbarkeit und Validität der Ergebnisse.
Welche Rolle spielt die Beobachtung in empirischen Methoden?
Die Seminararbeit ordnet die Beobachtung in den Kontext empirischer Methoden ein und bewertet ihren Stellenwert. Beobachtung wird als wichtige Methode zur Datenerhebung in der empirischen Forschung dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Formen der Beobachtung (mit Unterkapiteln zur Abgrenzung zwischen naiver und wissenschaftlicher Beobachtung sowie zur Unterscheidung strukturierter/unstrukturierter und teilnehmender/nicht-teilnehmender Beobachtung) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Beobachtung, wissenschaftliche Beobachtung, naive Beobachtung, strukturierte Beobachtung, unstrukturierte Beobachtung, teilnehmende Beobachtung, nicht-teilnehmende Beobachtung, empirische Methoden, Objektivität, Wahrnehmung.
Wo finde ich einen Überblick über den Inhalt der Kapitel?
Die Seminararbeit bietet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte jedes Abschnitts zusammenfasst und den Lesefluss erleichtert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Formen der Beobachtung - (teilnehmend/nicht-teilnehmend), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198189