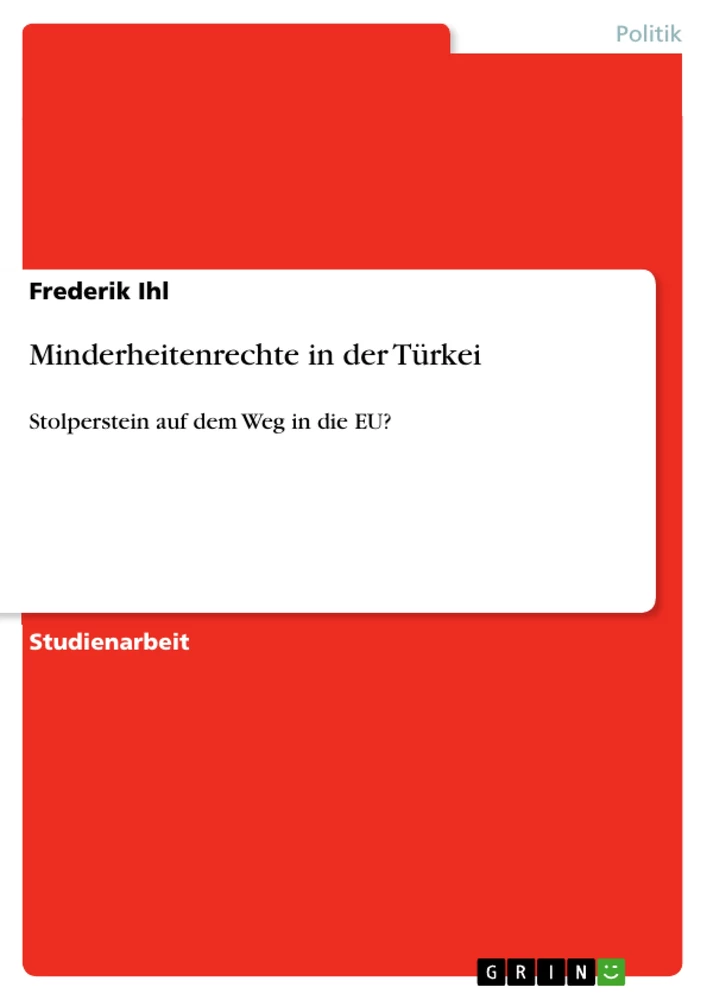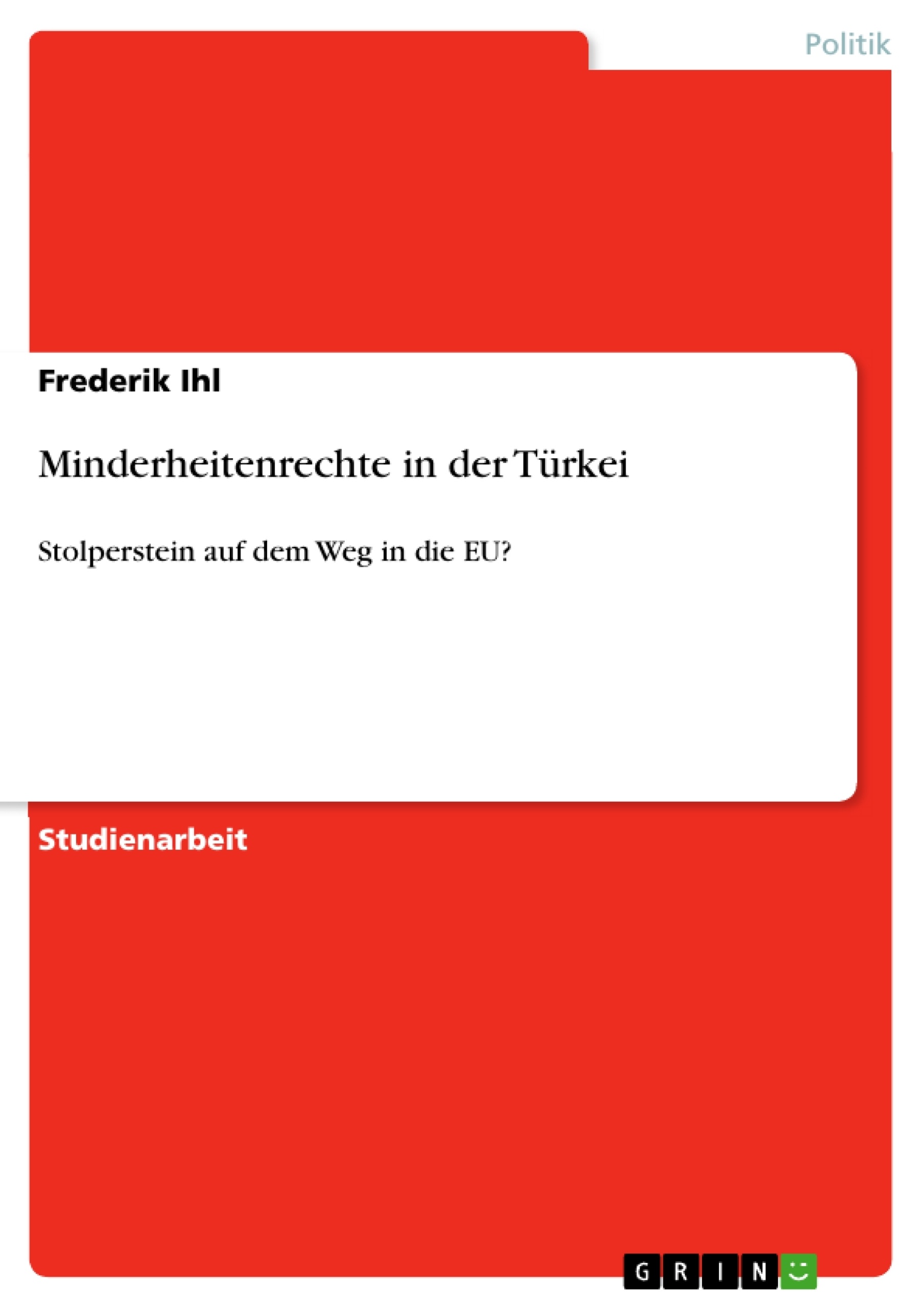Seit der Anerkennung der Türkei als Beitrittskandidat durch die Europäische Union beim Gipfeltreffen von Helsinki im Dezember 1999, bemüht sich die Türkei die entsprechenden Voraussetzungen für einen möglichst zeitnahen Beitritt zu erfüllen. Mit dem Ziel der vollständigen Integration in die europäische Staatengemeinschaft, stieß die politische Führung unter Ministerpräsident Erdogan auch ein Reformbündel zur Verbesserung der Minderheitenrechte an, welches durch die Kopenhagener Kriterien angeleitet wurde und trotzdem eine Debatte um den wirklichen Reformwillen, aber auch die Kompatibilität der Türkei mit europäischen Menschenrechtsstandards auslöste. Im Folgenden wird diskutiert, inwieweit der türkische Staat die Vorgaben der Europäischen Union bezüglich der Minderheitenrechte von nichtmuslimischen Glaubensgemeinschaften sowie von muslimischen Kurden bereits umsetzen konnte und welche Möglichkeiten bestehen, dass auch die bisher ungelösten Beitrittsvoraussetzungen noch erfüllt werden können. Diese Fragen leiten zur These, dass die Transformation der Türkei bezüglich der Rechte für religiöse oder kulturelle Minderheiten noch keinesfalls abgeschlossen ist und traditionelle Strukturen trotz Reformbemühungen bisher noch die Antidiskriminierung fördern und die vollständige Integration von Minderheiten verhindern.
Seit der Anerkennung der Türkei als Beitrittskandidat durch die Europäische Union beim Gipfeltreffen von Helsinki im Dezember 1999, bemüht sich die Türkei die ent- sprechenden Voraussetzungen für einen möglichst zeitnahen Beitritt zu erfüllen. Mit dem Ziel der vollständigen Integration in die europäische Staatengemeinschaft, stieß die politische Führung unter Ministerpräsident Erdogan auch ein Reformbündel zur Verbes- serung der Minderheitenrechte an, welches durch die Kopenhagener Kriterien angeleitet wurde und trotzdem eine Debatte um den wirklichen Reformwillen, aber auch die Kom- patibilität der Türkei mit europäischen Menschenrechtsstandards auslöste. Im Folgen- den wird diskutiert, inwieweit der türkische Staat die Vorgaben der Europäischen Union bezüglich der Minderheitenrechte von nichtmuslimischen Glaubensgemeinschaften so- wie von muslimischen Kurden bereits umsetzen konnte und welche Möglichkeiten be- stehen, dass auch die bisher ungelösten Beitrittsvoraussetzungen noch erfüllt werden können. Diese Fragen leiten zur These, dass die Transformation der Türkei bezüglich der Rechte für religiöse oder kulturelle Minderheiten noch keinesfalls abgeschlossen ist und traditionelle Strukturen trotz Reformbemühungen bisher noch die Antidiskriminie- rung fördern und die vollständige Integration von Minderheiten verhindern.
Basierend auf der kemalistischen beziehungsweise laizistischen Tradition der Türki- schen Republik sowie der Ratifizierung des Lausanner Vertrages über den Schutz von Minderheiten wurden gesetzlich drei Minderheiten anerkannt. Neben den Juden genie- ßen auch die armenischen und griechisch-orthodoxen Christen die internationalen Min- derheitenrechte (vgl. Oran 2007: 35ff.). Ferner existiert keine gesetzliche Definition ei- ner Minderheit in der Türkei, weshalb Verteidiger der Minderheitenpolitik der Türkei stets auf den genannten Vertrag von 1923 verweisen (vgl. Rohleder 2010: 24ff.). Trotz der zeitnahen Anerkennung aller Minderheiten in der türkischen Republik durch die re- gierende AKP seit den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union ab 2005 (vgl. Hermann 2004: 113), zeigt sich in diesem Aspekt die Diskrepanz zwischen den Worten der führenden Politiker und der stetigen Antidiskriminierung der Minderheiten in der Realität (vgl. Chatzimarkakis 2006: 91): Obwohl sich die Politik willens zeigt die Missstände der Minderheitenproblematik zu beseitigen und gleichzeitig den Rückstand zur europäischen Union zu verkleinern, scheitern viele Reformvorhaben an der prakti- schen Umsetzung und schaffen eine unzureichende „conflicting situation between the de jure and de facto habitat of minority rights“ (Toktas / Aras 2009: 705). Befürworter des aktuellen Entwicklungsstandes loben die adäquaten Verbesserungen der Minderhei- tensituation von nichtmuslimischen Bürgern bezüglich der Kopenhagener Kriterien seit dem Regierungswechsel 2002 unter Recep Tayyip Erdogan und sehen nur noch ganz vereinzelten Nachholbedarf (vgl. Bardakci 2008: 260). Darüber hinaus scheinen vor al- lem die Bemühungen um eine liberalere Position gegenüber den nichtmuslimischen Minderheiten in der Türkei aufgrund des europäischen Drucks intensiviert zu werden. Neue Möglichkeiten und Freiheiten der Religionsgemeinschaften wurden durch unter- schiedliche Reformpakete auf legislativer Ebene geschaffen und verfolgen das Ziel der vollständigen Religions- sowie Glaubensfreiheit. Konkret wirbt die türkische Regierung mit den Rechten auf Eigentum, den Grunderwerb und Versammlungsräume für die je- weiligen Glaubensgemeinden (vgl. Kramer 2004: 15f.) Jedoch ist entgegenzusetzen, dass diese drei Entwicklungen in der alltäglichen Praxis nicht zu erkennen sind: Das freie Ausleben einer nichtmuslimischen Religion wird durch die zuständigen Behörden weiterhin massiv durch Verzögerungen von diversen Anträgen und Diskriminierungen verhindert und lässt die angestrebte Reformbereitschaft seit dem Beginn der Beitritts- verhandlungen deutlich vermissen (vgl. Sen 2006: 10). Auch das Amt für Religiöse An- gelegenheiten, Diyanet , wird von Kritikern beanstandet. Nicht nur die fehlende Ausbil- dung von nichtmuslimischen Geistlichen, sondern auch die aktive Verhinderung der freien Ausübung eines Glaubens steht im Gegensatz zu den europäischen Leitlinien des Minderheitenschutzes. Kritiker fordern aufgrund des großen Einflusses auf nichtmusli- mische Minderheiten eine Abschaffung oder Neuausrichtung dieser Behörde, die für jegliche Religion objektiv und problemorientiert Lösungen für das Zusammenleben in der Türkei erarbeiten sollte (vgl. Chatzimarkakis 2006: 92ff., Bürgin 2007: 91ff.).
[...]
- Quote paper
- Frederik Ihl (Author), 2011, Minderheitenrechte in der Türkei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197900