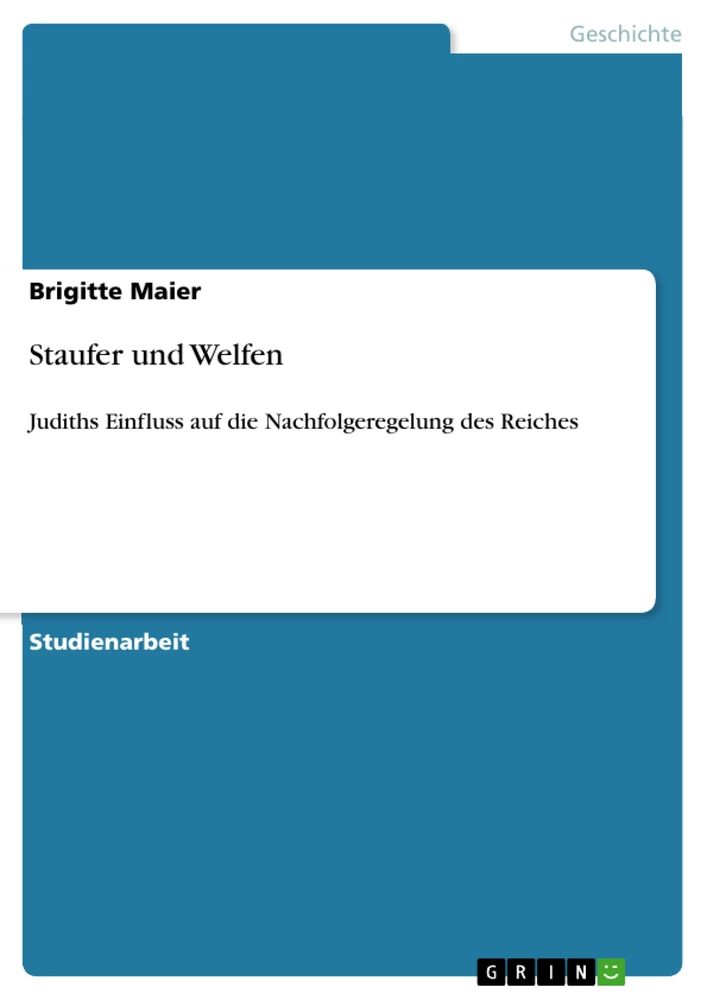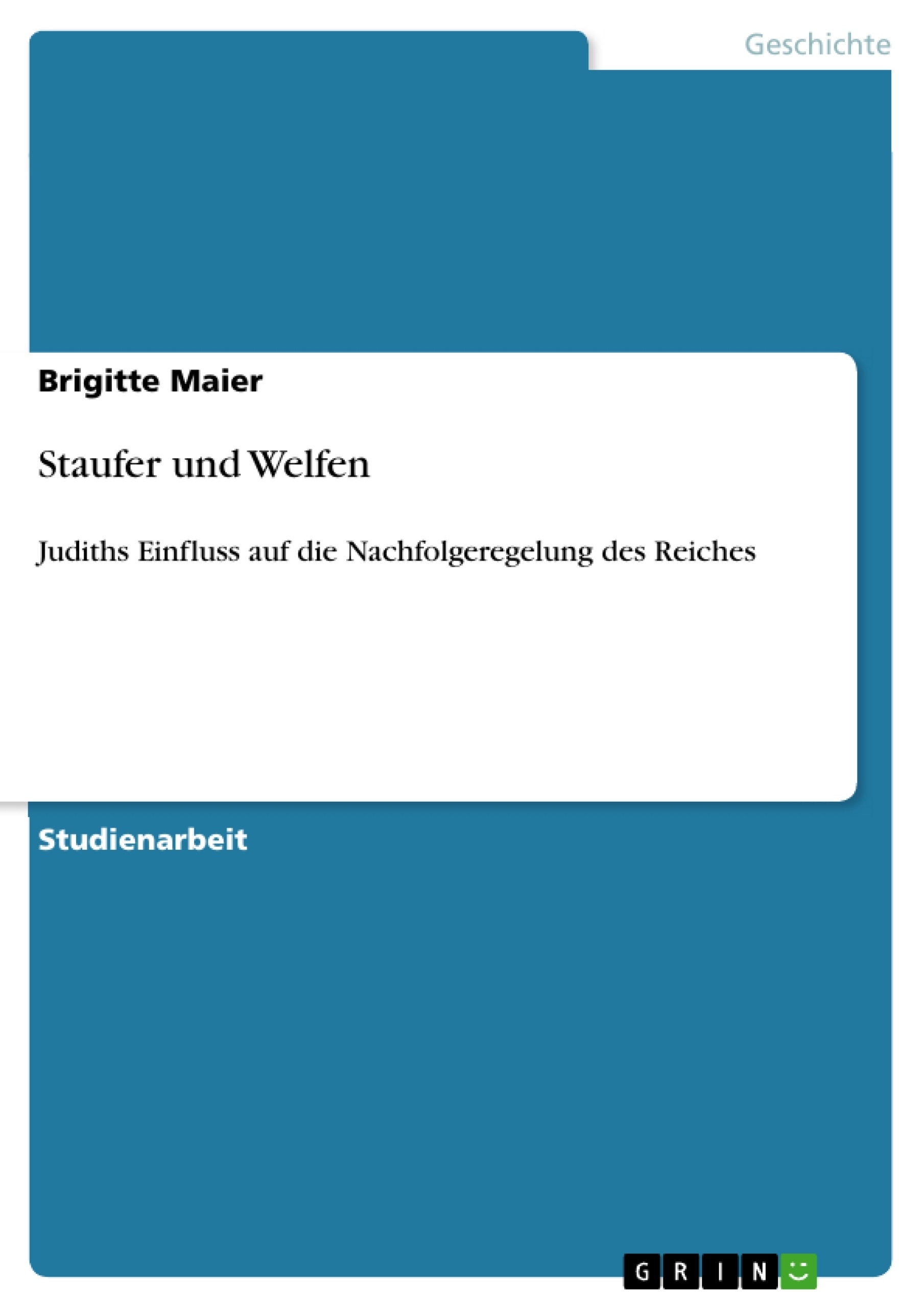Das Hochmittelalter ist in Deutschland geprägt durch den langjährigen Streit zwischen Staufern und Welfen. Betrachtet man sich den Konflikt zwischen Staufern und Welfen genauer, so stellt man fest, dass der Wechsel zwischen Erb- und Wahlkaisertum bzw. eine nicht genau festgelegte Nachfolgeregelung für die Thronstreitigkeiten innerhalb der machthabenen Familien verantwortlich war. Bereits während des Aufstreben des Familienclans im 9. Jahrhundert waren solcherlei Erbstreitigkeiten in den Kaiserfamilien vorhanden. Dies zeigt besonders eindrücklich die Geschichte der Judith I aus dem Hause Welf, welche zeitgleich das erste Mitglied dieser Familie ist, das in der Geschichtsschreibung verewigt ist.
Aus heutiger Sicht wirkt die Hochzeit mit Kaiser Ludwig dem Frommen von daher auch mehr als spektakulär. An seiner Seite sollte sie das 9. Jahrhundert ebenso prägen wie die Entwicklung des mittelalterlichen Europas. Durch die Geburt ihres Sohnes Karl brachte sie die bis dato unanfechtbar geglaubte Nachfolgeregelung ihres Mannes, die sogenannte Ordinatio Imperii, durcheinander. Kein Wunder, dass oftmals der Versuch unternommen wurde, jene Frau auszuschalten. Letztendlich setzte sie sich jedoch durch und sicherte sich und ihrem Sohn einen nicht geringen Anteil am ehemaligen Reich Karl des Großen. Nur auf den ersten Blick erscheint das Selbstbewusstsein dieser Frau, mit dem sie ihre Rechte und Interessen durchsetzte, befremdlich; sprengt es doch unser Bild vom patriarchalisch gelenkten Mittelalter. Beim genauen Hinsehen kann dieses Vorurteil jedoch nicht lange aufrechterhalten werden, da es – auch aus dem Hause der Welfen – zahlreiche Frauen gab die den weiteren Geschichtsverlauf nachhaltig prägten.
Von der älteren Geschichtsforschung wurden Judiths Leistungen meist nur negativ bewertet. Sie galt als egoistische, machthungrige Frau, die ihre Eigeninteressen vor das Wohl der Allgemeinheit stellte und als “Böse Stiefmutter“ ihren Mann manipulierte. Erst die neuere Forschung, wie beispielsweise das Werk von Armin Koch, nähert sich der Geschichte von Judith mit einer milderen Gesinnung an und unterstreicht auch ihre positiven Eigenschaften.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, nicht nur auf die historische Person Judith I Bezug zu nehmen, sondern vielmehr auch die Hintergründe der ordonatio imperii und die erste Ausstattung Karls im August 829 zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Divisio Regnorum und Machtübernahme Ludwigs des Frommen
- Die Hochzeit mit Judith
- Judiths Rolle
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hintergründe der Ordinatio Imperii und die erste Ausstattung Karls im August 829. Sie beleuchtet Judiths Rolle in den lang andauernden Erbstreitigkeiten im Karolingerhaus, die nach diesen „Verordnungen“ begannen. Die Analyse stützt sich auf Quellen wie Walahfrids Werk „Ad Iudith“, die Ausführungen Agobards und die Wala-Biographie des Paschasius Redbertus. Zusätzliche Quellen, die sich auf Ludwig den Frommen konzentrieren, wurden hinzugezogen.
- Die Ordinatio Imperii und ihre Folgen
- Judiths Einfluss auf die Nachfolgeregelung
- Die Rolle von Frauen im frühmittelalterlichen Machtgefüge
- Analyse der historischen Quellen und deren Interpretation
- Die Erbstreitigkeiten im Karolingerreich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Konflikt zwischen Staufern und Welfen im Hochmittelalter dar und hebt die Bedeutung ungeklärter Nachfolgeregelungen für Thronstreitigkeiten hervor. Sie führt das Beispiel Heinrichs V. an und verweist auf ähnliche Erbstreitigkeiten innerhalb der Welfenfamilie im 9. Jahrhundert, wobei die Geschichte Judiths I. als ein besonders eindrückliches Beispiel genannt wird. Die Hochzeit Judiths mit Ludwig dem Frommen wird als spektakuläres Ereignis beschrieben, das die Nachfolgeregelung ihres Mannes durcheinanderbrachte. Die Arbeit zielt darauf ab, Judiths Rolle in diesen Erbstreitigkeiten zu untersuchen, wobei die Autorin auf die unterschiedlichen historischen Interpretationen Judiths eingeht, von der negativen Darstellung als machthungrige Frau bis hin zu neueren, differenzierteren Ansätzen.
Divisio Regnorum und Machtübernahme Ludwigs des Frommen: Dieses Kapitel beschreibt die anfängliche Planung Karls des Großen, Ludwig als Regenten für Aquitanien einzusetzen und dessen Heirat mit Irmingard. Es erläutert die von Karl im Jahr 806 beschlossene Dreiteilung des Reiches, die sich als kontraproduktiv erwies. Der Tod von Pippin und Karl führte dazu, dass Ludwig Alleinerbe wurde, wodurch die ursprüngliche Regelung hinfällig wurde. Der Text zitiert den Astronomus, der Ludwigs Hoffnung auf die Herrschaft des ganzen Reiches nach dem Tod seiner Brüder beschreibt. Das Kapitel beleuchtet die politischen und dynastischen Folgen der frühen Regierungszeit Ludwigs des Frommen im Kontext der geplanten Reichsteilung.
Schlüsselwörter
Judith I., Ordinatio Imperii, Karolinger, Erbstreitigkeiten, Nachfolgeregelung, Ludwig der Fromme, Welfen, Hochmittelalter, Quellenkritik, Frauen in der Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Rolle Judiths I. in den Erbstreitigkeiten des Karolingerreiches
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle Judiths I. bei den Erbstreitigkeiten im Karolingerreich nach der Ordinatio Imperii von 817 und der ersten Ausstattung Karls im August 829. Sie beleuchtet Judiths Einfluss auf die Nachfolgeregelung ihres Mannes, Ludwig des Frommen, und analysiert die historischen Quellen kritisch.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter Walahfrids „Ad Iudith“, die Schriften Agobards und die Wala-Biographie des Paschasius Redbertus. Zusätzlich werden Quellen herangezogen, die sich auf Ludwig den Frommen konzentrieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ordinatio Imperii und ihre Folgen, Judiths Einfluss auf die Nachfolgeregelung, die Rolle von Frauen im frühmittelalterlichen Machtgefüge, die Analyse historischer Quellen und deren Interpretation, sowie die Erbstreitigkeiten im Karolingerreich.
Wie wird Judiths Rolle dargestellt?
Die Arbeit geht auf die unterschiedlichen historischen Interpretationen Judiths ein, von der negativen Darstellung als machthungrige Frau bis hin zu neueren, differenzierteren Ansätzen. Sie untersucht Judiths Einfluss auf die Erbstreitigkeiten im Detail.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Divisio Regnorum und der Machtübernahme Ludwigs des Frommen, ein Kapitel zur Hochzeit mit Judith, ein Kapitel zu Judiths Rolle und ein abschließendes Ergebniskapitel.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt den Konflikt zwischen Staufern und Welfen im Hochmittelalter dar und verweist auf die Bedeutung ungeklärter Nachfolgeregelungen für Thronstreitigkeiten. Sie verwendet die Geschichte Heinrichs V. und Judiths I. als Beispiele.
Was wird im Kapitel zur Divisio Regnorum behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Karls des Großen Pläne für Ludwig den Frommen, dessen Heirat mit Irmingard und die anfängliche Dreiteilung des Reiches. Es analysiert die Folgen dieser Planung und den Aufstieg Ludwigs zur Alleinherrschaft nach dem Tod seiner Brüder.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Judith I., Ordinatio Imperii, Karolinger, Erbstreitigkeiten, Nachfolgeregelung, Ludwig der Fromme, Welfen, Hochmittelalter, Quellenkritik, Frauen in der Geschichte.
- Quote paper
- Brigitte Maier (Author), 2011, Staufer und Welfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197742