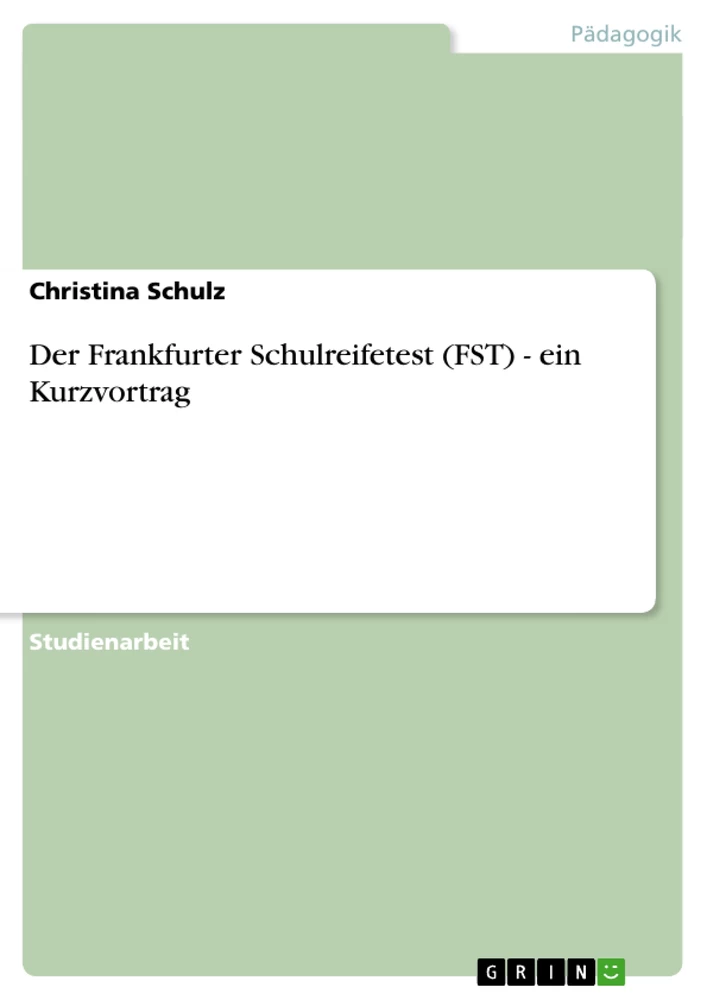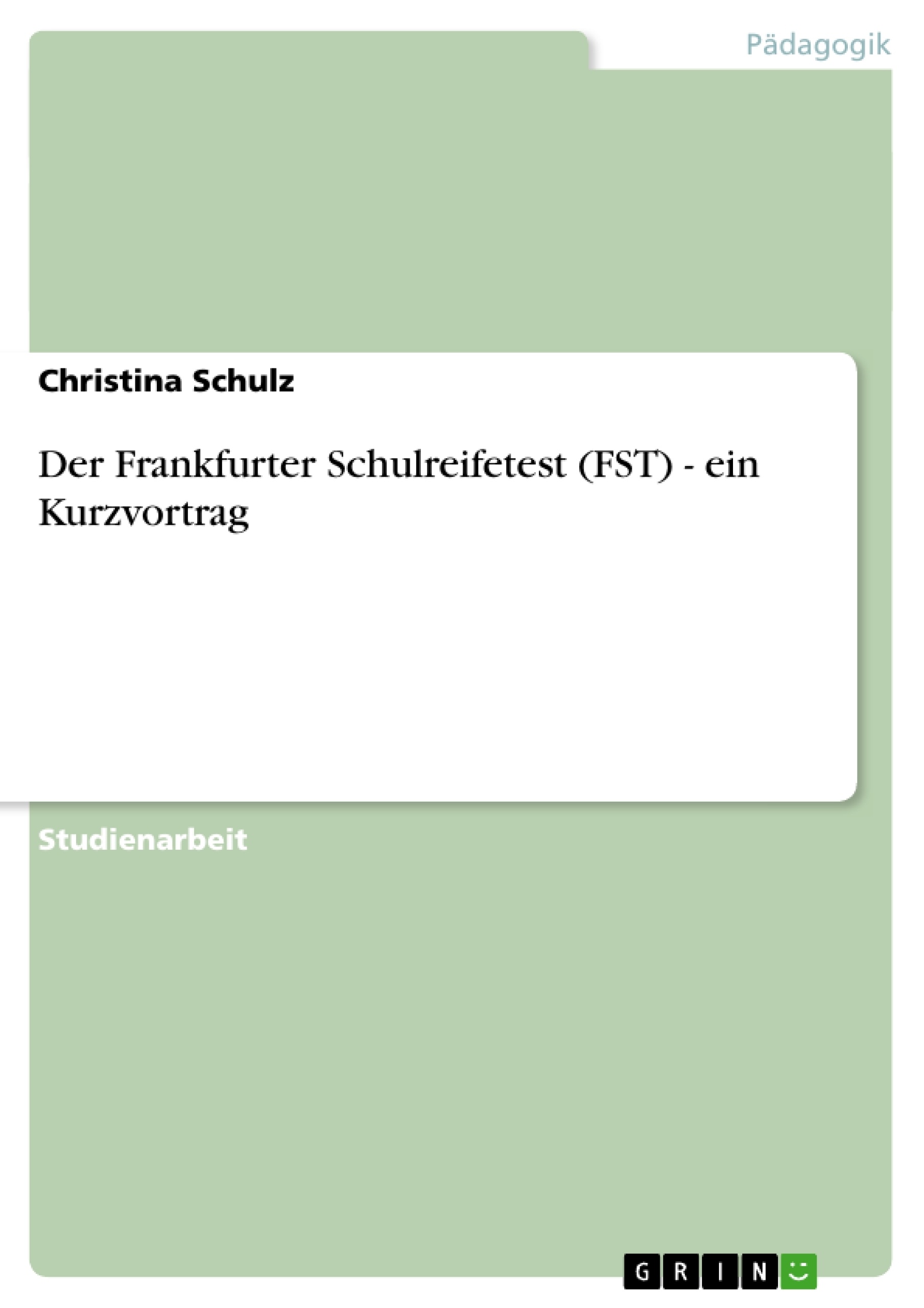Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule stellt einen wichtigen Abschnitt im
Leben eines Kindes dar. Mit Beendigung der unbeschwerten Kindergartenzeit, und dem
Eintritt in den Schulalltag, begegnet das Kind erstmalig Pflichten und Zeitvorgaben. So erlebt
es eine große Veränderung in seinem Leben. Wie viele verschiedene Aspekte hierbei zu
bedenken sind, zeigt uns der bisherige Seminarverlauf.
Die Institutionen „Kindergarten“ und „Schule“ spielen eine ausschlaggebende Rolle innerhalb
des Übergangs zwischen beiden, daher ist eine enge Zusammenarbeit beider unbedingt
notwendig und wünschenswert Der Kindergarten sollte das Kind schon im Vorfeld auf den
nahenden Schuleintritt vorbereiten. Dies ist auch die Aufgabe der Schule. Doch darüber
hinaus muss die Schule dem Kind einen kindgerechten und angstfreien Einstieg in den neuen
Abschnitt seines Lebens gewährleisten. Die Schule hat dabei die Aufgabe das Kind dort
abzuholen, wo es steht. Das heißt es muss sich vorab ein Eindruck über Fähigkeiten, oder
auch Defizite in verschiedenen, das Kind betreffenden Bereichen, gemacht werden. Dazu
gehört der körperliche und geistige Entwicklungsstand des Kindes, sowie sein Sozialverhalten
(Verhalten anderen Kindern und Lehrkräften gegenüber).
Einen weiteren Bereich bilden die so genannten „Schulreifeuntersuchungen“. Sie gehören
neben der schulärztlichen Untersuchung zur Einschulungsdiagnostik. Die Auswahl an
verschiedensten Schulreifeuntersuchungen ist groß. So gibt es unter anderem das „Kieler
Einschulungsverfahren“, den „Göppinger Schulreifetest“ und den „Rheinhauser Gruppentest“,
um nur einige von ihnen zu benennen.
Im folgenden Beitrag soll der „Frankfurter Schulreifetest“ näher beleuchtet werden. Dazu
werden vorab seine Entstehungsgeschichte und sein Aufbau eine Rolle spielen. Im Anschluss
daran wird (Teil zwei des Referates Fr. Henn) der praktische Teil erläutert werden. Da die
vorliegende Arbeit durch zwei Personen erstellt wurde, möchte ich an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass das „Schlusswort“ in diesem Teil der Arbeit bereits vor Beginn des
praktischen Teiles auftaucht. Das hat folgenden Grund: Das Schlusswort fasst nochmals
zusammen, aber dies geschieht indirekt wertend. Es erscheint daher von Bedeutung das
Schlusswort, welches den persönlichen Standpunkt beinhaltet, von einander unabhängig zu
verfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Frankfurter Schulreifetests
- Die 5. Auflage von 1968
- Grundkonzeptionen des FST
- Ziele des FST
- Die „Schulreife“
- Zum Begriff der „Schulreife“ aus Sicht des FST
- Voraussetzungen für die „Schulreife“
- Der Frankfurter Schulreifetest in seiner Umsetzung
- Allgemeine Hinweise zum Test
- Testbedingungen und Testmaterial
- Formalien vor Beginn der Testdurchführung
- Eintragungen im Testheft
- Zeitliche Einteilung des Tests
- Aufgaben des Prüfers und Helfers
- Die Aufgaben des Helfers
- Helfer und Beobachtungsbogen
- Typische Verhaltensweisen schulreifer und nicht schulreifer Kinder
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Frankfurter Schulreifetest (FST) und analysiert dessen Entstehung, Entwicklung und praktische Umsetzung. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der „Schulreife“ aus der Sicht des FST untersucht, wie auch die Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule beleuchtet. Die Autorin gibt einen Einblick in die Struktur und Inhalte des FST, sowie in die Rolle des Prüfers und des Helfers bei der Durchführung des Tests.
- Entwicklung und Geschichte des Frankfurter Schulreifetests
- Definition und Bedeutung der „Schulreife“ im Kontext des FST
- Die Struktur und Inhalte des Frankfurter Schulreifetests
- Praktische Umsetzung und Testbedingungen
- Bedeutung von Prüfer und Helfer bei der Durchführung des FST
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule als einen bedeutenden Lebensabschnitt vor. Sie betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule, um den Kindern einen angstfreien Einstieg in die Schule zu ermöglichen. Die Entstehung des Frankfurter Schulreifetests wird im zweiten Kapitel beleuchtet. Die Entstehung des Tests, seine Ziele und seine Anwendung werden im Detail beschrieben.
Im dritten Kapitel wird die 5. Auflage des FST vorgestellt. Die Autorin erläutert die Grundkonzeptionen und Ziele des Tests. Der vierte Teil widmet sich dem Begriff der „Schulreife“ aus der Sicht des FST und untersucht die verschiedenen Voraussetzungen, die für die erfolgreiche Bewältigung des Schulalltags notwendig sind.
Die Umsetzung des FST im fünften Kapitel betrachtet die allgemeinen Hinweise zum Test, die Testbedingungen, die Formalien und die zeitliche Einteilung. Aufgaben des Prüfers und Helfers werden im sechsten Kapitel behandelt. Typische Verhaltensweisen schulreifer und nicht schulreifer Kinder werden im achten Kapitel beschrieben.
Schlüsselwörter
Frankfurter Schulreifetest, Schulreife, Kindergarten, Grundschule, Übergang, Entwicklung, Testverfahren, Prüfer, Helfer, Beobachtungsbogen, Verhaltensweisen
- Quote paper
- Christina Schulz (Author), 2003, Der Frankfurter Schulreifetest (FST) - ein Kurzvortrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19764