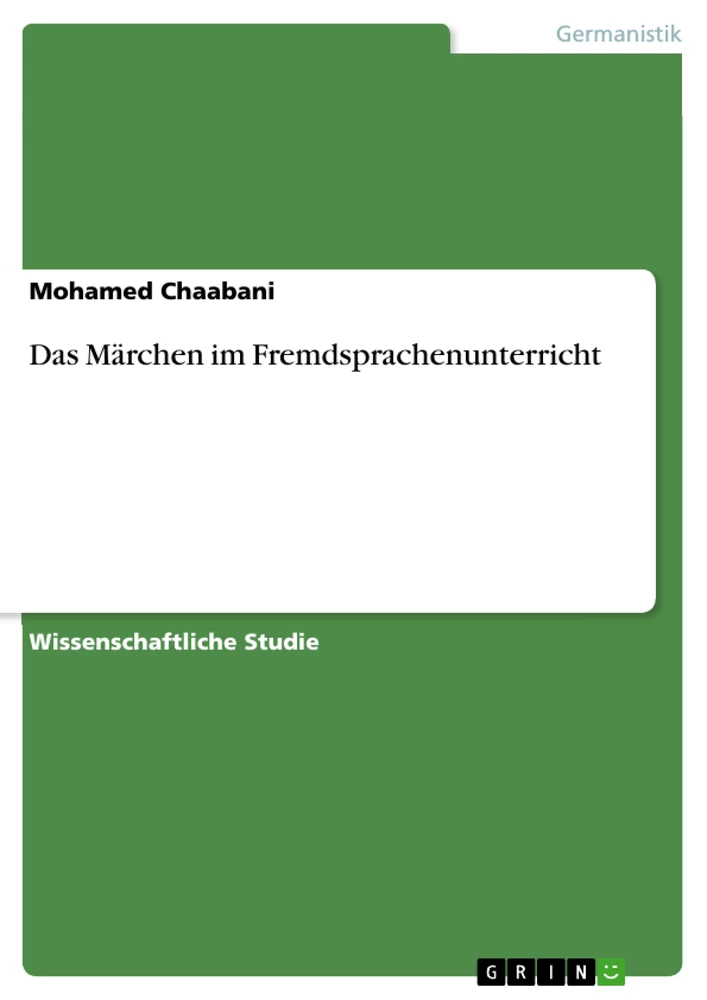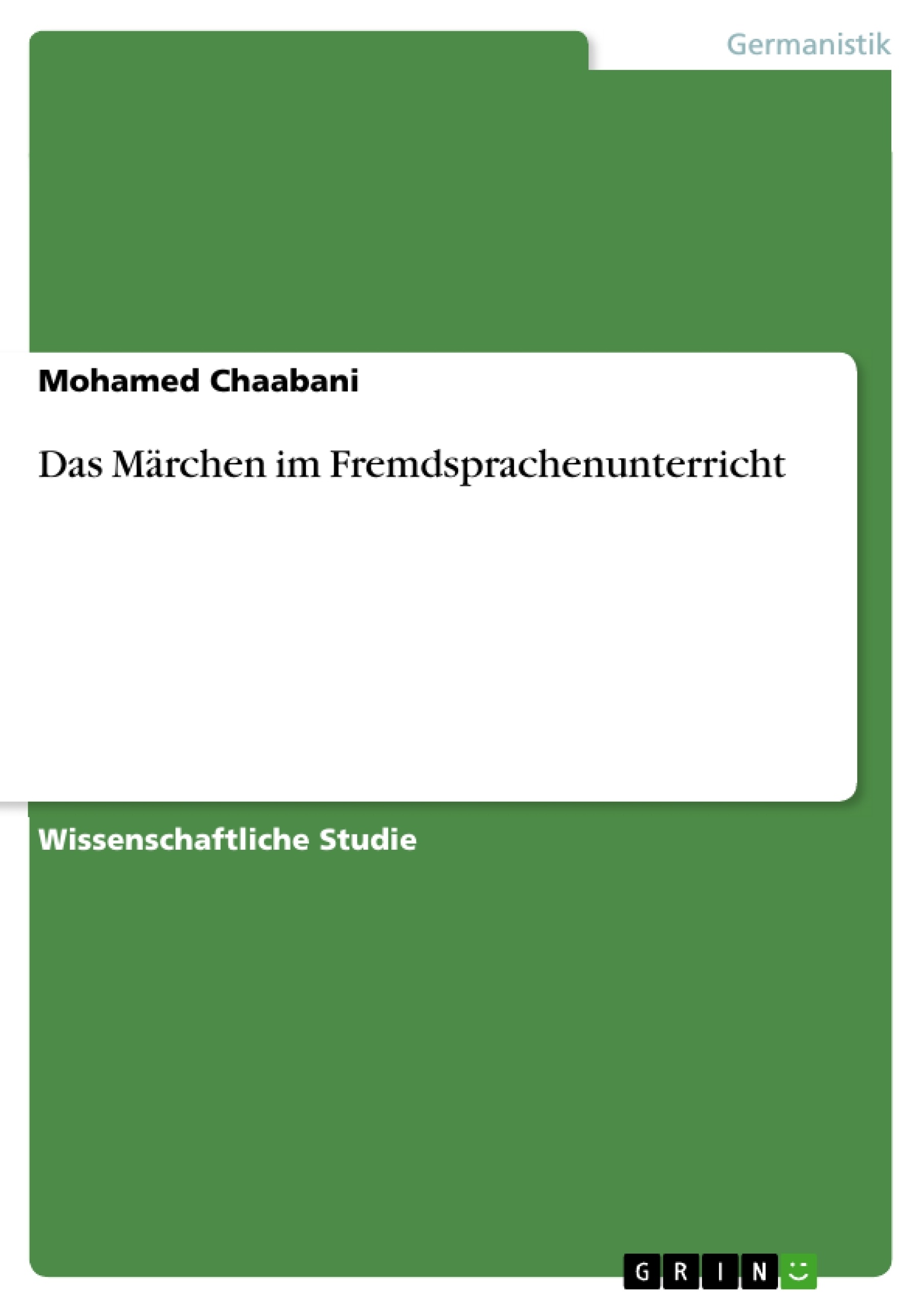Die folgende Arbeit untersucht die Textsorte Märchen im Fremdsprachenunterricht. Anliegen dieser Arbeit ist es, die Einstellung der Studenten über Märchen zu erfassen. Für diesen Zweck wurde eine Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden dargestellt.
Abstract
Die folgende Arbeit untersucht die Textsorte Märchen im Fremdsprachenunterricht. Anliegen dieser Arbeit ist es, die Einstellung der Studenten über Märchen zu erfassen. Für diesen Zweck wurde eine Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden dargestellt.
Zum Begriff Märchen
Laut Metzler-Literatur-Lexikon (1990, S.292) wird das Märchen wie folgt definiert
„phantastische, realitätsüberhobene, variable Erzählung, deren Stoff aus mündlichen volkstümlichen Traditionen stammt und jeder mündlichen oder schriftlichen Realisierung je nach Erzähltalent und- Intention oder stilistischen Anspruch anders gestaltet sein kann“
Weiterhin Haerkötter (1979, 235) führt eine Definition für das Märchen an:
„Das Märchen ist eine kurze, freie erfundene Erzählung, die weder zeitlich noch räumlich gebunden ist noch Wirklichkeitscharakter besitzt; vielmehr ist sie voller phantastischer Ereignisse, die sich gar nicht haben ereignen können, weil sie gegen die Naturgesetzte verstoßen “[1]
Eine weitere Definition des Märchens findet sich bei Feld-Knapp[2] (2005, 81):
„Ein Märchen ist eine in einem volküberlieferte Erzählung, in der übernatürliche Kräfte und Gestalten in das Leben der Menschen eingreifen und meist am Ende die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden“
Laut Haerkötter, u.a. (1979, 235) stellt das Märchen eine magische Welt dar. Dabei werden eine genaue Beschreibung und wörtliche Rede gebraucht, um diese magische Welt glaubhaft wirken zu lassen. Das Märchen ist in drei Teile aufgebaut. Erstens eine gespannte Erwartung. Zweitens das Mittelstück. Darin findet sich oft drei Aufgaben und schließlich die Wende.
Bei Vogt, Jochen (2012)[3].finden sich die folgenden Ausführungen über die Textsorte Märchen:
Die Handlung des Märchens hat weder Zeit noch Raum. Charakteristisch für das Märchen ist die Phantasie durch sprechende Tiere und Gegenstände, Verwandlungen und Verzauberungen. Es wird zwischen dem Bösen und dem Guten getrennt. Es gibt auch ein Held, der eine Aufgabe hat, natürlichen und übernatürlichen Kräften zu trotzen. Sprachlich sind zahlreiche Redensarten und Sprichwörter anzutreffen. In der Zeit der Romantik wurden Volksmärchen gesammelt. Als Beispiel nennt JV die Volksmärchen der Deutschen von J.K.A. Masäus aus den Jahren 1782/1787.
In diesem Zusammenhang unterscheidet sich man zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Die Volksmärchen hingegen sind alt und durch mündliche Überlieferungen überarbeitet. Demgegenüber sind die jüngeren Kunstmärchen von Dichtern geschrieben. Der Inhalt solcher Märchen ist definitiv festgelegt.
Nach Winkler (2000, S. 65) stellen Kunstmärchen das Werk eines bestimmten Dichters. Dabei gibt es Höhepunkt besonders bei romantischen Kunstmärchen.
Ein andere Art von Märchen laut Winkler (2000, S. 65) ist das moderne Antimärchen (vgl. Kafka: Die Verwandlung). Dabei geht es um einen negativen Held, der großen Kräften unterliegen sei.
Geschichte des Märchens
Laut Metzler-Literatur-Lexikon (1990, S.292) findet man in der altägyptischen Literatur zwei Brüder-Märchen des Papyrus Wescar, 2 Jahrhundert v. Chr. In römischen Literatur findet man das Märchen von Amor und Psyche im „Goldenen Esel“ des Apuleius, 2 Jahrhundert n. Chr. Im Mittelalter etwa der „ Asinarius“ (Märchen von Tierbräutigam um 1200 oder in die „Gesta Romanorum“ um 1300). In der deutschen Literatur in der Neuzeit findet man eine Version des Aschenputtels in der „Gartengesellschaft“ des Martin Montanus oder Predigten des J. Geiler von Kaisersberg (16. Jh.). In der italienischen Literatur gibt es Sammlungen von Erzählungen von G.F. Straparola: „Le piacevoli notti“ 1550/53, Geschichte von Tierprinzen, vom wilden Mann, gestiefelter Kater… G. Basile „Lo cunto deli cunti “, auf Deutsch Märchen aller Märchen in 1634/36, darunter Aschenputtel, Rapunzel, Schneewittchen, Dornröschen. J.A. Galland (1704/17) hat die orientalische Erzählsammlung von „1001 Nacht“ ins Französische übersetzt. Die Brüder J. und W. Grimm begannen in einem einfachen volkstümlichen Stil zu verfassen. („Kinder und Hausmärchen“ 2 Bde. 1812/15: 156 Texte, 7. Auflage 1857: 210 Texte). Im 19. Jahrhundert gab es Sammlungen von Märchen wie z.B. L. Bechstein (1845), K. Müllenhof (1845)
Eine wissenschaftliche Auseinadersetzung mit dem Märchen begann laut Metzler-Literatur-Lexikon (1990, S.292f) mit den Brüdern Grimm. Anmerkungen zu den Kinder und Hausmärchen.
Im 19. Jh. beschäftigte man sich mit der Herkunft des Märchens. Im 20. Jh. beziehen sich die Untersuchungen vor allem auf die Klassifizierung von Märchen, seine regionale Ausprägungen, sowie Varianten und Schichten.
[...]
[1] Vgl. Haerkötter, u.a. (1979, 235)
[2] Feld-Knapp, Ilona, 2005, Textsorten und Spracherwerb. Eine Untersuchung zur Relevanz textsortenspezifischer Merkmale für den „Deutsch als Fremdsprache“ Unterricht. Verlag Dr. Novač, Hamburg
[3] Vogt, Jochen. In : www.uni-due.de/eiladung/index.php?option=com_content&view=article&id =48&Itemid=53. Zugriff am 01.06.2012 (16h15)
- Quote paper
- Mohamed Chaabani (Author), 2012, Das Märchen im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197631