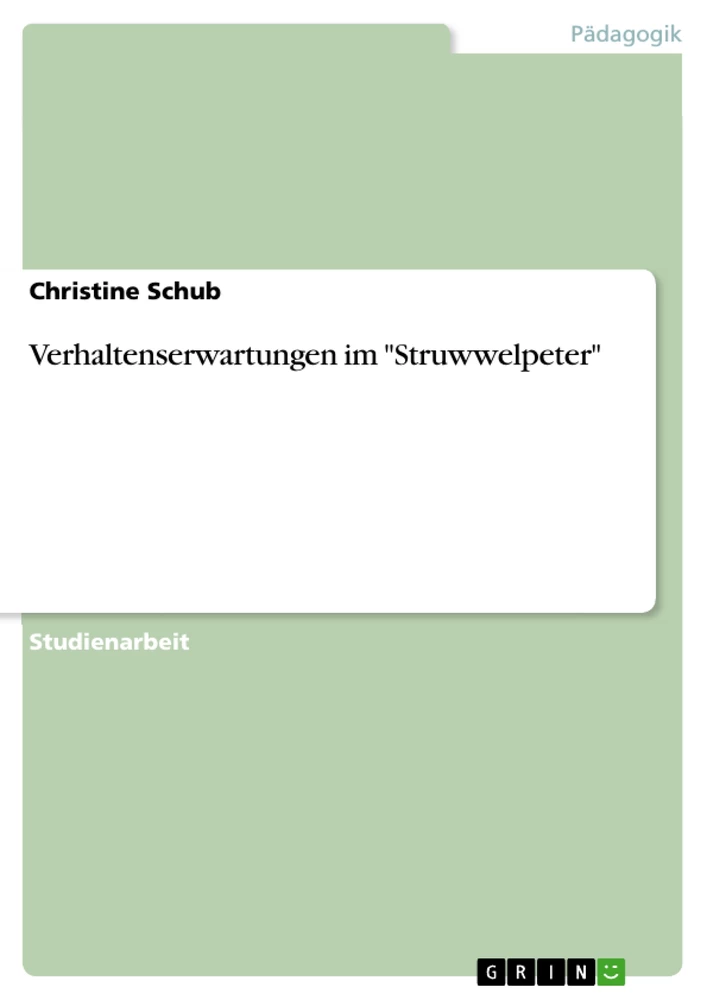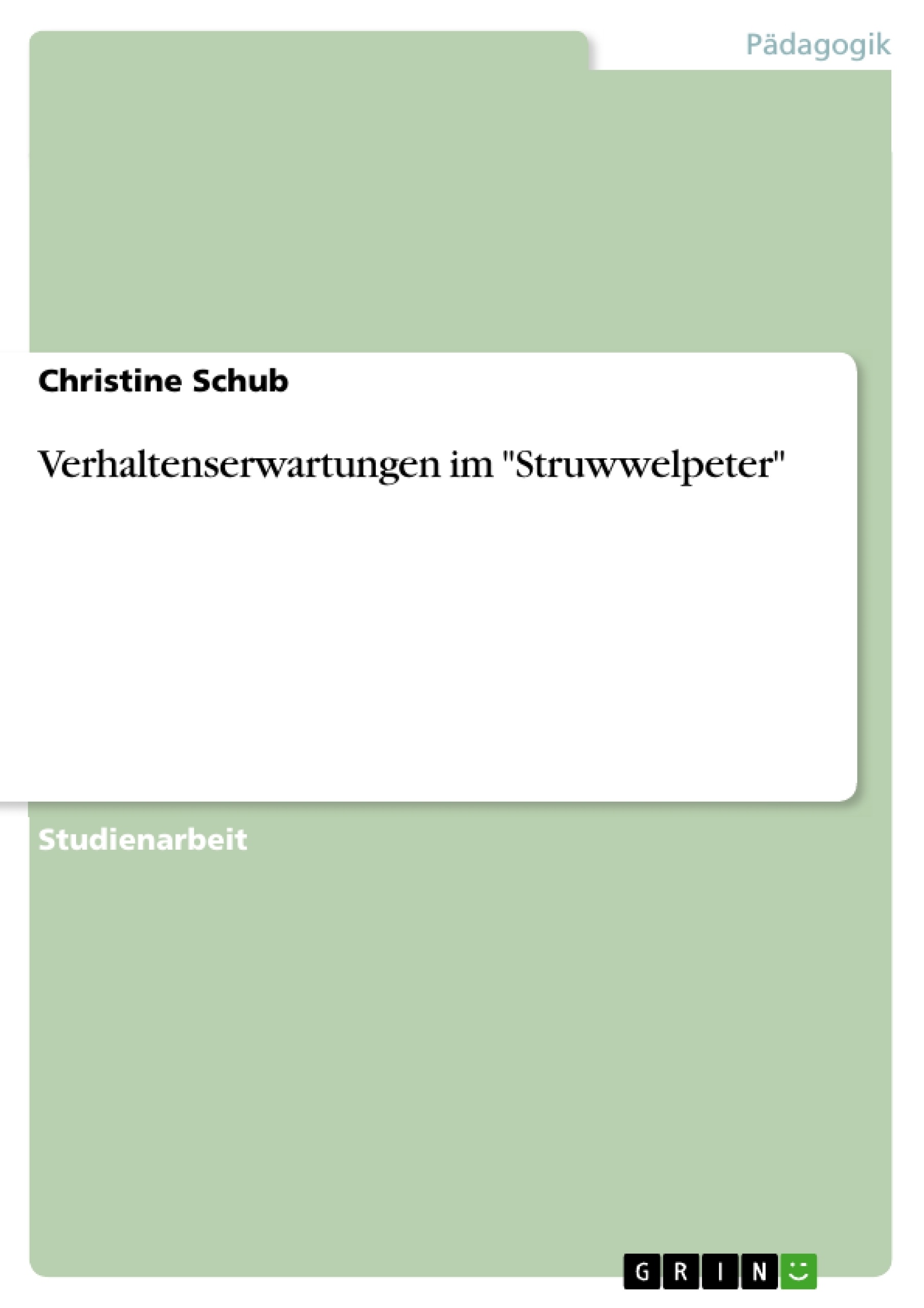Viele Kinder kennen sie, die Geschichten von „Pippi Langstrumpf“, „Karlsson vom Dach“, „Emil und die Detektive“, „die Spürnasen“ u.v.a. Geschrieben von Kinderbuchautoren wie ASTRID LINDGREN, ERICH KÄSTNER und ENID BLYTON, um nur einige zu nennen. Ebenfalls zu den erfolgreichsten und bekanntesten Kinderbüchern gehört neben den Märchen der GEBRÜDER GRIMM auch heute noch der „Struwwelpeter“, 1844 von DR. HEINRICH HOFFMANN geschrieben und veröffentlicht.
Betrachtet man die sogenannte Kinderliteratur genauer, versucht (fast) jedes Buch für sich einen Erziehungsauftrag zu erfüllen und den Kindern zu vermitteln, was gut und richtig ist. Vor allem im „Struwwelpeter“ kommt dies unmittelbar zur Geltung.
Jedoch wird der „Struwwelpeter“ auch scharf kritisiert. Es gibt einen Teil der Erziehungswissenschaftler, der begeistert ist von der Moral, die im „Struwwelpeter“ vermittelt wird und der gleichfalls die Belehrungen dieses Buches als wichtig erachtet, um ein angemessenes Verhalten bei Kindern zu erzielen. Der andere Teil der Pädagogen lehnt das Buch wegen seiner angsteinflößenden Strafen und den ebenso erschreckenden Folgen der kindlichen Tat ab.
Im Weiteren sollen einige der Struwwelpetergeschichten auf ihre
Erwartungen bezüglich des kindlichen Verhaltens untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Kinderbücher und das Für und Wieder des „Struwwelpeters“
- 1.2 Aufbau und Gestaltung des „Struwwelpeter“-Bilderbuches
- 2. Hauptteil
- 2.1 Die Geschichte vom bösen Friederich
- 2.2 Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug
- 2.3 Die Geschichte von den schwarzen Buben
- 2.4 Die Geschichte vom Daumen-Lutscher
- 2.5 Die Geschichte vom Suppen-Kasper
- 2.6 Die Geschichte vom Zappel-Philipp
- 2.7 Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft
- 2.8 Die Geschichte vom fliegenden Robert
- 3. Schluss
- 3.1 Erziehung und Verhaltenserwartungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den „Struwwelpeter“ von Heinrich Hoffmann im Hinblick auf die darin vermittelten Verhaltenserwartungen und deren pädagogische Relevanz. Sie untersucht die kontroversen Meinungen zur Moral des Buches und setzt diese in den historischen Kontext des 19. Jahrhunderts.
- Vermittlung von Moral und gesellschaftlichen Normen im „Struwwelpeter“
- Pädagogische Bewertung des Buches: Kritik und Verteidigung
- Analyse der Erzählstruktur und der Text-Bild-Kombination
- Der „Struwwelpeter“ als Spiegelbild der Erziehungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts
- Die Wirkung der drastischen Illustrationen und deren Einfluss auf Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des „Struwwelpeters“ ein und stellt ihn in den Kontext anderer bekannter Kinderbücher. Sie beleuchtet die kontroversen Meinungen zum Buch: Während einige die vermittelte Moral begrüßen, kritisieren andere die drastischen Strafen und die angsteinflößenden Folgen des kindlichen Fehlverhaltens. Der Abschnitt skizziert die Bedeutung des Werkes und dessen anhaltende Relevanz für die Erziehungsdiskussion.
1.1 Kinderbücher und das Für und Wieder des „Struwwelpeters“: Dieser Abschnitt vertieft die Einleitung, indem er die unterschiedlichen Positionen zur pädagogischen Wirkung des „Struwwelpeters“ detailliert darstellt. Er beleuchtet die Argumente der Befürworter, die den „Struwwelpeter“ als wichtiges Mittel zur Vermittlung von Normen und Regeln sehen, sowie die Kritikpunkte der Gegner, die die Brutalität und die potenziellen Auswirkungen auf die kindliche Psyche bemängeln. Der Abschnitt betont den historischen Kontext und die hohen Kindersterblichkeitsraten des 19. Jahrhunderts, um die scheinbar harten Strafen im Buch zu relativieren.
1.2 Aufbau und Gestaltung des „Struwwelpeter“-Bilderbuches: Dieser Abschnitt analysiert den Aufbau und die Gestaltung des Buches. Er beschreibt die kindgerechte Einfachheit der Sprache und der Bilder, die Text-Bild-Kombination und die narrative Struktur der einzelnen Geschichten. Die leicht zu merkenden Reime und die klaren Illustrationen werden als wichtige Faktoren für die Vermittlung der Lerninhalte hervorgehoben. Der Abschnitt betont die Anpassung der Erzählweise an das kindliche Denken und die Verwendung von Lautmalerei.
Schlüsselwörter
Struwwelpeter, Heinrich Hoffmann, Kinderbuch, Verhaltenserwartungen, Moral, Erziehung, Pädagogik, 19. Jahrhundert, Text-Bild-Kombination, Illustrationen, Kinderliteratur, gesellschaftliche Normen, Kritik, Befürwortung.
Häufig gestellte Fragen zum Struwwelpeter
Was ist der Inhalt des HTML-Dokuments?
Das HTML-Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Heinrich Hoffmanns "Struwwelpeter". Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Analyse der im "Struwwelpeter" vermittelten Verhaltenserwartungen und deren pädagogische Relevanz im Kontext des 19. Jahrhunderts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die kontroversen Meinungen zum Buch. Der Hauptteil analysiert die einzelnen Geschichten des "Struwwelpeters" (z.B. "Der böse Friederich", "Das Feuerzeug", "Der Daumenlutscher"). Der Schluss befasst sich mit Erziehung und Verhaltenserwartungen im Kontext des Buches.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit analysiert den "Struwwelpeter" hinsichtlich der vermittelten Verhaltenserwartungen und deren pädagogischen Relevanz. Sie untersucht die kontroversen Meinungen zur Moral des Buches und setzt diese in den historischen Kontext des 19. Jahrhunderts. Wichtige Themen sind die Vermittlung von Moral und gesellschaftlichen Normen, die pädagogische Bewertung (Kritik und Verteidigung), die Analyse der Erzählstruktur und der Text-Bild-Kombination, der "Struwwelpeter" als Spiegelbild der Erziehungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts und die Wirkung der Illustrationen.
Welche Aspekte der einzelnen Kapitel werden zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die jeweiligen Inhalte. So wird beispielsweise die Einleitung detailliert beschrieben, ebenso wie die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen zur pädagogischen Wirkung des "Struwwelpeters" und die Analyse des Aufbaus und der Gestaltung des Buches, einschließlich der Text-Bild-Kombination und der narrativen Struktur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen zentrale Begriffe wie "Struwwelpeter", "Heinrich Hoffmann", "Kinderbuch", "Verhaltenserwartungen", "Moral", "Erziehung", "Pädagogik", "19. Jahrhundert", "Text-Bild-Kombination", "Illustrationen", "Kinderliteratur", "gesellschaftliche Normen", "Kritik" und "Befürwortung".
- Quote paper
- Christine Schub (Author), 2004, Verhaltenserwartungen im "Struwwelpeter", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197390