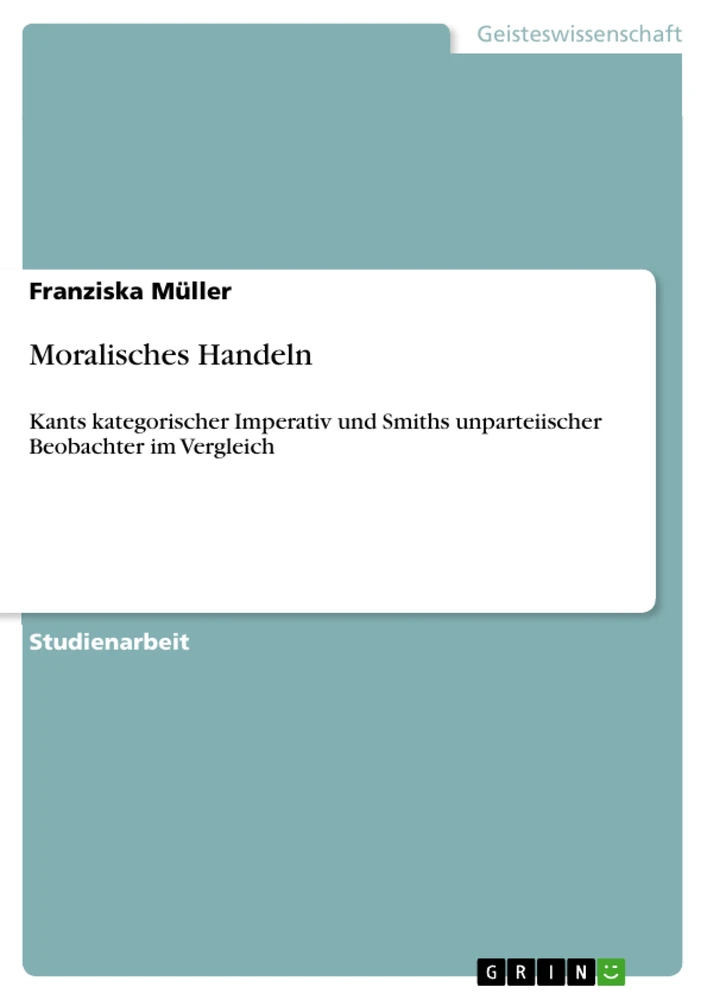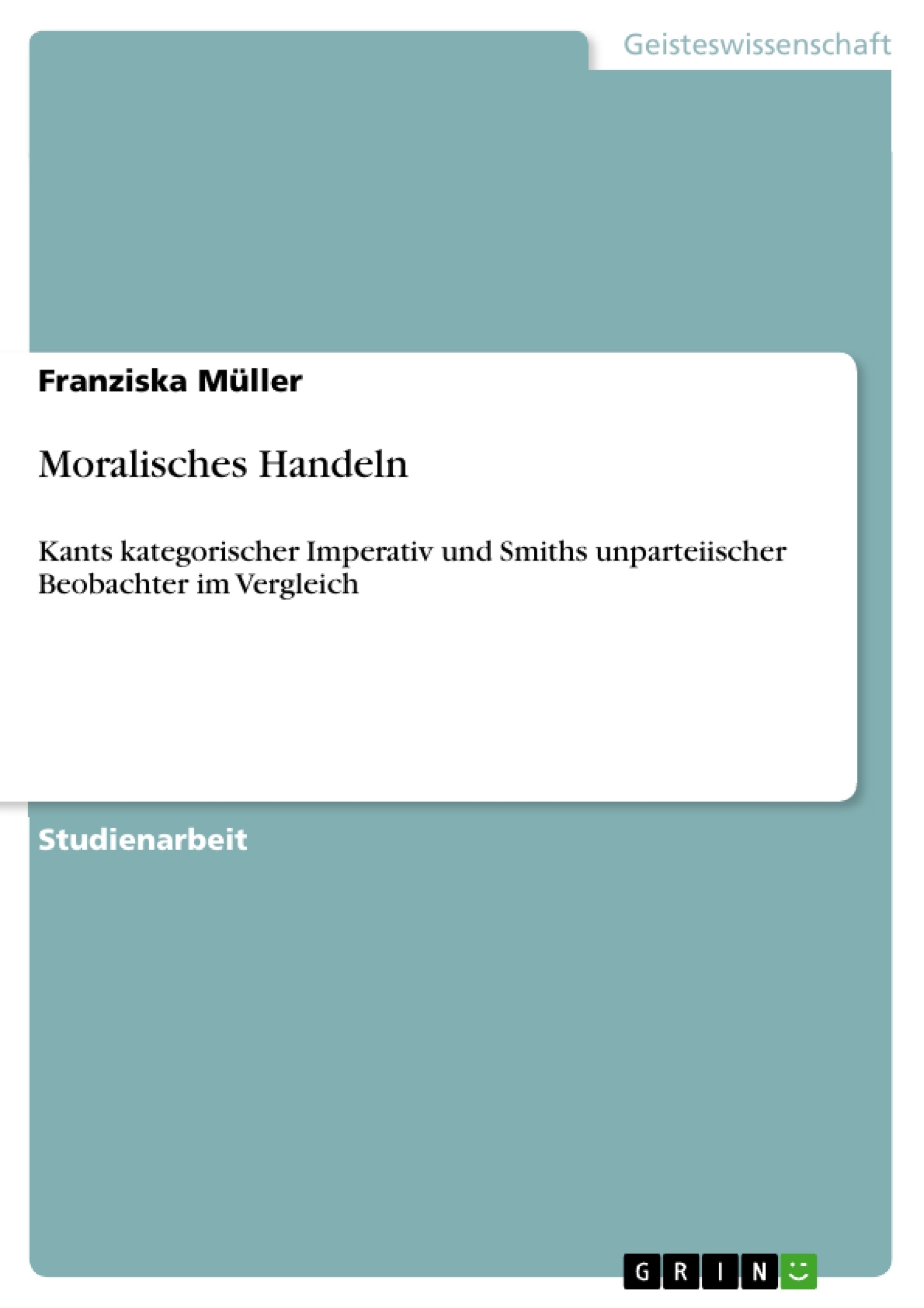1 Vorwort
Je nachdem, ob wir das Handeln unseres Gegenübers für gut befinden oder nicht, fühlen wir uns zu ihm hingezogen oder von ihm abgestoßen. Wenn wir Lob für unser Handeln bekommen, freuen wir uns - und wir sind niedergeschlagen, wenn wir stattdessen getadelt werden. Doch was sind die Kriterien dafür, dass Handeln entweder gelobt oder aber getadelt wird ?
Die Frage, nach welchen Maßstäben ein Handeln bewertet werden sollte, wann ein Handeln demnach als „gut“ oder „schlecht“ gelten kann, beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten. Und auch in der heutigen Zeit scheint die Suche danach noch nicht abgeschlossen: Tippt man den Begriff „Moral“ bei der Suchmaschine „google“ ein, so erhält man 280.000.000 Treffer. Die philosophische Forschung hat viele Ansätze zur Beurteilung moralischen Handelns hervorgebracht. Zwei wichtige Ansätze lieferten im 18. Jahrhundert die Philosophen Adam Smith und Immanuel Kant. In „The Theorie of Moral Sentiments“ („Die Theorie der ethischen Gefühle“) entwickelt Adam Smith 1759 das Konzept des „impartial spectator“; des „unabhängigen Beobachters“, in welchen ein jeder sich hineinversetzen muss, um das eigene und das Handeln anderer nach seiner Sittlichkeit zu bewerten. Einen anderen Ansatz liefert Immanuel Kant mit seinem in den Werken „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ (1785) und „Kritik der praktischen Vernunft“ (1788) entworfenen Begriff des „kategorischen Imperativs“. Die Publikation der Werke Smiths und Kants liegen zeitlich nur knapp 30 Jahre auseinander, so dass sich ein Vergleich des impartial spectators und des kategorischen Imperativs anbietet. Die beiden Konzepte sollen insbesondere in nachstehenden Punkten gegenübergestellt werden: Zunächst soll geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen moralisches Handeln möglich ist und wer zu moralischem Handeln fähig ist. Des Weiteren soll den Fragen nachgegangen werden, warum der Mensch nach moralischem Handeln strebt und was als moralische Handlung angesehen werden kann. Die Begriffe der „Sittlichkeit“ und der „Moral“ werden dabei synonym verwendet. Zunächst sollen Kants „kategorischer Imperativ“ und Smiths „impartial spectator“ einzeln vorgestellt werden, um die beiden Konzepte anschließend auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersuchen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Immanuel Kant: Der kategorische Imperativ
- Maßstäbe für moralisches Handeln: Der gute Wille und der Begriff der Pflicht
- Moralische Urteile sind Urteile a priori
- Moralisches Handeln ist Handeln nach dem kategorischen Imperativ
- Gründe für das Streben nach moralischem Handeln
- Erkennen moralischen Handelns im Alltag
- Adam Smith: Der unparteiische Beobachter
- Die Gesinnung als Grundlage von Lob und Tadel
- Bewertung einer Handlung nach ihrer Sittlichkeit durch den unabhängigen Beobachter
- Voraussetzung und Gegenstände moralischer Urteile
- Gründe für das Streben nach moralischem Handeln
- Der unparteiische Beobachter im Alltag
- Der kategorische Imperativ und der unparteiische Beobachter im Vergleich
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Konzepte des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant und des unparteiischen Beobachters von Adam Smith zur Beurteilung moralischen Handelns. Die Zielsetzung besteht darin, die Voraussetzungen, Gründe und Kriterien für moralisches Handeln nach beiden Philosophen zu erörtern und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
- Voraussetzungen für moralisches Handeln
- Kriterien für die Beurteilung moralischen Handelns
- Gründe für das Streben nach moralischem Handeln
- Der gute Wille und die Pflicht (Kant)
- Der unparteiische Beobachter und die Sittlichkeit (Smith)
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und stellt die Frage nach den Kriterien für Lob und Tadel von Handlungen. Es betont die andauernde Relevanz der Frage nach moralischen Maßstäben und erwähnt die Konzepte von Kant (kategorischer Imperativ) und Smith (unparteiischer Beobachter) als zwei wichtige Ansätze zur Beantwortung dieser Frage. Der Vergleich dieser beiden Konzepte bildet den Schwerpunkt der Arbeit.
Immanuel Kant: Der kategorische Imperativ: Dieses Kapitel stellt Kants kategorischen Imperativ als Grundlage moralischen Handelns vor. Es wird auf die Bedeutung des guten Willens und des Handelns aus Pflicht eingegangen. Kant unterscheidet zwischen Handeln aus Pflicht und pflichtgemäßem Handeln, wobei nur ersteres moralischen Wert besitzt. Der gute Wille wird als Grundlage aller moralischen Handlungen definiert und nicht durch die Folgen, sondern durch die Absicht bestimmt. Die Kapitel unterstreichen die a-priori Natur moralischer Urteile, die unabhängig von empirischen Erfahrungen sind.
Adam Smith: Der unparteiische Beobachter: Dieses Kapitel widmet sich Smiths Konzept des „unparteiischen Beobachters“. Smith argumentiert, dass die Bewertung von Handlungen auf der Gesinnung und der Perspektive eines unabhängigen Beobachters beruht. Dieser Beobachter erlaubt es, Handlungen objektiv zu beurteilen, indem man sich in die Position eines neutralen Betrachters versetzt. Das Kapitel erörtert die Voraussetzungen und Gegenstände moralischer Urteile nach Smith und untersucht die Gründe für das Streben nach moralischem Handeln aus seiner Perspektive. Die Rolle des unparteiischen Beobachters im Alltag wird ebenfalls beleuchtet.
Der kategorische Imperativ und der unparteiische Beobachter im Vergleich: Dieses Kapitel, welches im vorliegenden Auszug nicht enthalten ist, würde voraussichtlich einen Vergleich zwischen Kants kategorischem Imperativ und Smiths unparteiischem Beobachter durchführen. Es würde die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte herausarbeiten und möglicherweise einen umfassenden Überblick über die Stärken und Schwächen beider Ansätze bieten. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Voraussetzungen, Kriterien und Gründe für moralisches Handeln würden im Detail analysiert werden.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, unparteiischer Beobachter, moralisches Handeln, gute Wille, Pflicht, Sittlichkeit, Moral, a priori Urteil, Maxime, Bewertung, Gesinnung, Ethik, Philosophie, Kant, Smith.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Vergleich Kant und Smith
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text vergleicht die ethischen Konzepte des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant und des unparteiischen Beobachters von Adam Smith. Er untersucht die Voraussetzungen, Kriterien und Gründe für moralisches Handeln nach beiden Philosophen und hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Voraussetzungen für moralisches Handeln, Kriterien zur Beurteilung moralischen Handelns, die Gründe für das Streben nach Moral, Kants Konzept des guten Willens und der Pflicht sowie Smiths Konzept des unparteiischen Beobachters und der Sittlichkeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text beinhaltet ein Vorwort, ein Kapitel zu Kants kategorischem Imperativ, ein Kapitel zu Smiths unparteiischem Beobachter, ein Kapitel zum Vergleich beider Konzepte (welches im Auszug nicht enthalten ist) und eine Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Wie definiert Kant moralisches Handeln?
Kant definiert moralisches Handeln als Handeln aus Pflicht, basierend auf dem guten Willen. Handlungen haben nur dann moralischen Wert, wenn sie aus Pflicht und nicht aus Neigung geschehen. Moralische Urteile sind nach Kant a priori, d.h. unabhängig von empirischen Erfahrungen.
Wie definiert Smith moralisches Handeln?
Smith sieht die Bewertung von Handlungen in der Perspektive eines unparteiischen Beobachters begründet. Dieser Beobachter ermöglicht eine objektive Beurteilung der Handlung, basierend auf der Gesinnung des Handelnden. Die Bewertung beruht nicht auf den Folgen, sondern auf der Absicht und der Perspektive eines neutralen Betrachters.
Was ist der "unparteiische Beobachter" bei Smith?
Der "unparteiische Beobachter" ist ein gedankliches Konstrukt bei Smith, das es erlaubt, Handlungen objektiv zu bewerten, indem man sich in die Position eines neutralen Betrachters versetzt, der die Handlung ohne persönliche Beteiligung beurteilt und die Gesinnung des Handelnden berücksichtigt.
Wie werden Kant und Smith im Text verglichen?
Der Vergleich (im vorliegenden Auszug nicht detailliert ausgeführt) würde die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kants kategorischem Imperativ und Smiths unparteiischem Beobachter hinsichtlich der Voraussetzungen, Kriterien und Gründe für moralisches Handeln untersuchen. Es werden Stärken und Schwächen beider Ansätze beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Kategorischer Imperativ, unparteiischer Beobachter, moralisches Handeln, guter Wille, Pflicht, Sittlichkeit, Moral, a priori Urteil, Maxime, Bewertung, Gesinnung, Ethik, Philosophie, Kant, Smith.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Ethik, Moralphilosophie und den Werken von Kant und Smith auseinandersetzt. Er eignet sich insbesondere für die Analyse von Themen in einem strukturierten und professionellen Rahmen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in diesem Auszug enthalten. Weitere Informationen zur vollständigen Fassung müssen von der entsprechenden Quelle bezogen werden.
- Quote paper
- Franziska Müller (Author), 2011, Moralisches Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197347