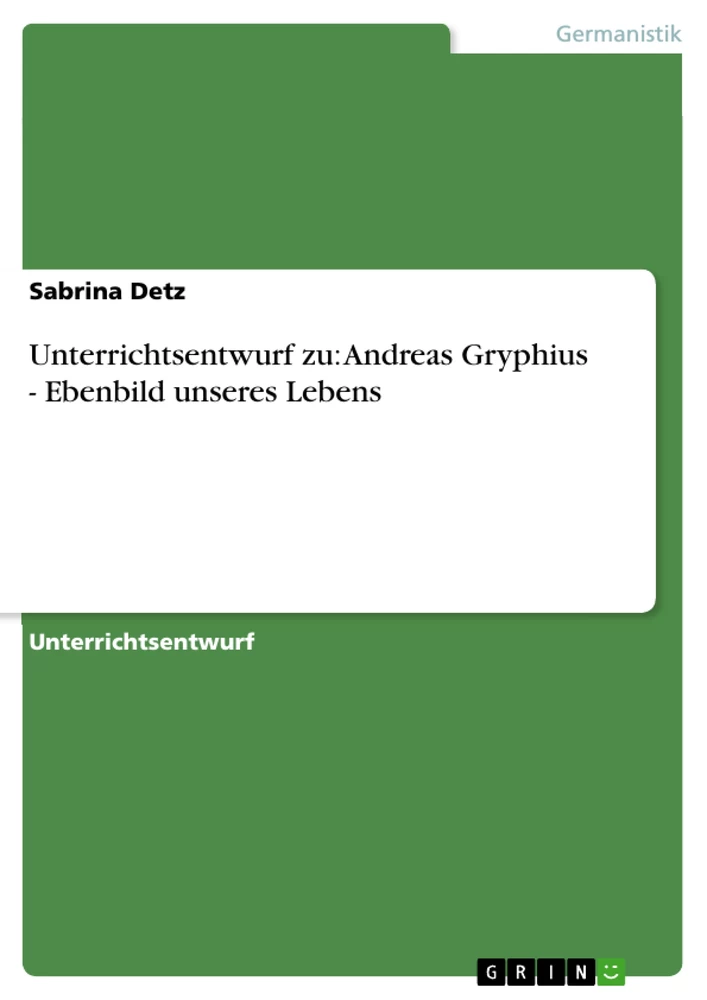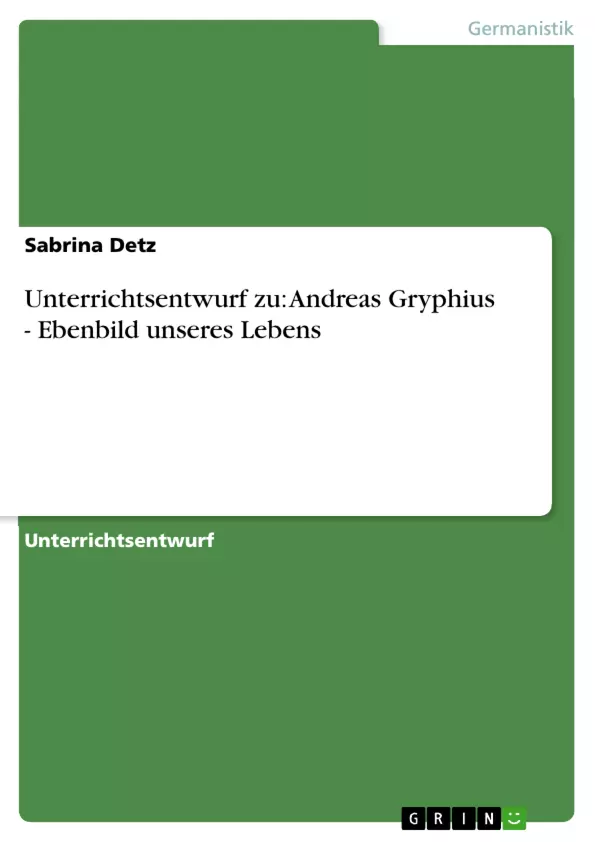Unterrichtsentwurf zu Lyrik im Deutschunterricht am Beispiel - Andreas Gryphius - Ebenbild unseres Lebens.
Interpretation und Charakterisierung der Epoche Barock.
1. Situationsanalyse
Der Unterricht wird in einer nicht näher beschreibbaren 11. Klasse an einem deutschen Gymnasium stattfinden.
2. Gegenstand
2.1 Unterrichtszusammenhang
Der Bildungsplan 2004 sieht vor, dass die Schüler in Klasse 11 wesentliche epochentypische Themen und Gestaltungsmittel in exemplarischen Texten und Werken beschreiben und erklären können. In den vorangegangenen zweiSchuljahren wurde die Epoche Barock eingeführt und skizziert. Anhand des Gedichtes „Ebenbild unseres Lebens“ von Andreas Gryphius sollen nun die epochentypischen Merkmale wiederholt und vertieft werden. Die drei Leitmotive, Memento mori, Vanitas und Carpe diem, stellen hierbei einen zentralen Aspekt dar und sollen in den darauf folgenden Stunden durch weitere Gedichte verbildlicht werden.
Die formale Analyse steht in dieser Unterrichtsstunde zunächst nicht im Vordergrund,wird jedoch eine wesentliche Rolle, in Form einer Wiederholung, in der folgenden Unterrichtsstunde einnehmen. Die Unterrichtsstunde wird den Beginn der Unterrichtseinheit Lyrik, mit dem Themenschwerpunkt Barock, markieren.
2.2 Sachanalyse
Das Sonett „ Ebenbild unseres Lebens“ von Andreas Gryphius stellt die typische Thematik der Epoche Barock dar. Mit dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges spielen die Vergänglichkeit des Glücks, die Nichtigkeit alles irdisch- materiellen Daseins, sowie die Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens eine wesentliche Rolle.
Gryphius` Sonett lässt sich - dem antiken Argumentationsmuster entsprechend - in zwei Quartette und zwei Terzette unterteilen. Das typische Schema in Gedichten des Barocks – These, Beispiele und Schlussfolgerung- findet sich auch in diesem barocken Gedicht.
Das lyrische Ich involviert den Leser sofort in die Thematik des Gedichtes, indem es im Titel „Ebenbild unseres Lebens“ dem Leser das Gefühl gibt, gemeinsam durch das Leben zu schreiten. Die Welt erscheint metaphorisch als Schauplatz, auf dem der Menschagiert. So wie der Schauspieler im Theater an seinen Handlungsort, seine Rolle und die begrenzte Spieldauer gebunden ist, so ist auch der Mensch, ,,weil er allhie lebt" (V.1), an die Welt als Schauplatz gebunden, spielt seine ihm zugewiesene Rolle und muss gleichzeitig erkennen, dass die Spielzeit beziehungsweise die Lebenszeit begrenzt ist. In einer asyndetischen Anordnung der einzelnen Satzteile wird antithetisch auf die Widersprüchlichkeit des Lebens hingewiesen. Das gesellschaftliche Aufsteigen des Einen steht dem Fallen des Anderen gegenüber.
Gryphius zeigt damit die in seinem Jahrhundert gegebene gesellschaftliche Situation auf, in der eine starkeDiskrepanz zwischen dem fürstlichen Prunk und dem einfachen, oft ärmlichen Leben der Bevölkerung herrscht. Die Thematik des Sonetts wird im zweiten Quartett ausgeweitet. Die Aussage des ersten Quartetts vom ,,nicht feste" Sitzen wird hier im Sinne der Vergänglichkeit alles Irdischen gesehen. Wieder in Form von Antithesen wird mit den adverbialen Ausdrücken ,,gestern", ,,jetzt", ,,morgen", ,,vorhin" und ,,nunmehr" auf das barocke Zeitbewusstsein hingewiesen. Alles das, was gestern noch Bestand hatte, ist schon verflossen, doch auch das Glück des Jetzt wird morgen bereits vergangen sein und die vorhin ,,grünen Äste"(V.6) sind ,,nunmehr dürr und tot" (V.7). Dieses Bild vermittelt dem Leser eine recht drastische und darum eindringlich wirkende Vorstellung von der begrenzten Dauer seines Lebens, denn das Schwert, das ,,an zarter Seide schwebt"(V.8), kann jederzeit abreißen und das menschliche Leben beenden.
In den beiden Terzetten wird deutlich, dass der Tod die Unterschiede in der Gesellschaft aufhebt und sich die materiellen Werte wie das Purpurkleid und die Paläste als wertlos aufweisen. Am Ende fordert der Autor seine Leser auf ihr Leben zu leben und sich dessen bewusst zu sein, dass irdische Werte nicht von Dauer sind und beim Übertritt in das Jenseits verloren gehen.
2.3 Didaktische Analyse
Das Gedicht „ Ebenbild unseres Lebens“ soll den Schülern die bedeutende Epoche Barock in Erinnerung rufen, die sie bereits in den vergangenen zwei Schuljahren behandelt haben.
Die charakteristischen Leitmotive des Barock können anhand des Gedichts herausgearbeitet und noch einmal wiederholt und festgehalten werden. Durch die Auseinandersetzung mit den Emotionen, die dieses Gedicht auslöst, werden die Schüler dazu angehalten über das Leben nachzudenken. Durch die emotionale Komponente soll es den Schülern leichter fallen sich in die Situation des lyrischen Ichs und das Leben im Dreißigjährigen Krieg hinein zu versetzen.
Das Gedicht bietet sich ebenfalls als gute Wiederholung der Gattung und Stilmittel an, die in der gegebenen Hausaufgabe herausgearbeitet werden sollen. Die Form und Stilmittel des Gedichts sind ebenfalls eindeutig dem Barock zuzuordnen und können von den Schülern wiederholt und verinnerlicht werden.
[...]
- Quote paper
- Sabrina Detz (Author), 2011, Unterrichtsentwurf zu: Andreas Gryphius - Ebenbild unseres Lebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197253