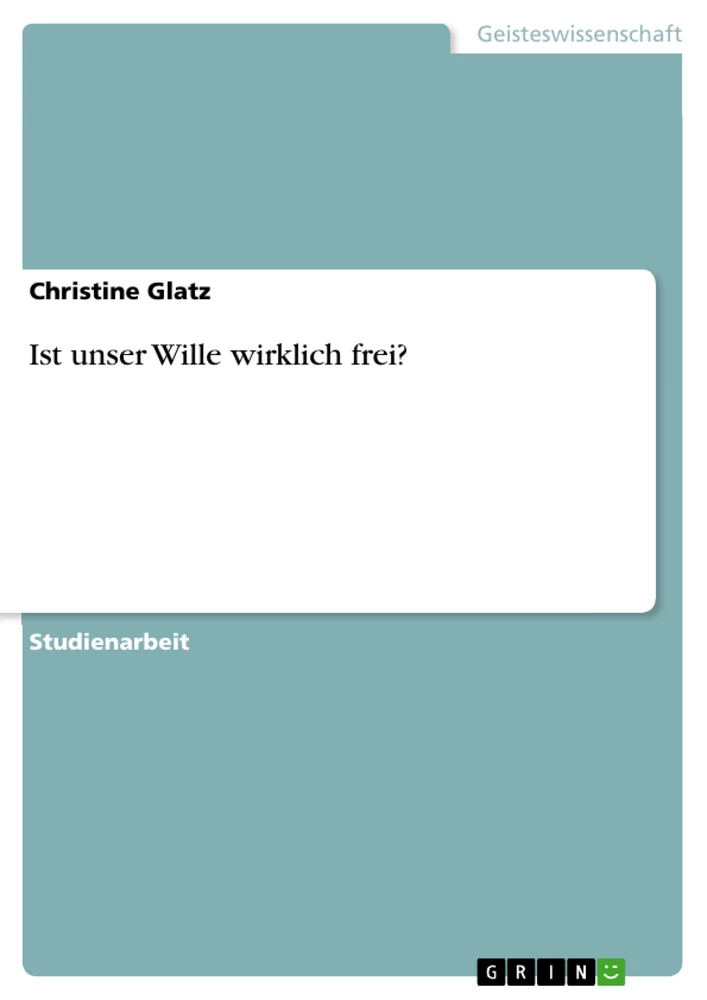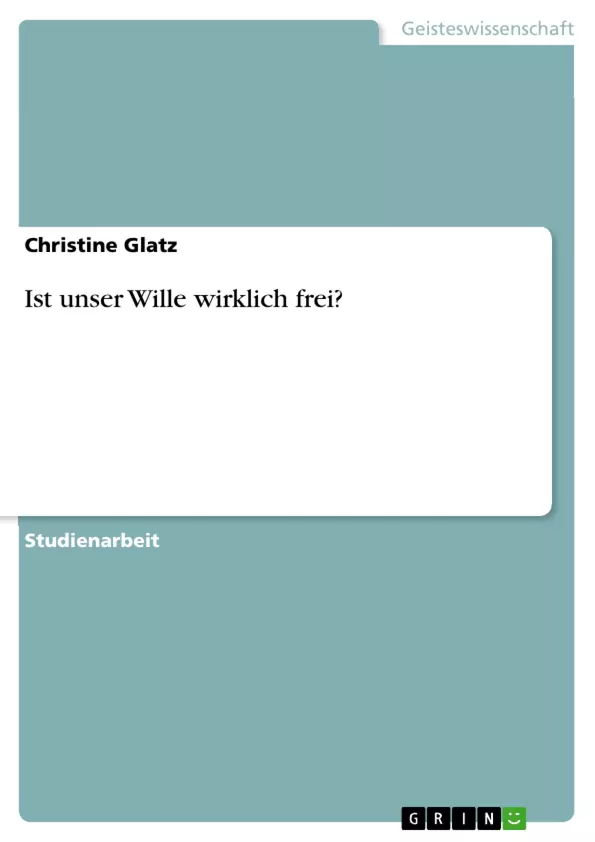1 Einleitung
Das heutige Menschenbild ist geprägt von der Annahme des freien Willens. Doch was genau versteht sich unter dem Konstrukt „freier Willen“? Schon vor 2000 Jahren machten sich einige Philosophen erste Gedanken zu der Definition des freien Willens. Anfang des 20. Jahrhunderts kam dieses Thema auch in den Fokus der Psychologen. Eine allgemein anerkannte Definition des Konstrukts gibt es jedoch bis heute noch nicht. Jede Fachrichtung vertritt eine unterschiedliche Meinung, was wirkliche Willensfreiheit eigentlich bedeutet. Da sich in der folgenden Hausarbeit mit psychologischen Forschungen zu diesem Thema beschäftigt wird, geht die Definition des freien Willens hier auf die psychologische Sicht zurück. Bei dieser Sichtweise ist der freie Wille grundsätzlich auf bewusste Entscheidungsprozesse bezogen. Nach dem 3-Komponenten-Modell des freien Willens müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Handlung als willensfrei angenommen werden kann:
- ¬Die handelnde Person könnte auch eine andere Handlungsalternative wählen
- Die handelnde Person handelt aus verständlichen Gründen, nicht willkürlich
- Die handelnde Person ist die Urheberin ihrer Handlungen
Aktuelle neuropsychologische Forschungen zeigen Hirnaktivitäten auf, welche vermeintlich handlungsvorbereitend sind, aber schon auftreten, bevor eine bewusste Handlungsintention entsteht. Somit wird die Option der wirklichen Willensfreiheit für den Menschen in Frage gestellt. Ist es nun an der Zeit für ein neues Menschenbild, bei dem der Mensch ein Opfer seiner eigenen Neurone ist, welche für alle Gefühle und Handlungen verantwortlich sind?
In dieser Hausarbeit soll sich mit dieser Frage auseinander gesetzt werden. Dazu werden die wichtigsten Experimente der Neuropsychologischen-Forschung zum Thema Willensfreiheit erläutert, diskutiert und einen Ausblick auf zukünftige Investigationen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Libet Experiment (1979)
- Versuchsaufbau
- Ergebnisse
- Kritik
- Experiment von Haggard und Eimer (1999)
- Versuchsaufbau
- Ergebnisse
- Kritik
- Kritische Würdigung der traditionellen Experimente
- Experiment von Haynes, Soon, Brass & Heinze (2008)
- Versuchsaufbau
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage nach der Willensfreiheit anhand neuropsychologischer Experimente. Ziel ist es, die wichtigsten Experimente zu erläutern, zu diskutieren und einen Ausblick auf zukünftige Forschung zu geben. Die Arbeit hinterfragt das traditionelle Menschenbild des freien Willens im Lichte aktueller Forschungsergebnisse.
- Definition des freien Willens aus psychologischer Perspektive
- Analyse des Libet-Experiments und seiner Kritik
- Bewertung weiterer relevanter Experimente zur Willensfreiheit
- Diskussion der Implikationen der Forschungsergebnisse für das Verständnis des menschlichen Handelns
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Willensfreiheit ein und erläutert die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Konzept. Sie stellt die psychologische Sichtweise in den Vordergrund und beschreibt das 3-Komponenten-Modell des freien Willens. Aktuelle neuropsychologische Forschungsergebnisse, die die Willensfreiheit in Frage stellen, werden kurz angesprochen und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt.
Das Libet-Experiment (1979): Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Versuchsaufbau des Libet-Experiments, bei dem Versuchspersonen ihre Hand bewegten und den Zeitpunkt ihres Bewegungswunsches angaben. Die Ergebnisse zeigten ein Bereitschaftspotential im Gehirn, das vor der bewussten Handlungsabsicht auftrat. Dies führte zu der Interpretation, dass Handlungen unbewusst eingeleitet werden und der bewusste Wille bei der Einleitung keine Rolle spielt. Die Kritik an dieser Interpretation und die Möglichkeiten der Einflussnahme durch den bewussten Willen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Libet-Experiment, Bereitschaftspotential (BP), bewusste Handlungsintention, neuropsychologische Forschung, Handlungssteuerung, freier Wille, Determinismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Neuropsychologische Experimente zur Willensfreiheit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert neuropsychologische Experimente, die die Frage nach der Willensfreiheit untersuchen. Sie beinhaltet eine detaillierte Beschreibung und kritische Auseinandersetzung mit Schlüsselstudien, darunter das Libet-Experiment (1979) und das Experiment von Haggard und Eimer (1999), sowie das Experiment von Haynes, Soon, Brass & Heinze (2008). Die Arbeit beleuchtet die methodischen Ansätze, Ergebnisse und die jeweiligen Kritikpunkte der Experimente und diskutiert deren Implikationen für unser Verständnis von Handlungssteuerung und freiem Willen. Zusätzlich werden die Zielsetzung, die wichtigsten Themenschwerpunkte und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel präsentiert.
Welche Experimente werden behandelt?
Die Arbeit behandelt hauptsächlich drei Experimente: Das Libet-Experiment (1979), das Experiment von Haggard und Eimer (1999) und das Experiment von Haynes, Soon, Brass & Heinze (2008). Für jedes Experiment werden der Versuchsaufbau, die Ergebnisse und die jeweilige Kritik detailliert beschrieben.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die wichtigsten neuropsychologischen Experimente zur Willensfreiheit zu erläutern und kritisch zu diskutieren. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Experimente das traditionelle Verständnis von freiem Willen in Frage stellen und beleuchtet die Implikationen für unser Verständnis des menschlichen Handelns. Ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Willensfreiheit, Libet-Experiment, Bereitschaftspotential (BP), bewusste Handlungsintention, neuropsychologische Forschung, Handlungssteuerung, freier Wille und Determinismus.
Wie wird das Libet-Experiment dargestellt?
Das Libet-Experiment wird detailliert beschrieben, inklusive Versuchsaufbau, Ergebnissen (Bereitschaftspotential vor bewusster Handlungsabsicht) und der darauf folgenden Kritik. Die Diskussion beinhaltet die Interpretation der Ergebnisse und die Frage nach dem Einfluss des bewussten Willens.
Welche Kritikpunkte werden an den Experimenten geübt?
Für jedes der behandelten Experimente werden die jeweiligen Kritikpunkte diskutiert. Diese beziehen sich unter anderem auf die Interpretation der Ergebnisse und die methodischen Grenzen der Studien.
Gibt es einen Ausblick auf zukünftige Forschung?
Ja, die Arbeit enthält einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen im Bereich der neuropsychologischen Untersuchung der Willensfreiheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der Beschreibung der einzelnen Experimente, einer kritischen Würdigung und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern den Zugriff auf die relevanten Informationen. Zusätzlich werden die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte explizit benannt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die neuropsychologischen Grundlagen der Willensfreiheit interessieren, insbesondere für Studierende der Psychologie, Philosophie oder Neurowissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Christine Glatz (Autor:in), 2011, Ist unser Wille wirklich frei?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197246