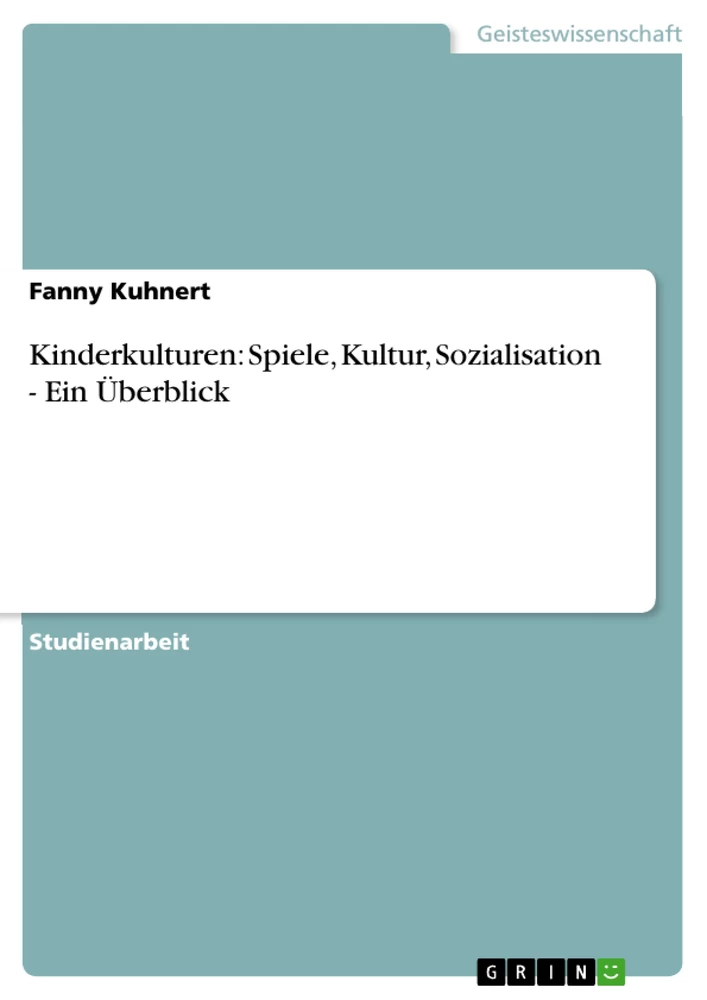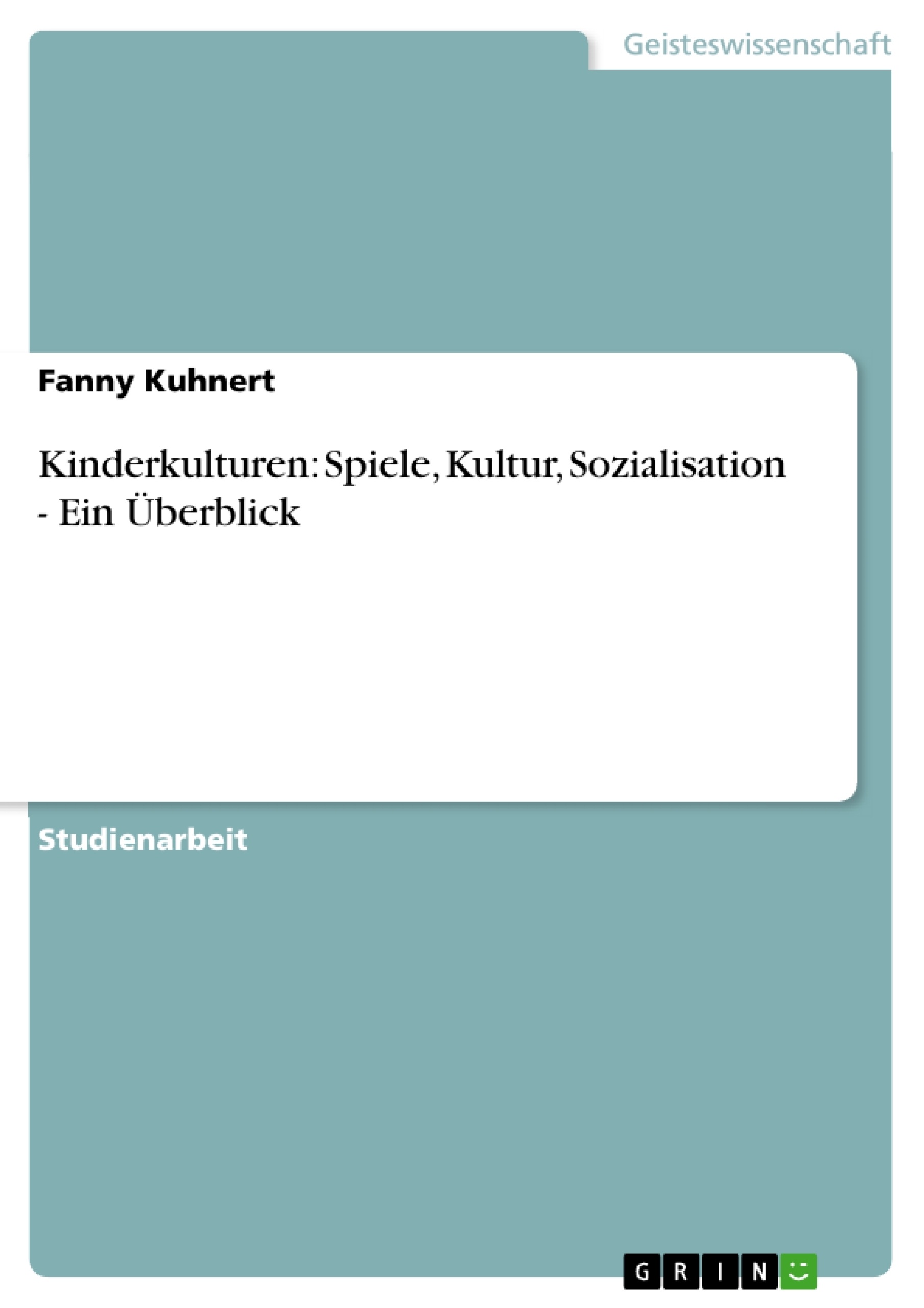„Zusammenfassend formuliert beinhaltet Bildung als lebenslange Aufgabe des Menschen die Aneignung, Weiterführung und aktive Auseinandersetzung mit den kulturellen Errungenschaften der menschlichen Gattung“
Das Spiel als solches und im Allgemeinen stellt einen eigenen Verhaltensbereich dar, bei Mensch und bei Tier. Das Spiel ist immer frei von Zwängen, Zwecken und bestimmten Zielen. Es ergibt sich aus den Subjekten und deren Dynamik heraus. Es bietet und zeigt die gesamte lebendige Bandbreite der „Freiheit und der Nichtfestgelegtheit individuellen Handelns“ und spricht verschiedene Kompetenzbereiche an sowie unterstützt es deren Entwicklung. Hierzu zählen alle Bereiche, die auch in den Bildungs- und Orientierungsplänen für Kinder erarbeitet wurden. So hat das Spiel einen Einfluss auf „emotionale Entwicklung und soziales Lernen, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Lernen, Körper – Bewegung – Gesundheit, Sprache und Sprechen, Lebenspraktische Kompetenzen, Mathematisches Grundverständnis, Ästhetische Bildung, Natur und Lebenswelt, Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz“ und wiederum wird das Spiel von diesen bereits internalisierten Faktoren bzw. Kompetenzen in seiner Dynamik beeinflusst. In jeder Kultur, insbesondere die der Kinder, hat das Spiel einen bedeutenden Stellenwert, d.h. jedes Kind spielt, egal welchen Alters oder Herkunft.
Inhaltsverzeichnis
Theoretischer Teil Spiel / Kultur / Sozialisation Seite 3-6
Transkription ausgewählter Filmsequenz Seite 6-8
Analyse und Bezug zum Thema Seite 8-9
„Zusammenfassend formuliert beinhaltet Bildung als lebenslange Aufgabe des Menschen die Aneignung, Weiterführung und aktive Auseinandersetzung mit den kulturellen Errungenschaften der menschlichen Gattung“[1]
Das Spiel als solches und im Allgemeinen stellt einen eigenen Verhaltensbereich dar, bei Mensch und bei Tier. Das Spiel ist immer frei von Zwängen, Zwecken und bestimmten Zielen.[2] Es ergibt sich aus den Subjekten und deren Dynamik heraus. Es bietet und zeigt die gesamte lebendige Bandbreite der „Freiheit und der Nichtfestgelegtheit individuellen Handelns“[3] und spricht verschiedene Kompetenzbereiche an sowie unterstützt es deren Entwicklung. Hierzu zählen alle Bereiche, die auch in den Bildungs- und Orientierungsplänen für Kinder erarbeitet wurden. So hat das Spiel einen Einfluss auf „emotionale Entwicklung und soziales Lernen, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Lernen, Körper – Bewegung – Gesundheit, Sprache und Sprechen, Lebenspraktische Kompetenzen, Mathematisches Grundverständnis, Ästhetische Bildung, Natur und Lebenswelt, Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz“[4] und wiederum wird das Spiel von diesen bereits internalisierten Faktoren bzw. Kompetenzen in seiner Dynamik beeinflusst. In jeder Kultur, insbesondere die der Kinder, hat das Spiel einen bedeutenden Stellenwert, d.h. jedes Kind spielt, egal welchen Alters oder Herkunft. Im frühkindlichen Alter von Geburt – 6 Jahren hat das Spiel für Kinder eine elementare Bedeutung, d.h. sie lernen durch das Spiel und verarbeiten gleichzeitig emotionale Erlebnisse. Das Spiel kann 2 grundlegende Funktionen erfüllen:
Zum einen bietet es eine „funktionale Fördermöglichkeit“[5]. Gerd Schäfer beschreibt im Handbuch für Sozialpädagogik diese Funktion das Spiel auch als „Trojanisches Pferd“. Das bedeutet, dass in dem Spiel konkrete Kompetenzen nachgeahmt, ausprobiert und geübt werden. Ein anschauliches Beispiel ist das Spiel von Wolfswelpen. Sie raufen, jagen sich, toben, unterwerfen usw. Dies ist für ihr späteres Leben lebensnotwendig, wenn sie groß genug sind, selbst auf die Jagd zu gehen, für Nahrung zu sorgen und für den Ernstfall, d.h. einen Angriff eines anderen Tieres, gewappnet zu sein und sich wehren zu können.
Auf der anderen Seite kann aber die „besondere Struktur des Spiels“[6] vordergründig sein. Dazu zählen das freie und spontane Handeln im Spiel, subjektive Handlungsautonomie, Unvorhersehbarkeit und die Spannung zwischen den Regeln und unvorhersehbaren Handlungen[7].
Kinder leben in einer Kultur, in der sie hineingeboren werden, z.B. der Kultur ihres Herkunftslandes. Eine Kultur „trifft begründete Aussagen über Gestaltungsformen, die Menschen in zeitlich und räumlich bestimmbaren sozialen Verhältnissen hervorbringen“[8]. Kultur ist immer eine vom Menschen veränderte Umgebung. Diese kann sich auf organische Faktoren beziehen, z.B. in Architektur, Lebensmittel, Kleidung. Aber auch im kommunikativen Bereich spiegelt sie sich wieder, z.B. in Sprache, Regeln des Zusammenlebens oder Gewohnheiten. Eine Kultur ist demnach das Ergebnis von „Sinnorientierungen“[9] und „Handlungsentwürfen“[10] Sie leben aber auch in einer Kultur innerhalb ihrer Familie, die ihre eigenen Werte, Normen und Regeln schafft. Das Spiel kann die kulturellen Werte und Normen der jeweiligen Gesellschaft für Kinder transparent machen. Kinder probieren sich im Spiel aus und ahmen Verhaltensweisen der Erwachsenen nach. Sie nehmen sich die Erwachsenen und das Geschehen ihrer Umgebung als Vorbild. Beim Spielen werden Werte und Normen, Erlebtes, Gesehenes der kulturellen Umgebung der Kinder jedoch nicht moralisch bewertet oder beurteilt[11].
Aus der umgebenen Kultur, welche eine Kultur für Kinder darstellt, weil sie nicht von den Kindern selbst geschaffen wurde, schaffen sich Kinder eigenständig eine Kultur von Kindern. Sie schaffen sich ihre eigenen sozialen Beziehungen mit Regeln im sozialen Umgang, rekonstruieren und konstruieren soziale Beziehungen und schaffen sich eigene Bedingungen, um in ihrer Kultur zu leben.[12] Dabei ist das Spiel für sie keineswegs ein bewusstes Spiel. Für Kinder ist diese Art von Spiel, d.h. das freie, zwangfreie Spiel, erlebte Realität. Sie gestalten die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen.
[...]
[1] Ver.di - Bundesfachgruppe Sozial-, Kinder- und Jugnedhilfe (2002): Bildung in Kindertagesstätten. Universität Lüneburg. Berlin. S.104
[2] Schäfer, Gerd. (2005): Spiel. In: Otto, H.-U. / Thiersch, H. [Hrsg.]: Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik (3. Aufl.) München. S. 1806-1812.
[3] Ebd.
[4] Niedersächsisches Kultusministerium (2005): Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder Hannover. Inhaltsverzeichnis
[5] Schäfer, Gerd. (2005): Spiel. In: Otto, H.-U. / Thiersch, H. [Hrsg.]: Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik (3. Aufl.) München. S. 1806-1812.
[6] Ebd.
[7] Vgl. ebd.
[8] Treptow, R. (2005): Kulturtheorie. In: Otto, H.-U. / Thiersch, H. [Hrsg.]: Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik (3. Aufl.) München. S. 1110-1118
[9] Ebd.
[10] Ebd.
[11] Niedersächsisches Kultusministerium (2005): Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder Hannover. S. 37
[12] Vgl. ebd.
- Quote paper
- Fanny Kuhnert (Author), 2011, Kinderkulturen: Spiele, Kultur, Sozialisation - Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197234