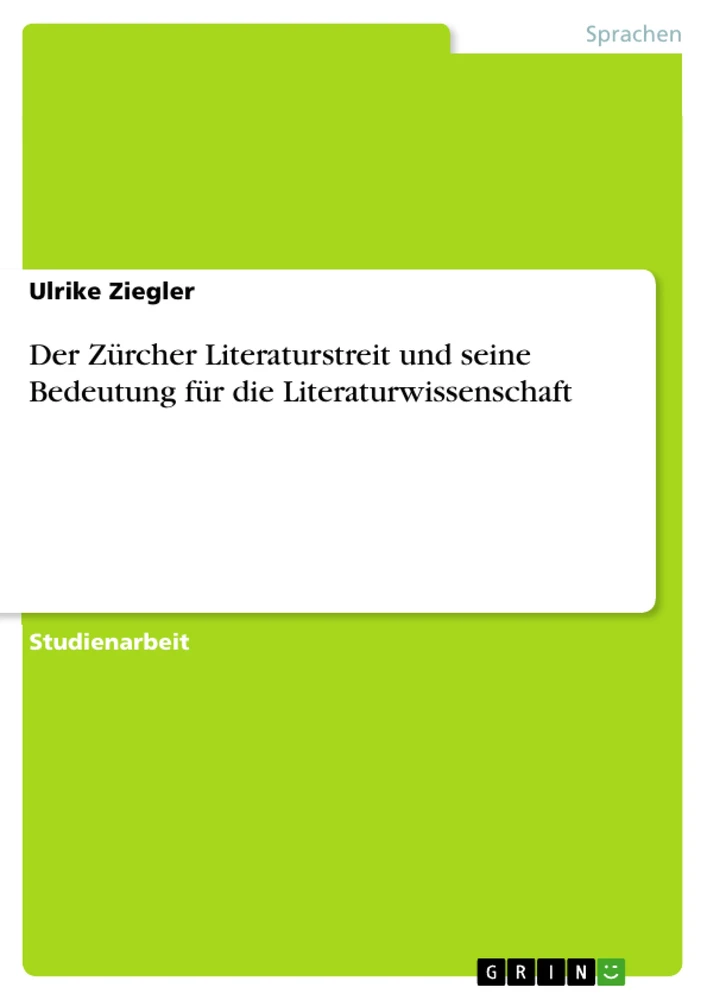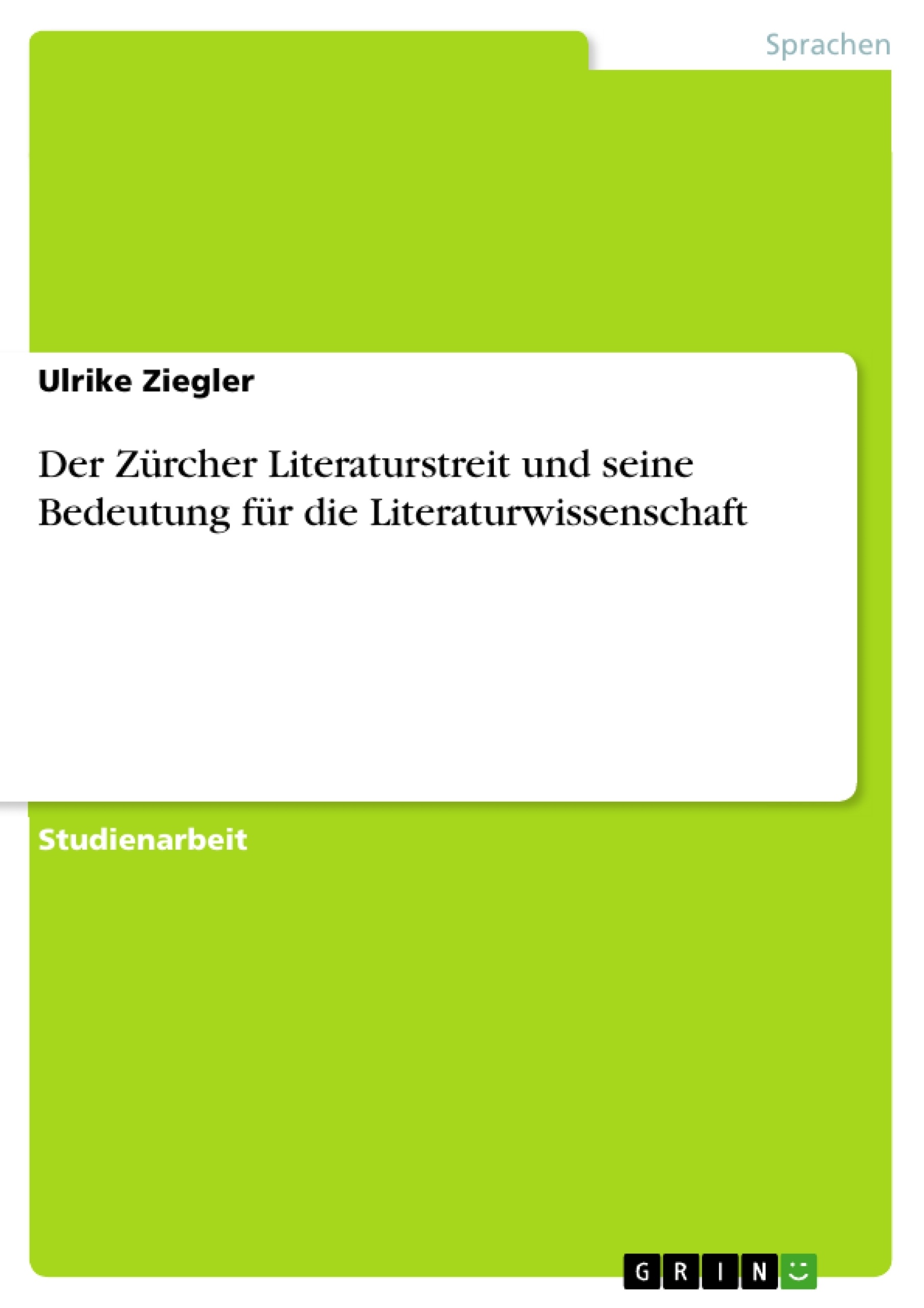In der Geschichte gab es immer wieder Kontroversen über die Beschaffenheit von Literatur: Im 17. Jahrhundert war es Charles Perrault, der die damals herrschende Autorität der antiken Schriftsteller angriff und ihnen nicht nur einen unabhängigen Wertanspruch, sondern eine Überlegenheit der neuzeitlichen französischen Literatur entgegenstellte. Um Perraults Aussagen entwickelte sich in der Folge ein Streit, der als Querelle des Anciens et des Modernes bekannt geworden ist. Die Kontroverse wurde in verschiedenen Formen immer wieder aufgenommen, so auch in den verschiedenen Naturalismus- und Realismusdebatten des 19. Jahrhunderts bis hin zur Expressionismusdebatte der 1930er Jahre. Jeweils standen sich dabei Parteien gegenüber, die gewisse Vorstellungen davon hatten, was Literatur zu leisten hat und wie sie zu gestalten ist. In eben dieser Tradition steht der Zürcher Literaturstreit aus dem Jahr 1966. Er entzündete sich an einer Rede von Emil Staiger, die er anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Stadt Zürich hielt. In seinem Vortrag Literatur und Öffentlichkeit formulierte Staiger dabei seine Forderungen und Erwartungen an Literatur und provozierte damit eine ganze Generation von Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern. Zusammengefasst unterstreicht Staiger die Verantwortung des Schriftstellers gegenüber der Öffentlichkeit und postuliert, die moderne Literatur habe weder ästhetischen noch ethischen Wert. Schon wenige Tage später folgten Reaktionen in der Presse. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Erwartungen an Literatur von den verschiedenen Parteien gestellt werden. Dazu soll analysiert werden, welche Wertmaßstäbe die Kritiker und Befürworter der Rede an Literatur anlegen und mit welchen Argumenten sie ihre Standpunkte verteidigen. Von zentralem Interesse ist die Frage, welche Folgen die Kontroverse hatte und welche Bedeutung ihr innerhalb der damaligen und heutigen Literaturwissenschaft zukommt. Wichtig dafür ist u. a. die Frage, was die Gründe dafür waren, dass der Streit − selbst in nicht-wissenschaftlichen Kreisen – für enormes Aufsehen sorgte. Wie erwähnt, gab es eine Vielzahl an Reaktionen auf die Rede Staigers. Es ist unmöglich, alle Beiträge im Rahmen dieser Arbeit zu berücksichtigen. Zur Untersuchung werden deshalb nur einige der zeitlich unmittelbaren Kommentare herangezogen. Die Texte wurden so ausgewählt, dass ein möglichst repräsentativer Überblick über die verschiedenen Standpunkte gegeben ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wertungstheorien
- Analyse der Texte
- Emil Staiger: Literatur und Öffentlichkeit
- Reaktionen
- Funktion von Literatur
- Ideologieverdacht
- Methodendiskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zürcher Literaturstreit von 1966, der durch Emil Staigers Rede „Literatur und Öffentlichkeit“ ausgelöst wurde. Ziel ist es, die unterschiedlichen Erwartungen an Literatur zu beleuchten, die in den Reaktionen auf Staigers Rede zum Ausdruck kamen. Dabei werden die Wertmaßstäbe der Kritiker und Befürworter von Staigers Position analysiert und die Argumente, mit denen sie ihre Standpunkte verteidigen, untersucht.
- Die verschiedenen Perspektiven auf Literatur im Zürcher Literaturstreit
- Die Rolle von Wertungstheorien in der Beurteilung literarischer Werke
- Die Folgen des Literaturstreits für die damalige und heutige Literaturwissenschaft
- Die Bedeutung der Kontroverse für die öffentliche Rezeption von Literatur
- Die Frage nach den Kriterien für eine gelungene literarische Wertung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Zürcher Literaturstreit in den historischen Kontext der Debatten über die Natur von Literatur. Sie erläutert die Kontroversen um Charles Perraults Kritik an der antiken Literatur und die verschiedenen Realismus- und Naturalismusdebatten des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt dabei auf Staigers Rede „Literatur und Öffentlichkeit“ und deren Auswirkungen auf die Literaturwissenschaft.
Wertungstheorien
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach den Kriterien für eine gelungene literarische Wertung. Es werden die Wertungstheorien von Simone Winko und Jürgen Stenzel vorgestellt. Winko definiert Wertung als die Zuweisung von positiven oder negativen Eigenschaften an ein Objekt. Sie unterscheidet vier Kategorien von Wertmaßstäben: formal-ästhetische, inhaltliche, relationale und wirkungsbezogene Wertungen. Stenzel betrachtet die Wertung als abhängig von Überzeugungen, Erfahrungen und Feststellungen. Er analysiert den Einfluss von Bedürfnissen, kulturellen Erfahrungen und Textfunktionen auf die Wertung.
Analyse der Texte
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Reaktionen auf Staigers Rede und den unterschiedlichen Ansichten über die Funktion und den Wert von Literatur.
- Quote paper
- Ulrike Ziegler (Author), 2012, Der Zürcher Literaturstreit und seine Bedeutung für die Literaturwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197201