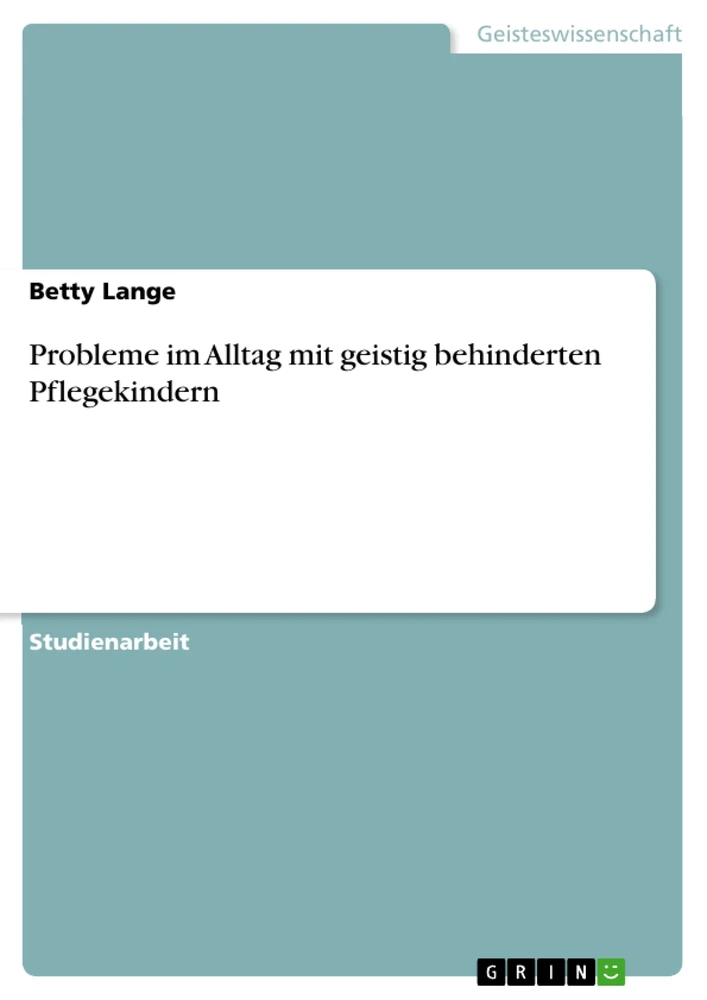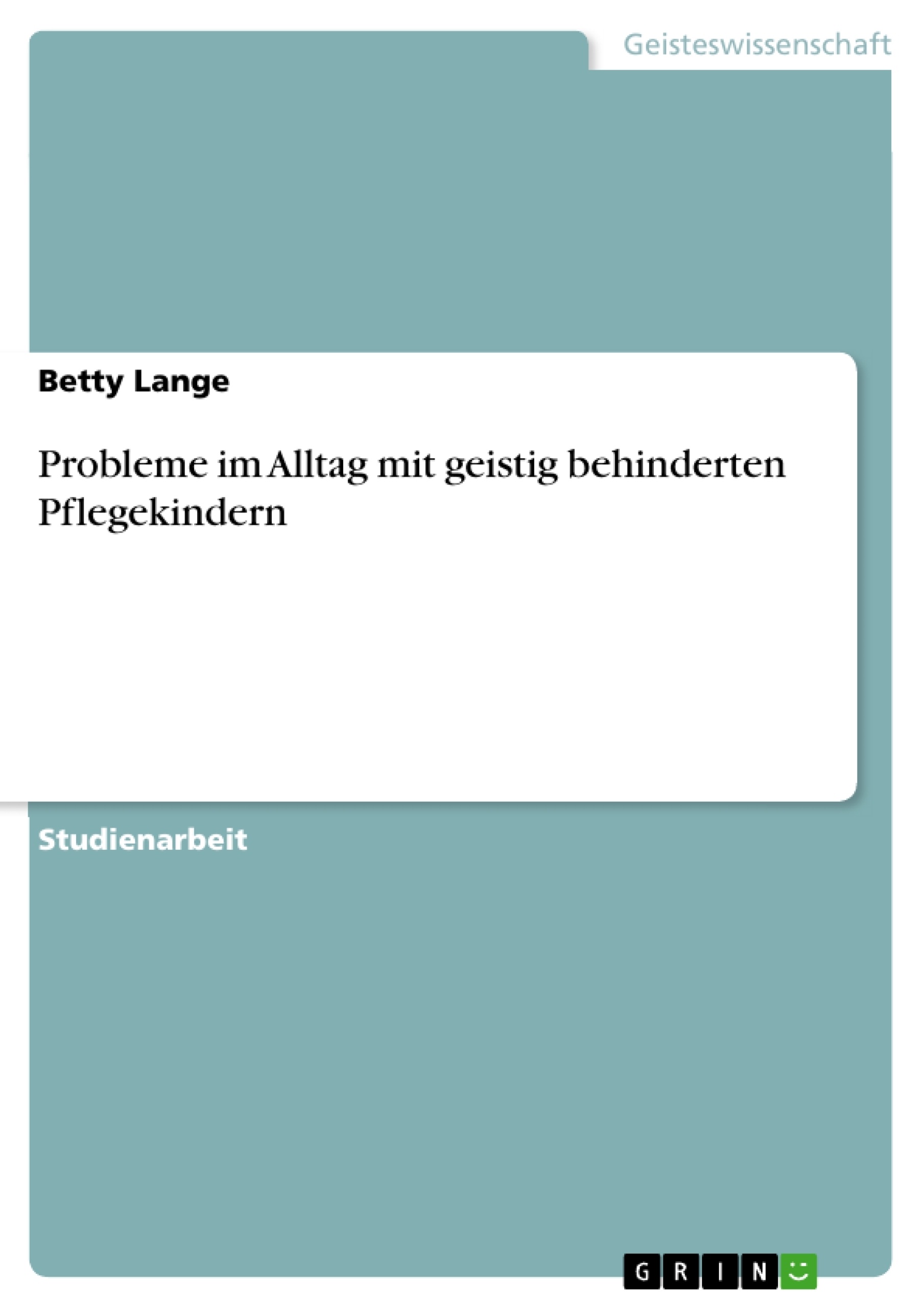„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Konfuzius
Viele Familien in Deutschland nehmen Pflegekinder auf. Wie gehen die Familien jedoch mit der Tatsache um, wenn sich herausstellt dass bei diesen Kindern geistige Defizite vorhanden sind? Zu welchen Problemen führt dies in der Familie, im weiteren Umfeld, sowie im Alltag? Bei Kindern mit körperlichen Behinderungen ist ihre Andersartigkeit offensichtlich, Rücksichtnahme ergibt sich oft von selbst – doch wie ist es bei Behinderungen, die nahezu unsichtbar sind, nicht auf den ersten Blick zu erkennen? Wie reagieren Außenstehende auf diese Kinder und deren Eltern? Stellvertretend für all die geistigen Behinderungen, soll es um eine geminderte Durchschnittsintelligenz gehen.
Die Zahl der Kinder, die ohne körperliche Fehlbildung, dafür aber mit geistigen Defiziten und Verhaltensstörungen zur Welt kommen, wird auf 15.000 bis 20.000 im Jahr geschätzt! Rund sechs von Tausend Kindern die in der Bundesrepublik geboren werden, sind geistig behindert. Hierzulande leben derzeit ungefähr 450 000 Menschen mit einer geistigen Behinderung, davon, laut Erhebungen des statistischen Bundesamts, 134 000 Minderjährige unter 15 Jahre. Die oft folgenschweren Schäden beeinträchtigen vor allen die geistigen Fähigkeiten und bedeuten oft erhebliche Lerndefizite.
Im ersten Teil der Arbeit sollen zunächst einige Begriffe erläutert und definiert werden, die sich in der Arbeit gehäuft wieder finden. Anschließend folgt die Annäherung an die Forschungsfrage und die Aufstellung der Arbeitshypothesen. Vor der praktischen Durchführung des Interviews steht die Wahl der Methode, mit der die Forschungsfrage untersucht werden soll. Im praktischen Teil wird das Interview dokumentiert und ausgewertet. Im Anhang finden sich der Kurzfragebogen, der Leitfaden, sowie das Transkript des Interviews samt Postskript. Wird in dieser Arbeit die männliche Anrede verwendet, so sind Frauen ebenso gemeint. Wird von dem Kind gesprochen, so handelt es sich dabei um das Pflegekind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen im Kontext der Forschungsarbeit
- Überlegungen zu Forschungsfrage und Hypothesen
- Die Forschungsfrage
- Die Hypothese
- Überlegung zur Methodenwahl
- Praktische Durchführung des problemzentrierten Interviews
- Auswertung der Daten und der Darstellung der Ergebnisse
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen im Alltag von Pflegefamilien mit geistig behinderten Kindern. Die Zielsetzung ist es, ein tieferes Verständnis der spezifischen Probleme zu entwickeln, die sich aus der geistigen Behinderung des Kindes ergeben und wie diese das Familienleben, das Umfeld und den Alltag beeinflussen.
- Probleme im täglichen Leben mit geistig behinderten Pflegekindern
- Einfluss der geistigen Behinderung auf das familiäre Umfeld
- Reaktionen des sozialen Umfelds auf das Kind und seine Familie
- Emotionale Bindung zwischen Pflegeeltern und Kind
- Methodische Herangehensweise an die Erforschung des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Herausforderungen im Umgang mit geistig behinderten Pflegekindern ein. Sie verweist auf die steigende Zahl von Kindern mit geistigen Behinderungen und die damit verbundenen Probleme für Pflegefamilien. Der Zitat von Konfuzius hebt die Bedeutung von praktischem Verständnis hervor und bildet eine Brücke zur Forschungsfrage, die sich mit den alltäglichen Problemen dieser Familien auseinandersetzt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die verwendeten Methoden.
Begriffsdefinitionen im Kontext der Forschungsarbeit: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "geistige Behinderung" und "Probleme im Alltag". Es wird differenziert zwischen den verschiedenen Ursachen und Ausprägungen geistiger Behinderungen und betont die damit verbundenen Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten. Die Definition von "Problemen" im Kontext der Studie wird klargestellt als Beeinträchtigungen des Alltags, die spezifisch durch die Behinderung des Kindes entstehen.
Überlegungen zu Forschungsfrage und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: Welche Probleme ergeben sich im Alltag mit einem geistig behinderten Pflegekind? Es werden drei Arbeitshypothesen aufgestellt, die den Einfluss der geistigen Behinderung auf das Familienleben, die Reaktionen des Umfelds und die emotionale Bindung zum Kind untersuchen. Die Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Beschaffung von Daten und verdeutlicht die Komplexität des Themas.
Überlegung zur Methodenwahl: Dieses Kapitel erläutert die Wahl des problemzentrierten Interviews als Forschungsmethode. Die Begründung für diese Wahl liegt in der Notwendigkeit, einen tiefen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Pflegefamilie zu erhalten. Die Entscheidung für die Befragung der Mutter des Kindes wird begründet mit dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes. Der Bezug auf das "theoretical Sampling" unterstreicht das Bestreben, einen repräsentativen Fall zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Pflegekinder, Pflegefamilien, Alltagsprobleme, Qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview, Emotionale Bindung, Integrative Erziehung, Soziale Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Herausforderungen im Alltag von Pflegefamilien mit geistig behinderten Kindern
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen im Alltag von Pflegefamilien mit geistig behinderten Kindern. Sie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der spezifischen Probleme zu entwickeln, die sich aus der geistigen Behinderung des Kindes ergeben und wie diese das Familienleben, das Umfeld und den Alltag beeinflussen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Probleme im täglichen Leben mit geistig behinderten Pflegekindern, den Einfluss der geistigen Behinderung auf das familiäre Umfeld, Reaktionen des sozialen Umfelds, die emotionale Bindung zwischen Pflegeeltern und Kind und die methodische Herangehensweise an die Erforschung des Themas.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Probleme ergeben sich im Alltag mit einem geistig behinderten Pflegekind?
Welche Methoden wurden verwendet?
Als Forschungsmethode wurde das problemzentrierte Interview gewählt, um einen tiefen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Pflegefamilie zu erhalten. Die Mutter des Kindes wurde befragt, begründet durch das Alter und die Fähigkeiten des Kindes. Das "theoretical Sampling" wurde angewendet, um einen repräsentativen Fall zu untersuchen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Begriffsdefinitionen, Überlegungen zur Forschungsfrage und Hypothesen, die Methodenwahl, die praktische Durchführung des Interviews, die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse sowie ein Fazit und Ausblick. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Begriffsdefinitionen klären zentrale Begriffe. Die Kapitel zu Forschungsfrage und Hypothesen stellen die Forschungsfrage und die Arbeitshypothesen vor. Die Methodenwahl beschreibt die gewählte Methode (problemzentriertes Interview). Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse fasst die Ergebnisse zusammen, und das Fazit und der Ausblick geben einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Geistige Behinderung, Pflegekinder, Pflegefamilien, Alltagsprobleme, Qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview, Emotionale Bindung, Integrative Erziehung und Soziale Inklusion.
Welche Hypothesen wurden aufgestellt?
Die Arbeit stellt drei Arbeitshypothesen auf, die den Einfluss der geistigen Behinderung auf das Familienleben, die Reaktionen des Umfelds und die emotionale Bindung zum Kind untersuchen. Die genauen Formulierungen der Hypothesen sind im entsprechenden Kapitel der Arbeit nachzulesen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der Vorschau angegeben, sondern müsste der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
- Quote paper
- Betty Lange (Author), 2012, Probleme im Alltag mit geistig behinderten Pflegekindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197179