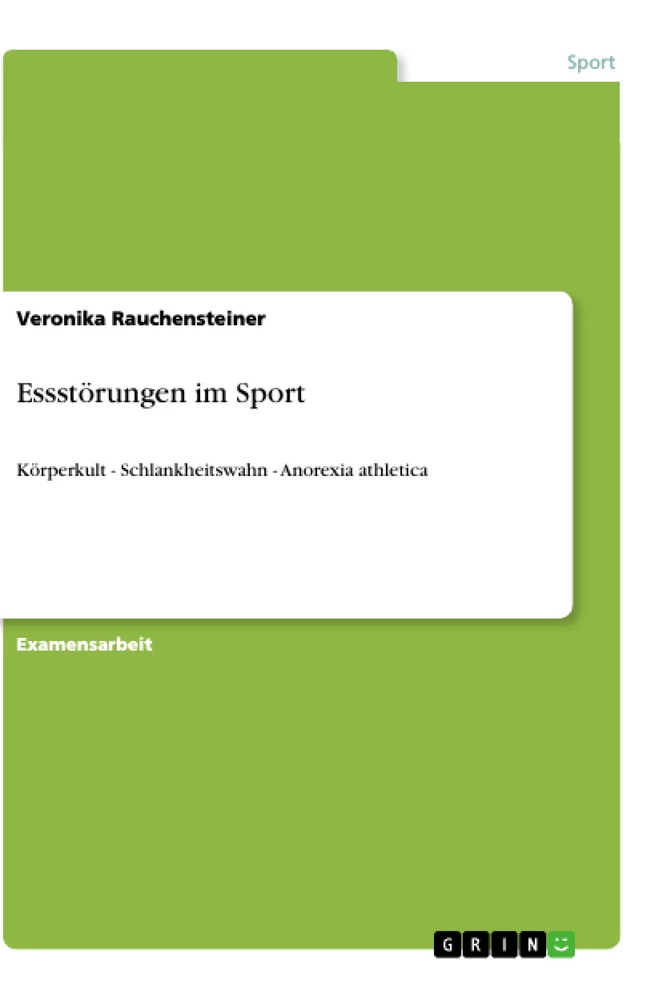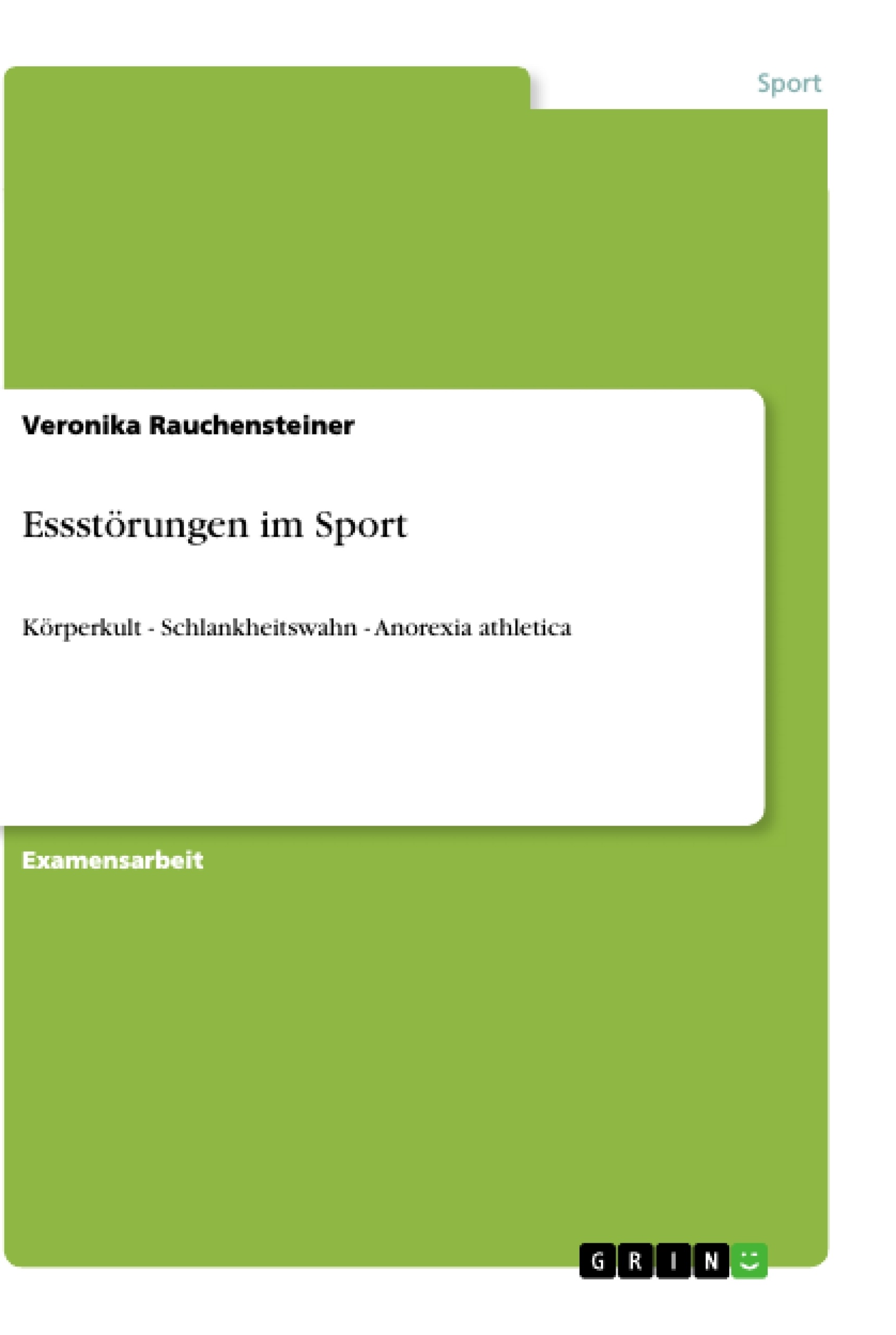Zu keiner Zeit stand körperliche Attraktivität wohl im Mittelpunkt der Medien wie heute (Stahr 2000, S. 82). Und tatsächlich ordnen sich heute in erschreckenden Dimensionen Frauen – jeden Alters – einem Schönheitsideal unter, das unter ´normalen´ und gesunden Umständen nur selten zu erreichen ist. Bette (1993, S. 41) zufolge scheint der Körper „ ... als beobachtbare Größe ... die Instanz zu sein, um die eigene Individualität zu markieren und sozial wirkungsvoll vorzuführen“. Der menschliche Körper als Symbol für Ansehen und Attraktivität – eine solche Haltung äußert sich beim weiblichen Geschlecht mehr und mehr in den Essstörungen Anorexie und Bulimie (Waldrich 2004, S. 63), denn vor allem Frauen sehen sich dem Diktat des Schlankheitsideals unserer heutigen Gesellschaft untergeordnet. Mit dem folgenden Zitat von Marya Hornbacher (2003, S. 18) scheint sich der enorme Einfluss der Industriegesellschaften auf Essstörungen zu bestätigen:
„Auch mir standen andere Methoden der Selbstzerstörung zur Verfügung, unzählige Ventile, die ich für meinen Perfektionismus, meinen Ehrgeiz, meine übertriebene Intensität hätte suchen können. Es hätte unzählige andere Möglichkeiten gegeben, mich mit der von mir als höchst problematisch empfundenen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Aber ich wählte die Essstörung. Deshalb glaube ich, dass ich mir andere Mittel gesucht hätte, um von der Gesellschaft anerkannt zu werden, wenn ich in einer Gesellschaft aufgewachsen wäre, die Schlankheit nicht zu einem hohen Gut erklärt.“
Hierzulande bestimmen, im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor, Körper und Aussehen das Lebensgefühl (Seyfahrt 2000, S. 17) – der Markt hat die Oberhand über unser Essverhalten gewonnen. Ein schlanker und fitter Frauenkörper verspricht nach allgemeiner Ansicht Erfolg, so dass frau dem Schönheitsideal um jeden Preis entsprechen will (Waldrich 2004, S. 63). Die Autoren Stahr et al. interpretieren die Entwicklung der ´Modellierung´ folgendermaßen:
„Frauen [haben] im Laufe der Geschichte in immer perfekterer Weise gelernt, diese zu Stereotypen herangereiften Bilder einer idealen Weiblichkeit zu verinnerlichen und ihren Körper dementsprechend zu modellieren. … Die Bildung ihrer Identität richtet sich nach ihrer Wirkung nach außen und spiegelt sich in ihrer körperlichen Modellierung“ (ebd. 1998, S. 17).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Schlankheitsideal aus historischer und aktueller Sicht
- 2.1 Das weibliche Körperbild in den verschiedenen Epochen
- 2.2 Wandel der medizinischen Maßstäbe
- 2.3 Wandel des Idealbildes
- 2.4 90-60-90' – Pathologie der ´Idealmaße´
- 3. Schönheitskult und Schlankheitswahn
- 3.1 Der Körper als Statussymbol
- 3.1.1 'Dünnsein' als Schlüssel zum Erfolg
- 3.1.2 'Dicksein' als sozialer Makel
- 3.1.3 Kulturkomparatistische Perspektiven: Andere Völker - andere Sitten
- 3.1.4 Der besondere Druck für das weibliche Geschlecht
- 3.2 Körperbild und Attraktivität
- 3.2.1 Die wachsende Bedeutung von Attraktivität in Industriegesellschaften
- 3.2.2 Exemplarisches Statement: Ansichten einer ´öffentlichen Person´
- 3.3 Unsere Konsumkultur – Die Bedeutung der kommerziellen Zwänge
- 3.4 Der Stellenwert von Sport und Fitness in unserer Gesellschaft
- 3.5 Models - 'Vorbilder ohne Maß'
- 3.6 Frauenzeitschriften - Das Bild der Frau
- 3.6.1 Die 'falsche Realität' in den Zeitschriften
- 3.6.2 Das Thema 'Abnehmen' als Kassenschlager
- 3.6.3 Ideal und Realität – das Dilemma der Selbstakzeptanz
- 3.6.4 Stars und ihr Kampf um die Traumfigur
- 3.1 Der Körper als Statussymbol
- 4. Diäten als 'Einstiegsdroge'
- 4.1 Verbreitung von Diäten
- 4.2 Die Diätfalle - Im Teufelskreis der Abmagerungskuren
- 4.3 Ein Experiment zu Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten
- 4.4 Körperliche Risiken bei Diäten
- 5. Essstörungen - Ein allgemeiner Überblick über Anorexie und Bulimie
- 5.1 Anorexia nervosa (Magersucht)
- 5.1.1 Entwicklungsgeschichte
- 5.1.2 Bezeichnung und Definition
- 5.1.3 Diagnosekriterien
- 5.1.4 Körperschemastörung und Körpergefühl
- 5.1.5 Krankheitsbedingte Folgeerscheinungen
- 5.1.6 Magersüchtige und ihre Beziehung zum Essen
- 5.1.7 Häufigkeit und Verbreitung: Die Pubertät als kritische Zeit
- 5.1.8 Heilungschancen
- 5.1.9 Sterblichkeitsrate
- 5.2 Die Thematisierung von Essstörungen in der Öffentlichkeit
- 5.2.1 Provokation - der richtige Weg zur Aufklärung?
- 5.2.2 Untergewicht - verbreitet wie verharmlost
- 5.3 Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht)
- 5.3.1 Entwicklungsgeschichte
- 5.3.2 Bezeichnung und Definition
- 5.3.3 Diagnosekriterien
- 5.3.4 Krankheitsbedingte Folgeerscheinungen
- 5.3.5 Ess-Brech-Süchtige und ihre Beziehung zum Essen
- 5.3.6 Häufigkeit und Verbreitung
- 5.3.7 Heilungschancen
- 5.4 Ein gestörtes Essverhalten
- 5.1 Anorexia nervosa (Magersucht)
- 6. Gesellschaftlich bedingte Einflussfaktoren auf Essstörungen
- 6.1 Das Körperideal unserer Gesellschaft
- 6.2 Die Wirksamkeit der Medien
- 6.3 Die Frau im Rollen-Spagat
- 6.4 Essstörungen als Lifestyle: Die Pro-Ana-Szene
- 7. Eine sportbezogene Essstörung: Die Anorexia athletica
- 7.1 Untersuchungen (zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern)
- 7.2 Bezeichnung und Definition der Anorexia athletica
- 7.3 Unterschiede zur Anorexia nervosa
- 7.4 Zusammenhänge zwischen Essstörungen und Sport
- 7.5 Übergang von exzessivem Sporttreiben zur Anorexia nervosa
- 7.6 Gemeinsamkeiten mit der Anorexia nervosa
- 7.7 Symptomatik bei der Anorexia athletica
- 7.7.1 Erste körperliche Veränderungen
- 7.7.2 Verhaltensauffälligkeiten und -veränderungen
- 7.8 Sportförderung im Jugendalter
- 7.8.1 Körperliche Entwicklung und Leistungssport
- 7.8.2 Belastungen für die psychische Gesundheit von Leistungssportlern
- 7.9 Der Stellenwert einer ausgewogenen Ernährung im Sport
- 7.9.1 Bedeutung und Konsequenzen einer Mangelernährung für Sportler
- 7.9.2 Ein gesundes Verhältnis zwischen Belastung und Energiebedarf
- 7.10 Körperliche Komplikationen und mögliche Folgeschäden
- 7.10.1 Auswirkungen auf den Hormonhaushalt
- 7.10.2 Auswirkungen auf die Menstruation
- 7.10.3 Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel (mit Fallbeispiel)
- 7.11 Prävention einer Anorexia athletica
- 8. Entstehungsfaktoren einer Anorexia athletica
- 8.1 Anforderungsprofile im Hochleistungssport
- 8.2 Gewichtsreduktion als sportartspezifische Notwendigkeit
- 8.3 Prävalenz der Essstörungen in den ästhetischen Sportarten
- 8.4 Die Rolle des Trainers (mit Fallbeispielen)
- 8.5 Die überzogene Kultivierung des Schlankheitsideals im Sport
- 8.6 Druckaufbau seitens der Medien
- 9. Thematisierung von Anorexia athletica in der Öffentlichkeit
- 9.1 Problematisierung eines heiklen Themas im Leistungssport
- 9.2 Änderungen der Wettkampfbedingungen als Vorbeugung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Essstörungen, insbesondere im Kontext des gesellschaftlichen Schlankheitsideals. Der Fokus liegt auf der Analyse der historischen Entwicklung dieses Ideals, dem Einfluss der Medien und der Konsumkultur sowie den spezifischen Herausforderungen im Leistungssport.
- Die historische Entwicklung des weiblichen Körperbildes und des Schlankheitsideals
- Der Einfluss der Medien und der Konsumkultur auf das Körperbild und Essstörungen
- Anorexie und Bulimie: Ursachen, Symptome und Folgen
- Anorexia athletica: Eine sportbezogene Essstörung
- Gesellschaftliche und individuelle Faktoren, die zu Essstörungen beitragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These auf, dass das heutige Schönheitsideal, insbesondere für Frauen, zu einem erschreckenden Ausmaß an Essstörungen wie Anorexie und Bulimie führt. Sie verweist auf den Einfluss der Industriegesellschaft und den Körper als Symbol für Ansehen und Attraktivität. Zitate von Marya Hornbacher und anderen Autor*innen unterstreichen die gesellschaftliche Komponente von Essstörungen und den Druck, dem Frauen ausgesetzt sind.
2. Das Schlankheitsideal aus historischer und aktueller Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Schlankheitsideals über verschiedene Epochen hinweg. Es analysiert den Wandel medizinischer Maßstäbe und des Idealbildes selbst, wobei die "90-60-90"-Maße als pathologisch dargestellt werden. Die historische Perspektive liefert den Kontext für das Verständnis des heutigen Drucks auf Frauen, dem Schlankheitsideal zu entsprechen.
3. Schönheitskult und Schlankheitswahn: Dieses Kapitel erörtert den Schönheitskult und Schlankheitswahn in unserer Gesellschaft. Es untersucht den Körper als Statussymbol, den Einfluss von Medien, Konsumkultur und den besonderen Druck auf Frauen. Die Rolle von Models und Frauenzeitschriften wird kritisch beleuchtet, wobei die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität sowie die Problematik der Selbstakzeptanz thematisiert werden.
4. Diäten als 'Einstiegsdroge': Dieses Kapitel befasst sich mit der weitverbreiteten Nutzung von Diäten und deren Gefahren. Es beschreibt den Teufelskreis der Abmagerungskuren und die damit verbundenen körperlichen Risiken. Ein Experiment zu Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten wird vorgestellt und diskutiert.
5. Essstörungen - Ein allgemeiner Überblick über Anorexie und Bulimie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Es beschreibt die Entwicklungsgeschichte, Diagnosekriterien, körperlichen und psychischen Folgen, Häufigkeit, Verbreitung und Heilungschancen beider Störungen. Die gesellschaftliche Thematisierung und die damit verbundenen Herausforderungen werden ebenfalls angesprochen.
6. Gesellschaftlich bedingte Einflussfaktoren auf Essstörungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die gesellschaftlichen Faktoren, die zu Essstörungen beitragen. Es untersucht das gesellschaftliche Körperideal, den Einfluss der Medien, die Herausforderungen für Frauen in verschiedenen Rollen und den problematischen Aspekt der "Pro-Ana"-Szene.
7. Eine sportbezogene Essstörung: Die Anorexia athletica: Dieses Kapitel widmet sich der Anorexia athletica als spezifische Essstörung im Leistungssport. Es vergleicht und kontrastiert sie mit der Anorexia nervosa, beleuchtet die Zusammenhänge zwischen exzessivem Sporttreiben und Essstörungen, und diskutiert die körperlichen und psychischen Folgen, Präventionsmaßnahmen und die Rolle von Trainer*innen und Medien.
8. Entstehungsfaktoren einer Anorexia athletica: Dieses Kapitel analysiert die Entstehungsfaktoren von Anorexia athletica, u.a. die Anforderungsprofile im Hochleistungssport, gewichtsreduktionsbedingte Notwendigkeiten in bestimmten Sportarten, den Druck durch Trainer*innen und Medien, sowie die übermäßige Kultivierung des Schlankheitsideals im Sport.
9. Thematisierung von Anorexia athletica in der Öffentlichkeit: Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der öffentlichen Thematisierung von Anorexia athletica im Leistungssport und diskutiert mögliche Präventionsmaßnahmen wie Änderungen der Wettkampfbedingungen.
Schlüsselwörter
Schlankheitsideal, Körperbild, Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Anorexia athletica, Medien, Konsumkultur, Leistungssport, Gesellschaftlicher Druck, Selbstakzeptanz, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Essstörungen im Kontext des gesellschaftlichen Schlankheitsideals
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Essstörungen, insbesondere Anorexie, Bulimie und Anorexia athletica, im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Schlankheitsideal. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung dieses Ideals, dem Einfluss von Medien und Konsumkultur sowie den spezifischen Herausforderungen im Leistungssport.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des weiblichen Körperbildes und des Schlankheitsideals, den Einfluss von Medien und Konsumkultur auf das Körperbild und Essstörungen, Anorexie und Bulimie (Ursachen, Symptome und Folgen), Anorexia athletica als sportbezogene Essstörung sowie gesellschaftliche und individuelle Faktoren, die zu Essstörungen beitragen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Kapitel zur öffentlichen Thematisierung von Anorexia athletica. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, von der historischen Entwicklung des Schlankheitsideals über die Rolle der Medien und Konsumkultur bis hin zu den spezifischen Herausforderungen im Leistungssport.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Kapitel?
Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung des Schlankheitsideals. Kapitel 3 untersucht den Einfluss von Schönheitskult und Konsumkultur. Kapitel 4 analysiert die Gefahren von Diäten. Kapitel 5 bietet einen Überblick über Anorexie und Bulimie. Kapitel 6 untersucht gesellschaftliche Einflussfaktoren auf Essstörungen. Kapitel 7 widmet sich der Anorexia athletica. Kapitel 8 analysiert die Entstehungsfaktoren von Anorexia athletica. Kapitel 9 beleuchtet die öffentliche Thematisierung von Anorexia athletica.
Welche Rolle spielen Medien und Konsumkultur?
Medien und Konsumkultur spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Körperbildes und der Entstehung von Essstörungen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von Frauenzeitschriften, Models und Werbung auf den Druck, dem Schlankheitsideal zu entsprechen.
Was ist Anorexia athletica?
Anorexia athletica ist eine sportbezogene Essstörung, die im Leistungssport auftritt. Sie ähnelt der Anorexia nervosa, hat aber auch spezifische Unterschiede. Die Arbeit untersucht die Ursachen, Folgen und Präventionsmaßnahmen dieser Störung.
Welche gesellschaftlichen Faktoren tragen zu Essstörungen bei?
Die Arbeit identifiziert verschiedene gesellschaftliche Faktoren, die zu Essstörungen beitragen, darunter das gesellschaftliche Körperideal, der Druck der Medien, die Rollen von Frauen in der Gesellschaft und die Pro-Ana-Szene.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlankheitsideal, Körperbild, Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Anorexia athletica, Medien, Konsumkultur, Leistungssport, Gesellschaftlicher Druck, Selbstakzeptanz, Prävention.
Wo finde ich weitere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und deren Unterpunkte. Die Kapitelzusammenfassungen liefern eine prägnante Beschreibung der behandelten Themen.
- Quote paper
- Veronika Rauchensteiner (Author), 2011, Essstörungen im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196826