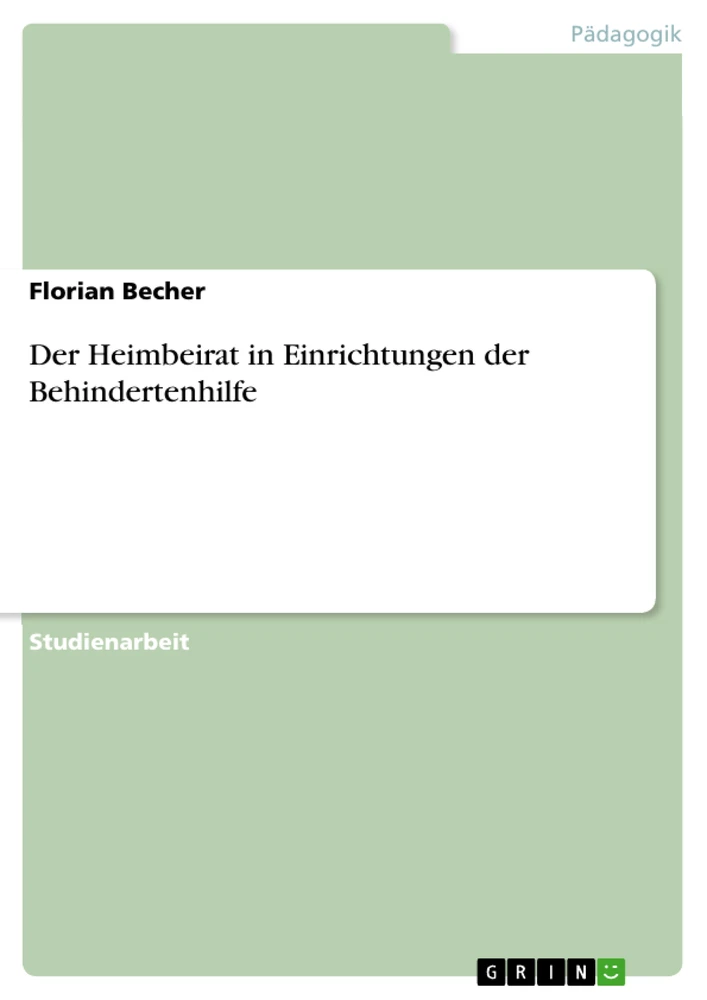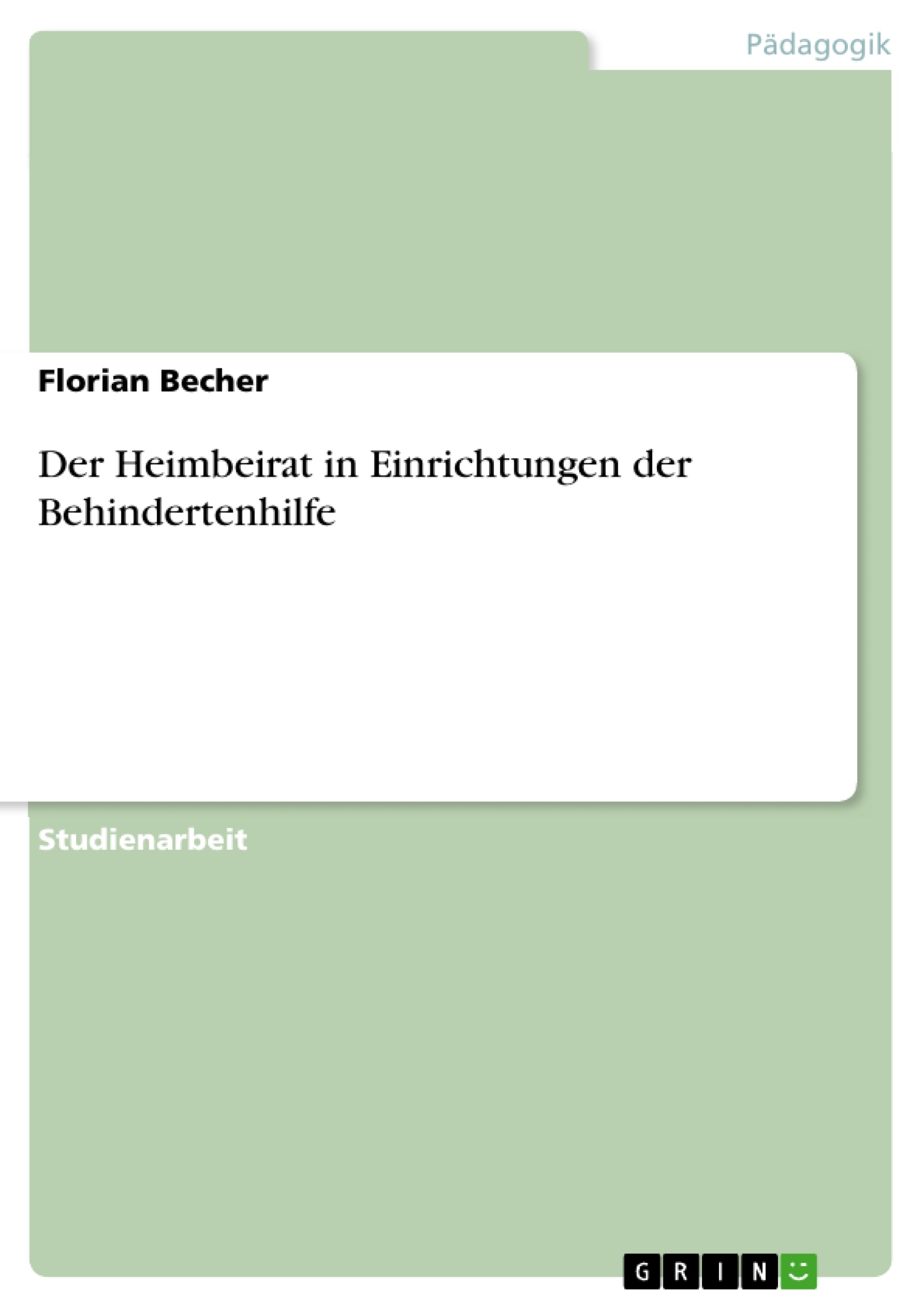„Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ ist ein Postulat der Bundesvereinigung Lebenshilfe aus dem Jahr 2003, mit welchem sie den Anspruch geistig behinderter Menschen auf mehr Teilhabe an der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. (Vgl. Schlummer/Schütte S.16) Im Rahmen dieser Arbeit wird überprüft, wie dieses „Mehr“ im Bereich von stationären Wohneinrichtungen aussehen kann. Diese Wohnform gilt als überholt. Seit Jahren wird eine Abkehr von den veralteten Heimkomplexen gefordert und über eine Auflösung aller Heime diskutiert. Die Zahl der Menschen mit geistiger Behinderung, die alleine privat oder im ambulant betreuten Wohnen leben, ist in Deutschland aber bisher noch sehr gering. Laut Theunissen waren 2005 ca. 78%, derer, die nicht mehr bei ihren Eltern oder Sorgeberechtigten lebten, in Großeinrichtungen mit 40 oder mehr Plätzen untergebracht (Vgl. Theunissen S.219) und dies obwohl es nicht dem Wunsch der BewohnerInnen entspricht. Lediglich 13% gaben bei einer Untersuchung von Rauscher (Heim-)Wohngruppen als Wunschwohnort an. Die Mehrheit bevorzugt es, ein eigenes Leben in der Gemeinde mit LebenspartnerIn/Familie zu führen. (Vgl. Rauscher S. 145ff.) Trotzdem leben höchstens 10% im ambulant betreuten Wohnen. Deutschland liegt somit im Vergleich zu anderen westlichen Industrienationen weit zurück. (Vgl. Theunissen S. 219) Der wesentliche Grund hierfür liegt an dem fehlenden finanziellen Anreiz zum Umstieg vom stationären zum ambulant betreuten Wohnen. Während in stationären Wohnformen zumindest Vollverpflegung ein kleines Taschengeld und ein Bonus aus der Werkstattarbeit garantiert sind, leben Menschen im ambulant betreuten Wohnen am Existenzminimum.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen
- Die gesetzliche Grundlage bis 2003
- Die Mitwirkung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
- Der Heimbeirat
- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Heimbeirates
- Unterstützung des Heimbeirates
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Teilhabe geistig behinderter Menschen am Leben in stationären Wohneinrichtungen. Sie beleuchtet die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Rolle des Heimbeirats als Instrument der Selbstbestimmung. Im Fokus steht der Vergleich der aktuellen Situation mit den Zuständen vergangener Jahrzehnte, um Chancen und Herausforderungen der Veränderung aufzuzeigen.
- Gesetzliche Entwicklung der Mitwirkung in Einrichtungen der Behindertenhilfe
- Die Rolle des Heimbeirats und seiner Aufgaben
- Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung für Bewohner
- Vergleich zwischen der aktuellen Situation und den Zuständen der 1970er Jahre
- Finanzielle Anreize und ihre Auswirkungen auf Wohnformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Postulat der Bundesvereinigung Lebenshilfe „Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ vor und verortet die Arbeit im Kontext der Diskussion um alternative Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie verweist auf die weiterhin hohe Zahl von Menschen mit geistiger Behinderung in großen stationären Einrichtungen und den Wunsch nach selbstbestimmtem Wohnen in der Gemeinde. Der Mangel an finanziellen Anreizen für ambulant betreutes Wohnen wird als Hauptgrund für die geringe Verbreitung dieser Wohnform genannt. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Mitwirkung von Bewohnern in stationären Einrichtungen und deren Bedeutung für ein selbstbestimmtes Leben.
Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Mitwirkung von Bewohnern in Heimen, beginnend mit dem Heimgesetz von 1974. Es wird deutlich, dass das Gesetz, trotz der formalen Festlegung der Mitwirkung, in der Praxis wenig Wirkung zeigte. Dies wird auf fehlendes Vertrauen und Schwächen des Gesetzes selbst zurückgeführt. Es mangelte an klaren Aussagen über Wahl und Befugnisse des Heimbeirats sowie an Unterstützungsmöglichkeiten. Der Vergleich mit dem Heimgesetz von 1997 und den Änderungen von 2001 verdeutlicht die schrittweise Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen, wobei der Fokus erst in den 2000ern eine stärkere Betonung auf die Förderung und Selbstbestimmung der Bewohner bekam.
Schlüsselwörter
Heimbeirat, Behindertenhilfe, Selbstbestimmung, Partizipation, stationäres Wohnen, ambulant betreutes Wohnen, Mitwirkung, gesetzliche Rahmenbedingungen, geistige Behinderung, Selbstverantwortung, Wohnformen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mitwirkung geistig behinderter Menschen in stationären Wohneinrichtungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Teilhabe geistig behinderter Menschen am Leben in stationären Wohneinrichtungen. Sie beleuchtet die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Rolle des Heimbeirats als Instrument der Selbstbestimmung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der aktuellen Situation mit der Vergangenheit, um Chancen und Herausforderungen der Veränderung aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzliche Entwicklung der Mitwirkung in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die Rolle des Heimbeirats und seiner Aufgaben, Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung für Bewohner, einen Vergleich zwischen der aktuellen Situation und den Zuständen der 1970er Jahre sowie die Auswirkungen finanzieller Anreize auf Wohnformen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Rahmenbedingungen (inkl. der gesetzlichen Grundlage bis 2003), ein Kapitel zur Mitwirkung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe (inkl. Heimbeirat, dessen Aufgaben, Rechten und Pflichten sowie Unterstützungsmöglichkeiten) und ein Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten der Mitwirkung geistig behinderter Menschen in stationären Einrichtungen zu untersuchen und deren Bedeutung für ein selbstbestimmtes Leben zu beleuchten. Sie analysiert die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Rolle des Heimbeirats in diesem Kontext.
Welche Rolle spielt der Heimbeirat?
Der Heimbeirat spielt eine zentrale Rolle als Instrument der Selbstbestimmung für Bewohner in stationären Einrichtungen. Die Arbeit analysiert dessen Aufgaben, Rechte und Pflichten sowie die Notwendigkeit von Unterstützungsmöglichkeiten. Es wird untersucht, wie effektiv der Heimbeirat in der Vergangenheit und Gegenwart die Interessen der Bewohner vertreten konnte.
Wie haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen entwickelt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen der Mitwirkung von Bewohnern in Heimen von 1974 bis 2003. Es wird gezeigt, wie sich die gesetzlichen Bestimmungen im Laufe der Zeit verbessert haben, mit einem zunehmenden Fokus auf die Förderung und Selbstbestimmung der Bewohner in den 2000er Jahren.
Welche Herausforderungen und Chancen bestehen für die Selbstbestimmung?
Die Arbeit identifiziert Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung für Bewohner von stationären Einrichtungen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen der aktuellen Situation und den Zuständen vergangener Jahrzehnte, um den Fortschritt und die verbleibenden Herausforderungen aufzuzeigen. Der Mangel an finanziellen Anreizen für ambulant betreutes Wohnen wird als Hemmnis für selbstbestimmtes Wohnen genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimbeirat, Behindertenhilfe, Selbstbestimmung, Partizipation, stationäres Wohnen, ambulant betreutes Wohnen, Mitwirkung, gesetzliche Rahmenbedingungen, geistige Behinderung, Selbstverantwortung, Wohnformen.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt das Postulat der Bundesvereinigung Lebenshilfe „Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ vor und verortet die Arbeit im Kontext der Diskussion um alternative Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie verweist auf die weiterhin hohe Zahl von Menschen mit geistiger Behinderung in großen stationären Einrichtungen und den Wunsch nach selbstbestimmtem Wohnen in der Gemeinde. Der Mangel an finanziellen Anreizen für ambulant betreutes Wohnen wird als Hauptgrund für die geringe Verbreitung dieser Wohnform genannt. Die Einleitung führt in die Thematik der Mitwirkung von Bewohnern ein und deren Bedeutung für ein selbstbestimmtes Leben.
Wie wird das Kapitel "Rahmenbedingungen" beschrieben?
Das Kapitel "Rahmenbedingungen" beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Mitwirkung von Bewohnern in Heimen, beginnend mit dem Heimgesetz von 1974. Es zeigt, dass das Gesetz trotz formaler Festlegung der Mitwirkung in der Praxis wenig Wirkung zeigte, was auf fehlendes Vertrauen und Schwächen des Gesetzes zurückgeführt wird. Der Vergleich mit dem Heimgesetz von 1997 und den Änderungen von 2001 verdeutlicht die schrittweise Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen, wobei der Fokus erst in den 2000ern eine stärkere Betonung auf die Förderung und Selbstbestimmung der Bewohner erhielt.
- Quote paper
- Florian Becher (Author), 2011, Der Heimbeirat in Einrichtungen der Behindertenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196595