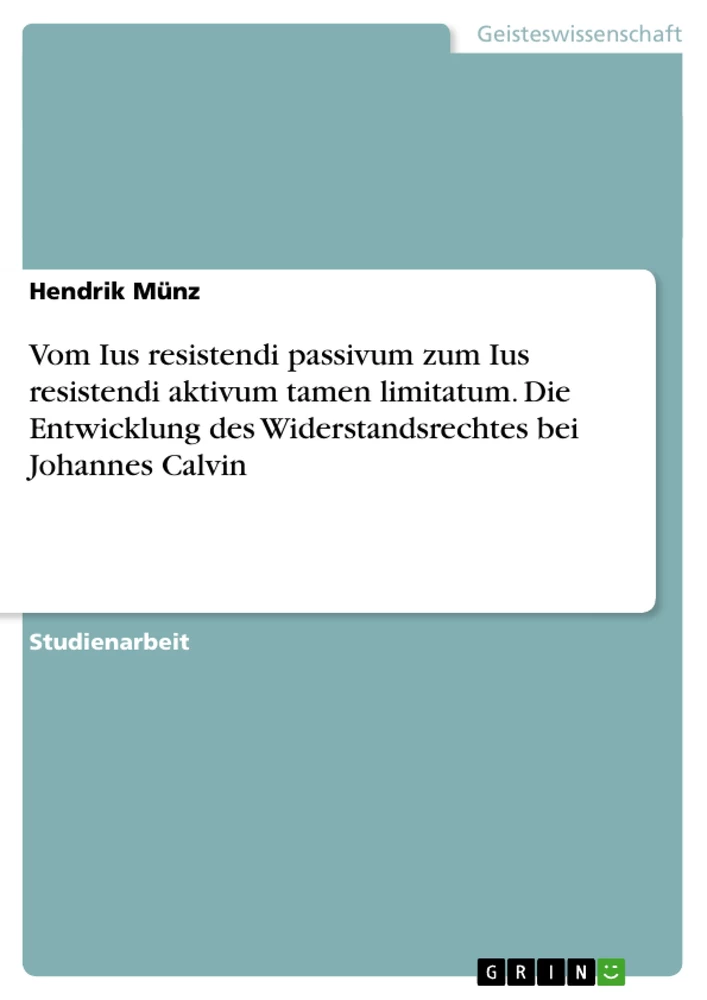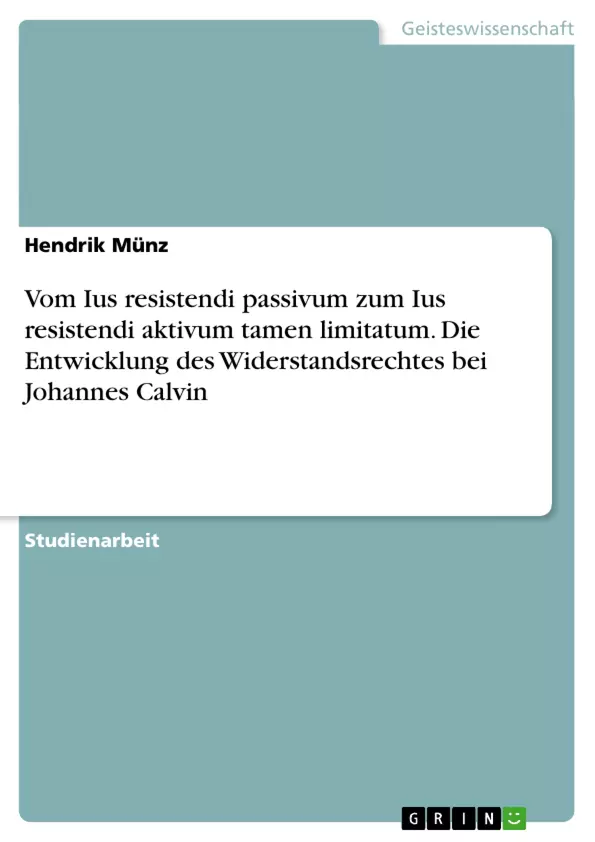Die Frage, ob man der Obrigkeit uneingeschränkt zu gehorchen hat oder ihr unter bestimmten Bedingungen den Gehorsam verweigern kann oder es gar Situationen gibt, in denen man sich gegen sie aktiv zur Wehr setzen muss, ist schon für die Reformatoren und ihre Zeitgenossen von elementarer Bedeutung. Jedoch gab es außer dem althergebrachten Recht und einigen philosophischen Lösungsvorschlägen seinerzeit keine Möglichkeit der Orientierung. Daher galt es, Lösungsansätze zu entwickeln, denn ein schlichter Verzicht auf Widerstand würde die Reformation womöglich im Keim ersticken, da Dekrete oder Inhaftierungen konkrete Maßnahmen zur praktischen Umsetzung reformatorischer Ansätze verhindern konnten.
Es darf aber auch nicht übersehen werden, welche Bedeutung dem Widerstandsrecht bis in die Gegenwart zukommt. Der „Kirchenkampf“ ist sicherlich die prominenteste Phase der neueren Geschichte, in der diese Frage zu bedenken war. Darüber hinaus ist das Thema nach wie vor aktuell: Handelt es sich bei der Verweigerung des Wehrdienstes aus religiösen Motiven nicht letztendlich auch um eine Art des Widerstandes gegen die Obrigkeit? Müssen politische Beschlüsse befolgt werden, nur weil die parlamentarische Mehrheit sie für richtig hält – oder darf man sich aus Gewissensgründen weigern, an ihrer Durchführung mitzuwirken? Als ich diese Arbeit verfasste, wies mich etwa die Diskussion um den Einmarsch nach Afghanistan und die Beteiligung der Bundeswehr auf die Relevanz dieser Fragen. Wie weit reichen die Pflichten der Untertanen gegenüber der Obrigkeit, wie steht es mit den Pflichten gegenüber dem Gewissen oder gar gegenüber Gott?
Bei Johannes Calvin handelt es sich um den prominentesten Vertreter der zweiten Reformatorengeneration. Der Calvinismus erfreut sich auch heutzutage noch einer weiten Verbreitung. Aus diesem Grunde ist es wichtig, in Debatten um die Widerstandsfrage auch die Lehre des Genfer Reformators einzubringen.
Da das Thema Widerstandsrecht zur Staatsvorstellung gehört und in der Praxis erst dann zur Anwendung kommt, wenn Staat und Herrscher nicht mehr dem in der Theorie gezeichneten Idealbild entsprechen, ist es erforderlich, sich auch mit den dem Widerstandsrecht zugrundeliegenden Staatsrechtsvorstellungen auseinander zu setzen. Diese Arbeit soll daher mit einem Abriss über Calvins Vorstellungen vom Staat beginnen. Ist dem Leser so Calvins Verständnis von Staat und Herrschaft vor Augen, folgt der Hauptteil, der sich mit dem Widerstandsrecht befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Erwartungen
- Quellen
- Forschungsüberblick
- Einführung in Calvins Herrschaftsverständnis
- Die von Gott gegebene weltliche Herrschaft
- Die Pflichten des weltlichen Herrschers gegenüber Gott und seinen Untertanen
- Die Pflichten der Untertanen gegenüber der Obrigkeit
- Die Ephoren - das aristokratische Regulativ zur Verhinderung der Tyrannei
- Das Widerstandsrecht bei Calvin
- Gegen ein aktives Widerstandsrecht für jedermann - Aktiver Widerstand nur in eingeschränkter Form
- Privatpersonen untereinander: Widerstand gegen das Böse unter Verzicht auf Vergeltung
- Privatperson - Obrigkeit: Allenfalls passiver Widerstand
- Legitime Formen des Widerstandes
- Die Rächer - Von Gott auserwählte und beauftragte Menschen
- Die Ephoren - als aristokratische Korrektivinstanz zum Widerstand verpflichtet
- Die Wende beim späten Calvin - Tendenzen zu einem aktiven Widerstandsrecht auch für Privatpersonen
- Die Dominanz des petrinischen Prinzips in früheren Schriften
- Die Radikalisierung des petrinischen Prinzips in späteren Schriften
- Spitzen, die an einer prinzipiellen Ablehnung eines aktiven Widerstandsrechts zweifeln lassen
- Calvin und die Verschwörung von Amboise
- Calvins Herrschaftsverständnis und seine Lehre von der weltlichen Obrigkeit
- Die Entwicklung von Calvins Widerstandsrecht von einem passiven zum begrenzten aktiven Widerstand
- Die Rolle der Ephoren als aristokratisches Korrektiv zur Verhinderung von Tyrannei
- Der Einfluss der politischen Ereignisse, wie z.B. die Verschwörung von Amboise, auf Calvins Positionen zum Widerstand
- Die Bedeutung des petrinischen Prinzips in Calvins Lehre vom Widerstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Widerstandsrechts bei Johannes Calvin im Kontext seines Herrschaftsverständnisses. Sie analysiert, wie sich Calvins Positionen zum Widerstand gegen die Obrigkeit im Laufe seiner Schriften und im Kontext der politischen Ereignisse seiner Zeit entwickelten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit vor, beleuchtet die Relevanz des Themas und gibt einen Überblick über die Quellen und die bisherige Forschungsliteratur. Kapitel 2 führt in Calvins Herrschaftsverständnis ein und analysiert die Pflichten von Herrscher und Untertanen. Kapitel 3 widmet sich Calvins Widerstandsrecht. Hier werden die Argumente gegen ein uneingeschränktes aktives Widerstandsrecht sowie die legitimen Formen des Widerstandes diskutiert. Es werden auch die Veränderungen in Calvins Positionen im Laufe seiner Schriften und im Kontext der politischen Ereignisse beleuchtet.
Schlüsselwörter
Johannes Calvin, Widerstandsrecht, Herrschaftsverständnis, Reformation, petrinisches Prinzip, Ephoren, Tyrannei, Verschwörung von Amboise, Ius resistendi passivum, Ius resistendi aktivum tamen limitatum.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich Calvins Ansicht zum Widerstandsrecht?
Calvins Position wandelte sich von einer ursprünglichen Ablehnung aktiven Widerstands (passiver Gehorsam) hin zu einer eingeschränkten Befürwortung aktiven Widerstands in seinen späteren Schriften.
Wer sind die "Ephoren" in Calvins Staatslehre?
Die Ephoren sind ein aristokratisches Korrektiv (untergeordnete Behörden), die die Pflicht haben, dem Machtmissbrauch eines Tyrannen entgegenzutreten und das Volk zu schützen.
Was besagt das "petrinische Prinzip" bei Calvin?
Es basiert auf dem biblischen Grundsatz "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen", was die Grundlage für Gehorsamsverweigerung gegenüber gottlosen Befehlen der Obrigkeit bildet.
Dürfen Privatpersonen laut Calvin aktiv Widerstand leisten?
In seinen frühen Werken lehnte er dies strikt ab. Später deutete er an, dass in extremen Fällen von Tyrannei auch für Privatpersonen ein Recht auf Widerstand bestehen könnte, wenn Gott "Rächer" beruft.
Was war die Verschwörung von Amboise und welche Rolle spielte sie?
Die Verschwörung war ein politisches Ereignis, das Calvins Denken über den Widerstand gegen eine tyrannische Herrschaft in Frankreich beeinflusste und zu einer Radikalisierung seiner Positionen beitrug.
- Quote paper
- Hendrik Münz (Author), 2003, Vom Ius resistendi passivum zum Ius resistendi aktivum tamen limitatum. Die Entwicklung des Widerstandsrechtes bei Johannes Calvin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19637