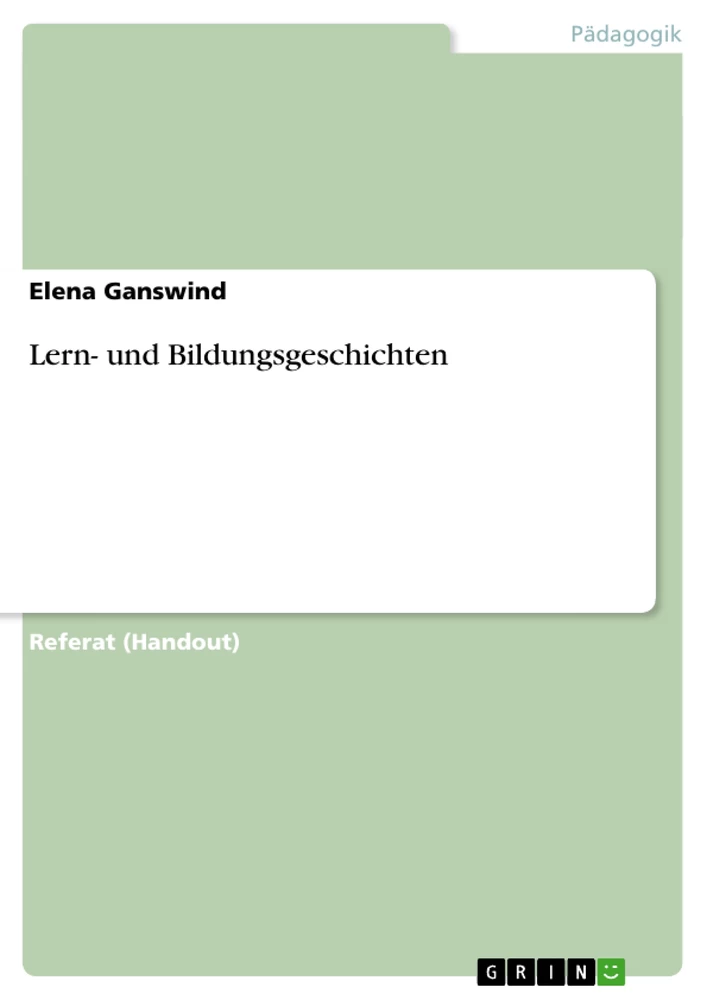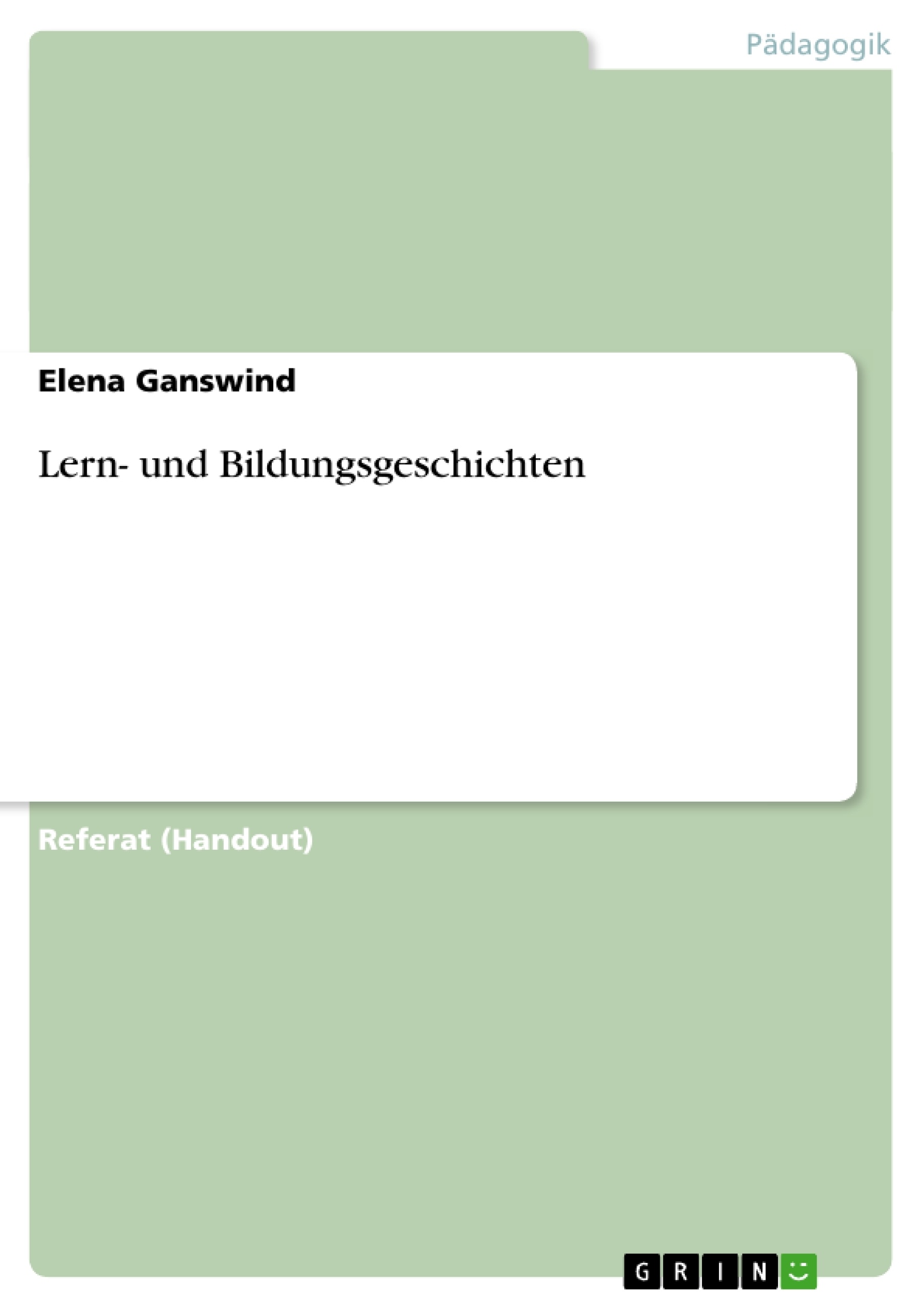Das Verfahren der „Lern- und Bildungsgeschichten“ wurde ursprünglich unter dem Namen „learning stories“ von Margaret Carr Ende der 1990er Jahre in Neuseeland entwickelt. Ihr Ziel war es ein adäquates Verfahren für die Beobachtung und Beschreibung von Lernerfolgen in der Alltagspraxis zu finden. Dabei standen die individuellen Lernprozesse der Kinder im Vordergrund, um das Verständnis für Bildungs- und Lernwege der Kinder zu fördern.
Mit „Lern- und Bildungsgeschichten“ meinte M. Carr auch ursprünglich schon Erzählungen und Geschichten vom Lernen eines Kindes, das man zuvor beobachtet hat. Die anschließende Beschreibung dient dann zum Festhalten von Handlungen der Kinder in bestimmten Situationen und den Aspekten, die der/die ErzieherIn davon wahrgenommen hat.
Diese beschriebenen „Momentaufnahmen“ aus dem Leben der jeweiligen Kinder erzählen etwas über die Bildungsinteressen und Bildungswege des beobachteten Kindes zu dieser Zeit.1
[...]
1 Nach Leu, H.R., Flämig.K., Frankenstein, Y., Koch, S., Pack, i., Schneider, K. & Schweiger, M. (2007).Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Mit 1DVD und 1CD-ROM. Berlin: verlag das Netz Nach http://www.dij.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=320&Jump1=LINKS&Jump2=5,vom 18.Mai 09
um 10:11 Uhr
INHALTSVERZEICHNIS
1. Ursprung der Methode
2. Gegenstand der Beobachtung
3. Kern der Methode
4. Kriterien des Verfahrens
5. Die einzelnen Schritte des Verfahrens
Quellenangaben
Link
1. Ursprung der Methode
Das Verfahren der „Lern- und Bildungsgeschichten“ wurde ursprünglich unter dem Namen „learning stories“ von Margaret Carr Ende der 1990er Jahre in Neuseeland entwickelt. Ihr Ziel war es ein adäquates Verfahren für die Beobachtung und Beschreibung von Lerner- folgen in der Alltagspraxis zu finden. Dabei standen die individuellen Lernprozesse der Kinder im Vordergrund, um das Verständnis für Bildungs- und Lernwege der Kinder zu för- dern.
Mit „Lern- und Bildungsgeschichten“ meinte M. Carr auch ursprünglich schon Erzählungen und Geschichten vom Lernen eines Kindes, das man zuvor beobachtet hat. Die anschlie- ßende Beschreibung dient dann zum Festhalten von Handlungen der Kinder in bestimm- ten Situationen und den Aspekten, die der/die ErzieherIn davon wahrgenommen hat. Diese beschriebenen „Momentaufnahmen“ aus dem Leben der jeweiligen Kinder erzählen etwas über die Bildungsinteressen und Bildungswege des beobachteten Kindes zu dieser Zeit.1
2. Gegenstand der Beobachtung
Dabei war wichtig sich von dem zu häufig benutzten Defizitblick zu entfernen und zu erkennen, wo sich die Kinder in dem Lern- und Bildungsprozessen befinden. Somit wird nicht die Frage nach der Existenz der tatsächlichen Fertigkeiten gefragt, die in dem jewei- ligen Alter beherrscht werden sollten. Viel mehr sollte man versuchen den Fokus auf die vorhandenen Fertigkeiten zu legen und die Kompetenzen und Fähigkeiten zu erfassen. Zu erfassen sind mit dieser Methode sowohl der Kontext der kindlichen Handlungen als auch die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen. Mit Hilfe dieser Methode soll es den pädagogischen Fachkräften möglich sein, sich untereinander sowie mit den jeweiligen Kindern und ihren Eltern auszutauschen. Zudem möchte man damit ein besseres Verständnis für Stärken und Schwächen der Kinder erreichen und die Lernprozesse fördern.2
3. Kern der Methode
Als Grundlage für ihre Methode hat sich M. Carr auf die sogenannten „Lerndispositionen“ bezogen. Unter diesen versteht sie den Fundus oder das Repertoire an Lernstrategien und Motivation, womit ein lernender Mensch Lerngelegenheiten wahrnimmt, sie erkennt, auswählt, beantwortet oder sogar herstellt und den er aufgrund seiner Lernbemühungen stets erweitert.
Zum Ausdruck kommt darin die Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Anforderungen und Situationen auseinander zu setzten und sie mitzugestalten. Diese „Lerndispositionen“ sind nicht nur Voraussetzungen für Lern- und Bildungsgeschichten, sondern auch das Fundament für lebenslanges Lernen. Für ihre Methode macht sie fünf solcher Lerndisposi- tionen aus, denen sie essentielle Rolle zuschreibt. So benennt sie diese wie folgt:
- interessiert sein
- engagiert sein
- standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten
- sich ausdrücken und mitteilen
- an der Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen3
4. Kriterien des Verfahrens
Selbstverständlich gibt es für die erfolgreiche Durchführung dieses Verfahrens einige Kriterien. Da wäre zunächst einfache Formulierung der Sätze, sodass die beobachteten Aspekte auch im Dialog mit den Kinder verständlich sind.
Zudem muss man dabei das Wiedergeben von Situationen beherrschen, wenn möglich auch die Wörtliche rede anwenden können. Desweiteren sollte man die Beobachtungen stets auf die Lerndispositionen beziehen, d.h. Fortwährend nach den fünf genannten Aspekten analysieren und benennen können, woran sich diese erkennen lassen.
[...]
1 Nach Leu, H.R., Flämig.K., Frankenstein, Y., Koch, S., Pack, i., Schneider, K. & Schweiger, M. (2007).Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Mit 1DVD und 1CD-ROM. Berlin: verlag das Netz Nach http://www.dij.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=320&Jump1=LINKS&Jump2=5,vom 18.Mai 09 um 10:11 Uhr
2 Nach Leu, H.R., Flämig.K., Frankenstein, Y., Koch, S., Pack, i., Schneider, K. & Schweiger, M. (2007).Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Mit 1DVD und 1CD-ROM. Berlin: verlag das Netz Nach http://www.dij.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=320&Jump1=LINKS&Jump2=5,vom 18.Mai 09 um 10:11 Uhr
3 Nach ebg. 4
- Quote paper
- Elena Ganswind (Author), 2009, Lern- und Bildungsgeschichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196198