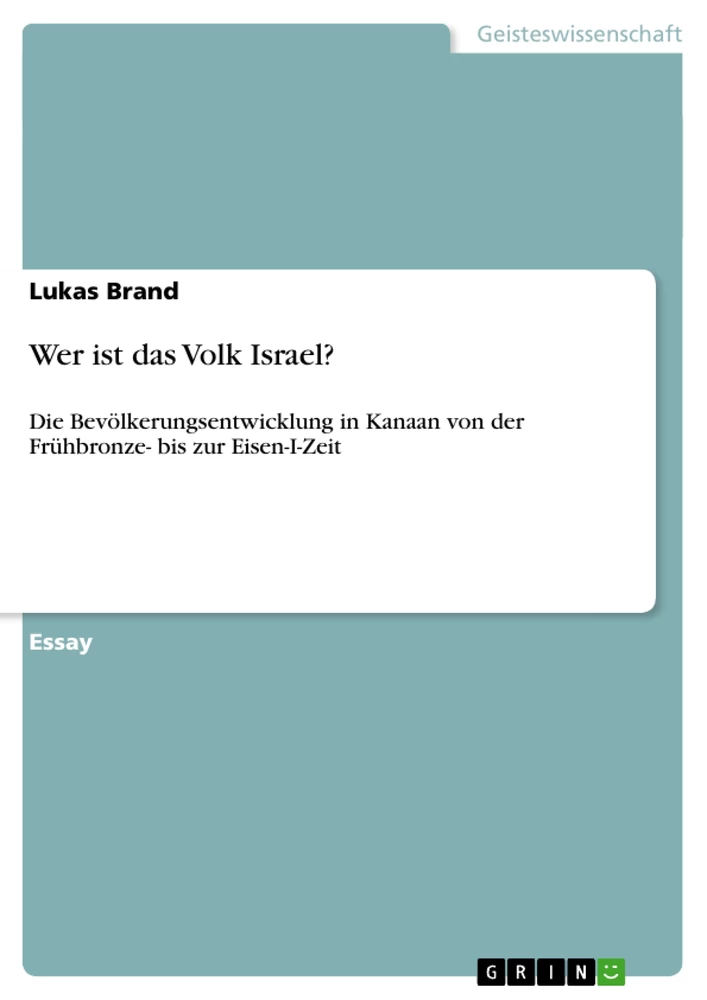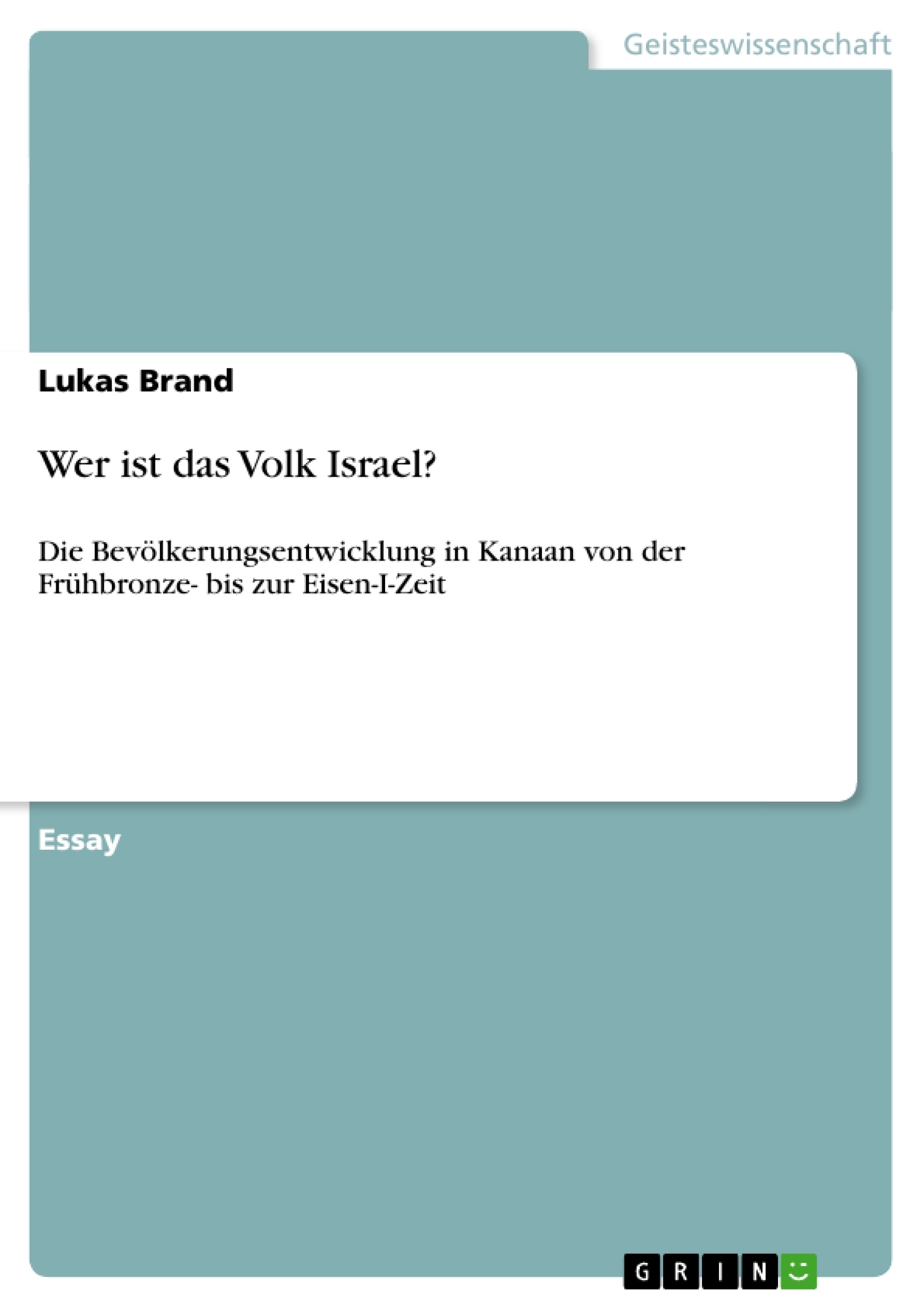Die Arbeit gibt einen kurzen aber detailierten Überblick über die Stadtentwicklung und die Machtverhältnisse im Raum Syrien-Palästina von der Frühbronze- bis zur Eisen-I-Zeit. Ziel ist die Entstehung des Staates Israels vorzuzeichnen und in dessen Vorgeschichte einzuordnen. Dabei wird die Kontinuität der Geschichte in der Staatsgründung Israels im Verlaufe der allgemeinen kulturellen und ethnologischen Entwicklungsgeschichte herausgestellt. Die Entstehung des Staates Israel ist kein Bruch in der Geschichte, sondern geht aus den Prozessen hervor, die sich aus den Verhältnissen im Raum des Fruchtbaren Halbmondes ergeben mussten.
1. Fachsemester Magister Theologiae
Das vorliegende Essay beschäftigt sich mit der Bevölkerungsentwicklung im Raum SyrienPalästina von der Frühbronzezeit, bis zu den Anfängen der Eisen-I-Zeit. Dabei soll eine Alternative zu den gängigen Landnahmemodellen besonders von Mendenhall und Finkelstein vorgestellt werden. Dieser Alternative liegt die Idee zugrunde, dass die Entstehung Israels kein Ergebnis eines einmaligen, sondern lediglich einen Ausschnitt eines wiederkehrenden Prozesses darstellt. Die Bevölkerung sowie das gesellschaftliche Gefüge im Raum des späteren Israels mäandrieren im Grad ihrer kulturellen Ausprägung.
Mäander-Modell Bei der Entstehung Israels handelt es sich nicht um eine Revolution und nur sehr bedingt um eine kulturelle Evolution. Vielmehr ist die Entstehung Israels Teil eines wiederkehrenden Prozesses im Raum zwischen verschiedenen Großmächten. Dabei wechseln sich die Prozesse der Urbanisierung und der Deurbanisierung beziehungsweise Ruralisierung ab. Bedingt wird dieser Wechsel durch das Aufblühen und Niedergehen der Großmächte im Umfeld des Raumes Palästina-Syrien, vor allem Ägyptens und den verschiedenen Großreichen in Mesopotamien und Kleinasien. Mit der Stadtentwicklung ist die Entwicklung der Bevölkerung eng verbunden: Diese ist abwechselnd dem Prozess der Tribalisierung, beziehungsweise Retribalisierung und der zunehmenden Stratifizierung ausgesetzt. Segmentäre Stammesgesellschaften entstehen und werden im Laufe der Zeit durch stratifizierte, städtisch organisierte Gesellschaften abgelöst, wie sie zum Beispiel in Ebla oder in den Handelszentren der Mittelbronzezeit (MB-Zeit) vorhanden waren.
Die Nähe zu den Handelsruten zwischen den Großreichen ist ein entscheidender Fak- tor für die Entstehung der Stadtstaaten im Raum Palästina-Syrien. Aleppo, Qatna und Hazor sind die besten Beispiele. Sie entstehen als Macht und Handelszentren und fallen als solche im Laufe der MB-Zeit unter die Herrschaft der Großmächte, namentlich Ägyp- tens. Unter dem Einfluss der Großmächte werden die Handelszentren zur Peripherie der Großstaaten und verlieren so zunehmend an überlebenswichtiger Eigenständigkeit (vgl. Lemche S.127). Mit der Auflösung des Einflusses von Ägypten und dem Verschwinden der Handelsbeziehung unter den Großmächten schwinden auch die Existenzgrundlagen der Stadtstaaten im Raum Palästina-Syrien. Die Städte lösen sich auf und bilden mit den Nomaden der MB-Zeit um 1200 v.Chr. die Bevölkerung der neuen Dörfer und Siedlun- gen. Israel entwickelt sich im Machtvakuum, das die Großmächte zurücklassen. An die Entstehung des Staates Israels in diesem Machtvakuum lässt sich die biblische Erzählung der Landnahme anschließen: Das Bewusstsein ”Israel” zu sein, gewinnt in diesem Raum die Vormachtstellung und setzt sich gegenüber der alten Identität Kanaans durch. Im Anschluss fällt der Raum Syrien-Palästina mit dem Staat Israel in die Hände der neuen Großmächte Ägypten, Babylon und Assyrien.
Es soll nun folgende These aufgestellt werden: Die Siedler der Eisen-I-Zeit sind zum einen Teil ehemalige Nomaden, die aus der früh-mittelbronzezeitlichen Stadtkultur (Ebla-Ära) stammen, und in einer Übergangszeit ein nicht-sesshaftes Bevölkerungselement bildeten: Sie sind die Hapiru, die Stadtflüchtlinge nach dem Untergang der frühbronzezeitlichen Hochkultur und den Unruhen der MB-Zeit oder die Schasu-Nomaden. Zum andern Teil sind die Sieder der Eisen-I-Zeit die Städter aus der in der Spätbronzezeit (SB-Zeit) unter- gehenden Stadtkultur Kanaans. Nur so erklärt sich die Kontinuität zwischen den Kulturen der SB-Zeit und der Eisen-I-Zeit. Der Prozess der Ruralisierung vollzieht sich also in der gesamten SB-Zeit ab 1550 v.Chr. und explodiert mit dem endgültigen Untergang der Stadtkultur.
Der Prozess, der dieser Situation vorausgeht, soll nun in einzelnen Schritten verdeutlicht werden.
Unter den günstigen klimatischen Bedingungen während des Neolithikums kam es zur Tri- balisierung: Die egalitäre Bevölkerung des fruchtbaren Halbmondes wurde in einer zuneh- menden Zahl von Dörfern sesshaft, begann sich in Stämmen zu organisieren und Handel zu treiben. In der aufkommenden Dürre des Chalkolthikums schlossen sich die Dorfge- meinschaften in den Handelszentren zu Städten zusammen um ihr Überleben zu sichern. Die Entwicklung von einer segmentären zu einer stratifizierten Gesellschaft begünstigte diesen Wandel.
Frühbronzezeit 3200-2300 v.Chr. In der Frühbronzezeit erreicht dieser Wandel seinen Höhepunkt. Im Raum Palästina-Syrien entstehen große Stadtstaaten. Lemche nennt die Handelsbeziehungen zu anderen Reichen einen wesentlichen Faktor für diese Entwicklung.
Für den Raum Palästina ist Arad ein gutes Beispiel: es steht bereits mit den ersten Dynastien des alten ägyptischen Reiches im Handel. Das zeigt der Fund von Keramik in Tel Arad, die den Namen des Pharaos Narmer trägt. Für Syrien ist die amurritische Stadt Ebla das Beispiel eines blühenden Handelszentrums, am Ende der FB-Zeit. Als während der ersten Zwischenzeit in Ägypten (2250-2150 v.Chr.) die Handelsbezie- hungen mit dem Nachbarn ausfallen, verfallen auch die Handelszentren im Raum Palästi- na. Das Mesopotamische Reich wird durch die Akkader vernichtet, denen auch die Stadt Ebla zum Opfer fällt. Das Akkaderreich zerbricht kurz darauf und hinterlässt ein Macht- vakuum. Es folgt eine nichturbane Zwischenzeit (vgl. Fritz S.66 und Frevel S.710). Ohne die Handelspartner fehlt den Staaten im Raum Palästina nun die Überlebensgrundlage. Die Stadtbewohner der FB-Zeit verlassen die Städte, können aber nicht einfach in dörfi- sche Strukturen zurückkehren, da sich das umgebende Land durch die Dürre zunehmend in Wüste wandelt. Es kommt zur Retribalisierung, die Stadtbewohner schließen sich mit nomadischen Bevölkerungselementen im syrisch-palästinischen Raum zusammen, die von der Stadtkultur bisher unberührt geblieben waren. Zusammen bilden sie eine Gesellschaft von Nomaden und Halbnomaden (vgl. Lemche S.116).
Mittelbronzezeit 2100-1550 v.Chr. Als sich das ägyptische Reich um 2000 v. Chr. wieder von seiner Krise erholt, kommt es im Raum Syrien-Palästina zu einer Teilung der Bevölkerung: In der Küstenebene und entlang der Handelswege werden die Nomaden wieder sesshaft. Sie füllen das Machtvakuum in zwei Phasen um 2000 bzw. 1800 v.Chr. erneut mit zentralen Handelsstädten aus. Folgende Städte erlangen dabei eine relative Bedeutung: (von Norden nach Süden) im Raum Syrien Aleppo und Qatna, im Raum Palästina Dan (mit einer Größe von 20ha) und Hazor (sogar 80ha), Megiddo und Jesreel in der Jesreelebene, Bet Schean, Pella im Ostjordanland, Sichem und Jerusalem im Bergland, Geser und Lachische in der Schefela und schließlich Aschkelon mit einigen weiteren in der Küstenebene; sie haben alle etwa eine Größe von 5ha. Das politische System der FB-Zeit wird fortgesetzt, als Machtzentren setzen sich aber im Wesentlichen neue Orte durch (vgl. Lemche S.118f, Frevel S.710f und Fritz S.66).
Die Nomaden des Berglandes hingegen machen diese Entwicklung kaum oder gar nicht durch. Sie bilden die nomadischen Bevölkerungselemente, die durch die Armanabriefe als Hapiru und Schasu bekannt sind.
Als Folge der Kulturblüte der kanaanäischen Stadtstaaten nimmt die Bevölkerung so stark zu, dass Teile der Bevölkerung die Entwicklung von Handelszentren nach dem Vorbild des palästinischen Kernlandes auch im Nildelta vorantreiben. Durch Einwanderer aus Palästina wird Avaris bis 1650 v.Chr. unter den später sogenannten Hyksos ein Handelszentrum und Stadtstaat mit weitreichendem Machteinfluss. Die Hyksos werden von den Ägyptern als Fremdherrscher wahrgenommen. Es kommt zu einer zweiten Zwischenzeit für Ägypten, die bis zum Beginn der SB-Zeit andauert.
Spätbronzezeit 1550-1200 v.Chr. Ägypten befreit sich unter Ahmose von den Fremd- herrschern und rückt seinerseits nach Asien vor. Die Fürsten der kanaanäischen Stadtstaa- ten werden so zu Vasallen des ägyptischen Neuen Reiches (ca. 1550-1070 v. Chr.). In dieser Zeit sind Ägypten, Mitanni, das Assur und Hatti abwechselnd oder zeitgleich Großmächte, welche die Machtverhältnisse bestimmen und ihren Einfluss auf die Stadtstaaten im Raum Syrien-Palästina ausüben. Hier spielen sich die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen diesen Großmächten maßgeblich ab.
Die Stadtstaaten der Provinz Kanaan entwickeln sich in der SB-Zeit von Handelszentren mehr und mehr zu Stationen des Handels in der Grenzregion zwischen den Großmächten. Sie verlieren wenn auch nicht an Bedeutung für die Großmächte, so doch an Eigenstän- digkeit. Die Verschiebung der Stadtstaaten vom Zentrum zur Peripherie wird ihnen zum Verhängnis.
Die Hegemonialmacht Ägypten ist zwar das verbindende Element in der Provinz, es herrscht aber kein ureigenes Gemeinschaftsgefühl „Kanaan zu sein“. Die relative, politische Eigenständigkeit der Stadtstaaten fördert eine Situation der Konkurrenz und Kooperation untereinander. Hinzu kommt die Bedrohung durch die Hapiru, die aus dem Bergland immer wieder Streifzüge in die Küstenebene unternehmen (vgl. Frevel S.713).
Die Stadtfürsten sind außerdem zwischen den Herrschern der Großreiche hin und her gerissen, wie sich an Berichten in der Armanakorrespondenz und anderen Aufzeichnungen belegen lässt. Der Einfluss der Großmächte auf die Vasallen ist stets unsicher und schwin- det im Laufe der Zeit zusehends. Die Untreue eines Vasallen wird mit einer Strafexpedition geahndet, die die Städte auf lange Sicht in Mitleidenschaft zieht. Beispiele dieser Feldzüge zur Stabilisierung des ägyptischen Einflusses auf die Provinz Kanaan sind die Schlacht gegen die Koalition des „elenden Feind[es] von Kadesch“ unter Thutmosis III. (1479-1425 v.Chr.) und der Feldzug, der durch die Stele, die Merenptah 1208 v.Chr. errichten lässt, belegt ist.
In der letzten Phase der SB-Zeit bricht das Reich Hatti unter dem Druck des wiedererstarkenden assyrischen Großreiches und der Bedrohung durch Stämme aus dem Norden zusammen. Ägypten wird zunehmend von Libyen her bedroht. Merenptah schlägt die Koalition der Libyer mit den Seevölkern zurück und unternimmt eine Expedition in die Provinz Kanaan. Hiervon zeugt die Merenptah-Stele. Allgemein lässt sich aber ein Rückgang des Machteinflusses auf das Gebiet Kanaan ablesen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Essay?
Das Essay beschäftigt sich mit der Bevölkerungsentwicklung im Raum Syrien-Palästina von der Frühbronzezeit bis zu den Anfängen der Eisen-I-Zeit. Es wird eine Alternative zu gängigen Landnahmemodellen vorgestellt, die besagt, dass die Entstehung Israels Teil eines wiederkehrenden Prozesses ist.
Was ist das "Mäander-Modell"?
Das Mäander-Modell besagt, dass die Entstehung Israels Teil eines wiederkehrenden Prozesses der Urbanisierung und Deurbanisierung (Ruralisierung) ist, bedingt durch das Aufblühen und Niedergehen von Großmächten wie Ägypten und Reichen in Mesopotamien und Kleinasien.
Welche Rolle spielen Handelsrouten bei der Entwicklung von Stadtstaaten?
Die Nähe zu Handelsrouten ist entscheidend für die Entstehung von Stadtstaaten im Raum Palästina-Syrien, wie beispielsweise Aleppo, Qatna und Hazor.
Wie erklärt sich der Übergang von der Spätbronzezeit zur Eisen-I-Zeit?
Die Siedler der Eisen-I-Zeit sind zum einen Teil ehemalige Nomaden (Hapiru, Schasu) aus der früh-mittelbronzezeitlichen Stadtkultur, und zum anderen Teil Städter aus der untergehenden Stadtkultur Kanaans. Dies erklärt die Kontinuität zwischen den Kulturen der SB-Zeit und der Eisen-I-Zeit.
Wie entwickelte sich die Gesellschaft im Neolithikum und Chalkolithikum?
Im Neolithikum kam es zur Tribalisierung, wobei die egalitäre Bevölkerung in Dörfern sesshaft wurde und sich in Stämmen organisierte. In der Dürre des Chalkolithikums schlossen sich die Dorfgemeinschaften in Handelszentren zu Städten zusammen.
Welche Beispiele für Handelszentren gibt es in der Frühbronzezeit?
Arad im Raum Palästina und Ebla in Syrien sind Beispiele für blühende Handelszentren in der Frühbronzezeit.
Was geschah mit den Stadtstaaten nach dem Ausfall der Handelsbeziehungen mit Ägypten?
Als die Handelsbeziehungen mit Ägypten ausfielen, verfielen auch die Handelszentren im Raum Palästina, und es kam zur Retribalisierung, wobei sich Stadtbewohner mit nomadischen Bevölkerungselementen zusammenschlossen.
Wie teilte sich die Bevölkerung in der Mittelbronzezeit?
In der Küstenebene und entlang der Handelswege wurden Nomaden wieder sesshaft und gründeten neue Handelsstädte. Im Bergland blieben die Nomadischen Bevölkerungselemente, die als Hapiru und Schasu bekannt sind, bestehen.
Welche Rolle spielten die Hyksos in Ägypten?
Einwanderer aus Palästina gründeten in Avaris ein Handelszentrum unter den Hyksos, das zu einem Stadtstaat mit weitreichendem Machteinfluss wurde.
Wie entwickelte sich die Provinz Kanaan in der Spätbronzezeit unter ägyptischer Herrschaft?
Die Stadtstaaten Kanaans wurden zu Vasallen des ägyptischen Neuen Reiches und entwickelten sich von Handelszentren mehr und mehr zu Stationen des Handels in der Grenzregion zwischen den Großmächten. Sie verloren an Eigenständigkeit.
Wer waren die Hapiru und welche Rolle spielten sie?
Die Hapiru waren nomadische Bevölkerungselemente, die aus dem Bergland Streifzüge in die Küstenebene unternahmen und eine Bedrohung für die Stadtstaaten darstellten.
Was ist die Merenptah-Stele und welche Bedeutung hat sie für die Geschichte Israels?
Die Merenptah-Stele belegt einen Feldzug des ägyptischen Pharaos Merenptah in Kanaan und erwähnt "Israel" als eine Größe zwischen Jenoam und Syrien. Sie deutet auf eine größere Gruppe Hapiru hin, die sich als Israel verstand.
- Quote paper
- Lukas Brand (Author), 2012, Wer ist das Volk Israel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196194