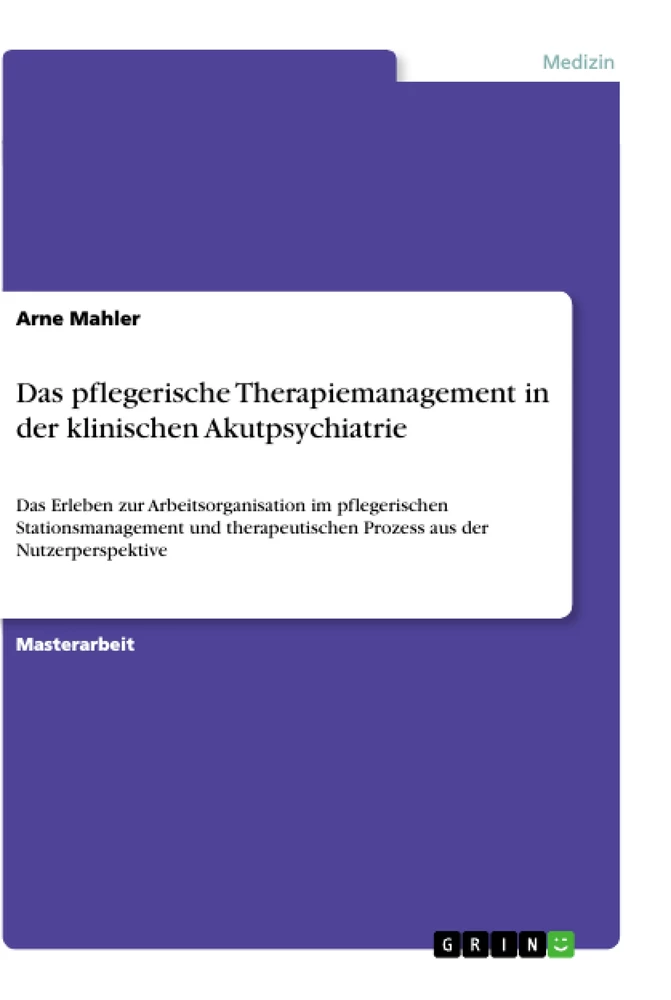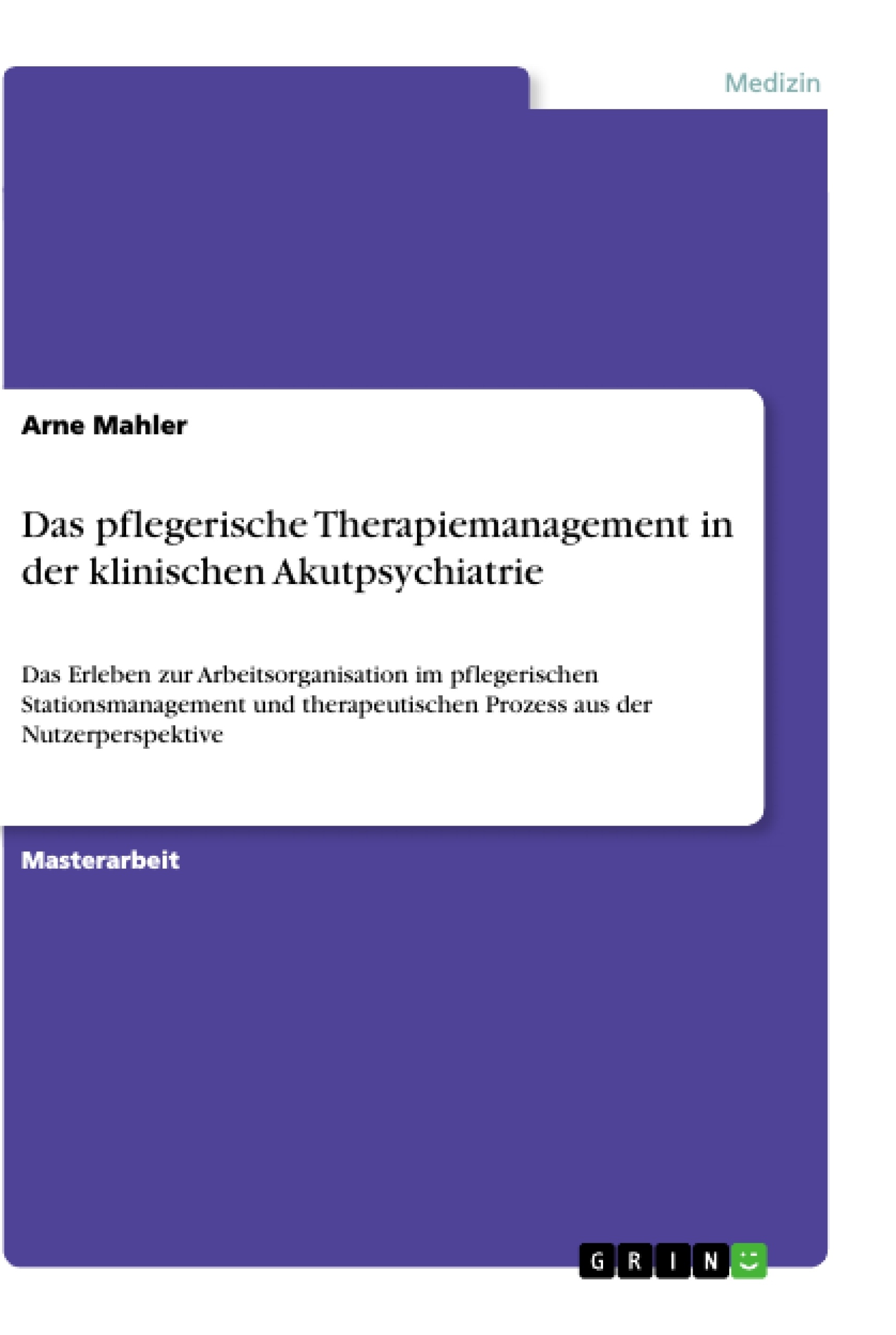In dieser Arbeit werden eine Untersuchung und deren Ergebnisse zur Nutzerperspektive bezüglich der therapiebezogenen Arbeitsorganisation bzw. dem pflegerischen Therapiemanagement in der Akutpsychiatrie beschrieben.
Es konnten insgesamt 18 Gesprächskontakte mit Betroffenen hergestellt werden, die sich jeweils zur Hälfte in Interviews und Kurzkontakte aufteilen. Die Auswertung erfolgt nach den Prinzipien der Grounded Theory.
Es zeigt sich, dass die Gesprächspartner und –partnerinnen viele positive Erlebnisse, Erfahrungen und Aspekte von Zufriedenheit aber auch negative Erlebnisse, Erfahrungen und Unzufriedenheit schildern. Dieses Mischbild ermöglicht eine interessante Deutung sowie den Vergleich von Erfahrungen und Erwartungen.
Aus der Nutzerperspektive lassen sich als relevant die Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung, die therapeutische Vielfalt und psychotherapeutische sowie kreative Auseinandersetzung mit den psychischen Problemen sowie die Gesundheitsförderung erkennen. Dies sind Aspekte, die die therapiebezogene Arbeitsorganisation beinhalten sollte.
Im entwickelten Kategoriensystem ergaben sich die Relationen von Genesungsbegleitung und Gesundheitsberatung, therapeutischer Beziehung und Gemeinschaft und Arbeit sowie der Organisation. Es wird deutlich, wie eng die Gesundheitsförderung, das Therapiemanagement und die Organisationsstrukturen miteinander verknüpft sind. Dies sind die komprimierten Aspekte, die aus der Nutzersicht als relevant gelten können. Die therapiebezogene Arbeitsorganisation sollte sich daran orientieren.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die Literaturanalyse
1.1 Die Psychiatrie
1.1.1 Psychische Gesundheit und Krankheit
1.1.2 Leben unter den Bedingungen von psychischer Krankheit
1.1.3 Arbeitsbedingungen der professionell Tätigen
1.2 Das professionelle und therapeutische Handeln in der Psychiatrie
1.2.1 Der therapeutische Prozess
1.2.2 Die therapeutische Arbeit
1.2.3 Die therapeutische Haltung
1.2.4 Lebenswelt und Alltagswelt
1.2.5 Das Fall- und Situationsverstehen
1.3 Die Nutzerperspektive
1.3.1 Nutzerzufriedenheit
1.3.2 Zufriedenheitsforschung in der Psychiatrie
1.4 Die Organisationstheorie
1.4.1 Das Krankenhaus als soziale Organisation
1.4.2 Organisationales Handeln
1.4.3 Organisation Psychiatrie
1.5 Die Arbeitsorganisation
1.5.1 Arbeitsorganisation in der Klinik
1.5.2 Organisationsgestaltung der Arbeitsabläufe einer Station
1.5.3 Arbeits- und Ablauforganisation in der Psychiatrie
1.5.4 Professionelle und therapeutische Ziele der Arbeitsorganisation
1.5.5 Das pflegerische Therapiemanagement
1.6 Resümee
2 Das methodische Vorgehen
2.1 Die Methode der Grounded Theory
2.1.1 Die Forschungsfrage
2.1.2 Die Datenerhebung
2.1.3 Die Kodierung
2.1.4 Die Memos und Diagramme
2.1.5 Die Sättigung der Daten
2.1.6 Die Theoriebildung
2.1.7 Die Evaluation
2.2 Die Untersuchung
2.2.1 Das Forschungsproblem
2.2.2 Das Ziel und die Fragestellung
2.2.3 Die Literaturanalyse
2.2.4 Die Interviews
2.2.4.1 Die Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen
2.2.4.2 Die Rolle des Interviewers
2.2.4.3 Zufriedenheitsforschung mit so genannten psychisch gestörten Menschen
2.2.4.4 Themenbezogene Instrumente zur Datenerhebung
2.2.4.5 Der Interviewleitfaden
2.2.5 Die Evaluation
2.2.5.1 Die Auswertung
2.2.5.2 Die Reflexion
3 Die fallimmanente Auswertung
3.1 Fallportrait 1: Fr. A
3.1.1 Fallverlauf
3.1.2 Falldiskussion
3.1.3 Fazit
3.1.4 Memo
3.2 Fallportrait 2: Hr. D
3.2.1 Fallverlauf
3.2.2 Falldiskussion
3.2.3 Fazit
3.2.4 Memo
3.3 Fallportrait 3: Hr. E
3.3.1 Fallverlauf
3.3.2 Falldiskussion
3.3.3 Fazit
3.3.4 Memo
3.4 Fallportrait 4: Hr. C
3.4.1 Fallverlauf
3.4.2 Falldiskussion
3.4.3 Fazit
3.4.4 Memo
3.5 Fallportrait 5: Fr. F
3.5.1 Fallverlauf
3.5.2 Falldiskussion
3.5.3 Fazit
3.5.4 Memo
3.6 Weitere Interviews
3.6.1 Fr. B
3.6.2 Hr. G
3.6.3 Fr. H
3.6.4 Hr. I
3.6.5 Memo
3.7 Kurzkontakte
3.7.1 Kurzkontakte mit Betroffenen
3.7.2 Kurzkontakte mit Angehörigen
3.7.3 Memo 7
3.8 Resümee
4 Die fallübergreifende Auswertung
4.1 Die inhaltliche Auswertung
4.2 Die Entwicklung des Kategoriensystems
4.2.1 Die Abstraktion der Kernkategorien
4.2.2 Die Relationen der Kernkategorien
4.2.3 Das Kategoriensystem
4.3 Resümee
5 Die Reflexion
5.1 Der Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit der Literaturanalyse
5.2 Die Schlussfolgerungen
6 Der Ausblick
Abschluss
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
Menschen nutzen verschiedene Angebote im Sozial- und Gesundheitsbereich, z.B. die medizinische und pflegerische Therapie im Krankenhaus. So sind sie Nutzer und Nutzerinnen von personen- und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen. Gerade Menschen in schweren Lebenslagen und –situationen, z.B. durch eine schwere Erkrankung, sind auf solche Dienstleistungen wie u.a. von Krankenhäusern angewiesen. Insbesondere wenn sie sich in einer gesundheitlichen Krisensituation befinden, in der sie selbst nur eingeschränkt ihre alltagsbezogenen Kompetenzen ausleben können und u.a. Entscheidungen, Verantwortungen sowie lebenspraktische Tätigkeiten wahrnehmen können sind sie auf hilfreiche und nachhaltig wirksame gesundheitsbezogene Dienstleistungen angewiesen. Daher werden so genannte Patienten und Patientinnen hier als Nutzer und Nutzerinnen der Dienstleistungsangebote von Krankenhäusern angesehen.
So genannte psychisch gestörte Menschen sind ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Sie haben, ebenso wie alle anderen Bürger und Bürgerinnen, das Anrecht auf die bestmögliche therapeutische Intervention zur nachhaltigen Gesundheitsförderung. Gerade in Fachkliniken wird jährlich eine sehr hohe Anzahl an Menschen mit psychischen Störungen zur Therapie aufgenommen. Doch unterscheiden sich das therapeutische Setting und der Therapiebedarf sowie die therapeutischen Interventionsformen und –möglichkeiten in der Psychiatrie deutlich von denen im somatischen Bereich (Tergeist, 2001a). Dies hat Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation, das Therapiemanagement, die Organisationsabläufe und –gestaltung, die Geschäfts- und Leistungsprozesse sowie das professionelle Handeln, etc. Aufgrund des eher nicht-manuellen und vorwiegend kommunikativen Handelns in der Psychiatrie und Psychotherapie müssen die Strukturen und Abläufe einer stationären Einheit bzw. Aufnahmestation diesen Anforderungen gerecht werden (Rahn, 2001).
Gerade weil die patienten- und therapiebezogene Arbeitsorganisation bzw. Organisation der therapeutischen Arbeit oder des Therapiemanagements eher abstrakt und wenig greifbar ist, bedarf sie eines besonderen Augenmerks des Stationsmanagements. Das beinhaltet: Wie sind die Arbeitsabläufe, die Stationsstrukturen, die Arbeitsprozesse und Therapieprozesse organisiert und gesteuert? Welches sind die Geschäfts- und Leistungsprozesse der Station und wie ist die Arbeitsteilung wie auch Aufgabenverteilung? Wie erfolgt die Aufgabenerfüllung und gewünschte Ergebniserreichung? Das Stationsmanagement hat diesbezüglich einerseits die Verantwortung der angemessenen Umsetzung und Organisation der Arbeit und Aufgaben sowie andererseits das Problem der Aufgabenverteilung und Ergebniszusammenführung der wenig messbaren Interventionen im multiprofessionellen Team.
Deswegen sollte das Stationsmanagement ein Interesse daran haben, zu prüfen, ob die therapiebezogene Arbeitsorganisation angemessen, effektiv und effizient ist. Ist die therapeutische Arbeit und deren Organisation wirklich und nachhaltig gesundheitsförderlich wirksam für die Patienten und Patientinnen? Wird der Arbeitsauftrag bzw. die Aufgabe wirklich erfüllt?
Der Psychiatrie haftet oft das Klischee der Verwahranstalt an. Offenbar ist es in der Realität so, dass so genannte akutpsychiatrische Stationen über weniger materielle Ressourcen als so genannte Therapiestationen der Psychosomatik o. ä. verfügen und dass dort weniger Therapieangebote erfolgen und diese scheinbar auch selten wissenschaftlich fundiert sind (Kallert et al, 2007; Schulz et al, 2006). Wirkt sich das auch auf die therapiebezogene Arbeitsorganisation aus? Ist die Arbeitsorganisation in der Akutpsychiatrie weniger relevant? Deswegen soll hier der Schwerpunkt auf die Akutpsychiatrie mit ihren geschlossenen, offenen, voll- und teilstationären Bereichen der psychiatrischen Akutaufnahme gelegt werden.
In dieser Arbeit soll der Blickwinkel weg von der Einschätzung der professionell Tätigen, hin zur Sichtweise der Nutzer und Nutzerinnen erfolgen. Wie erleben diejenigen, für die das Dienstleistungsangebot gedacht ist, den Stationsaufenthalt und die therapeutische Effektivität? Hier soll geprüft werden, wie die therapiebezogene Arbeitsorganisation bzw. die Organisation des Therapiemanagements von den Nutzern und Nutzerinnen wahrgenommen wird. In welcher Weise erleben sie diese als gesundheitsförderlich wirksam und positiv für ihre Genesung?
Die Arbeit soll die von den Nutzern und Nutzerinnen aufgeworfenen Themenaspekte aufgreifen und beleuchten. Hierzu soll erhoben werden, welche Aspekte als wichtig empfunden und erlebt werden. Sämtliche Punkte, die zum Thema „Therapiebezogene Arbeitsorganisation in der Akutpsychiatrie“ bzw. „pflegerisches Therapiemanagement“ von den Gesprächspartnern und –partnerinnen angesprochen werden, sollen als relevant betrachtet und diskutiert werden.
In der Evaluations- und Zufriedenheitsforschung werden viele Untersuchungen zur so genannten Nutzerperspektive bzw. Patientensicht durchgeführt. In den meisten Studien geht es aber darum, wie einzelne therapeutische Konzepte oder pharmakologische Wirkstoffe oder die Gesamtheit der Therapien allgemein aus Patientensicht eingeschätzt werden. Das Management bzw. Stationsmanagement aber wird eher selten bis gar nicht hinterfragt. Inwiefern werden die Leistungen des Teams gesehen und bewertet? Wie werden die Arbeitsorganisation und die Stationsstrukturen sowie das Therapiemanagement bzw. die Organisation der therapeutischen Angebote und Arbeit aus Patientensicht erlebt? Ist das Management der Station bzw. die Arbeitsorganisation durch das Stationsteam förderlich zur Genesung und hilfreich für das Wohlbefinden? Welche Wünsche und Ideen haben Patienten bezüglich des Stationsmanagements und der therapiebezogenen Arbeitsorganisation des Teams?
Daher befasst sich diese Arbeit mit folgenden Fragestellungen:
1. Wie erleben Patienten und Patientinnen einer psychiatrischen Akutaufnahmestation die therapiebezogene Arbeitsorganisation (insbesondere der Pflege)?
2. Welche Erwartungen haben Patienten und Patientinnen einer psychiatrischen Akutaufnahmestation an die therapiebezogene Arbeitsorganisation (insbesondere der Pflege)?
Diese Fragen sollen mittels der qualitativen Methode der Grounded Theory anhand der Auswertung von leitfadengestützten Interviews beantwortet werden. Als Ergebnis soll ein Kategoriensystem entwickelt werden.
Die Arbeit strukturiert sich wie folgt:
- die Literaturanalyse zur Darstellung des aktuellen Erkenntnisstandes als Rahmen der Arbeit;
- die Darstellung des methodischen Vorgehens als Grundlage der Arbeit;
- die Präsentation so genannter Fallportraits als fallimmanente Darstellung der Auswertungsergebnisse;
- die fallübergreifende Auswertung und der Entwicklung eines Kategoriensystems als Ergebnisse der Arbeit;
- die Reflexion der Ergebnisse als Diskussion der Schlussfolgerungen.
Wenn in dieser Arbeit von so genannten psychisch gestörten Menschen gesprochen wird oder ähnliche Ausdrucksweisen genutzt werden, so soll dies nicht als stigmatisierende oder reduzierende Bezeichnung erfolgen. Es dient hier allein der eindeutigen Zuordnung im Textverständnis. Gemeint sind Menschen, die unter den Bedingungen von psychischer Krise oder Krankheit leben bzw. von Folgen psychischer Störungen betroffen sind.
Der Begriff Patient bzw. Patientin wird in dieser Arbeit aufgrund seines Bekanntheitsgrades und der gesellschaftlich verbreiteten Gebräuchlichkeit trotz der inbegriffenen Rollenreduzierung benutzt, um die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Textes für die Lesenden zu erhöhen. Patienten und Patientinnen werden in dieser Arbeit als partizipierende Partner und Partnerinnen bzw Nutzer und Nutzerinnen einer Dienstleistung gesehen.
Es werden einige Begrifflichkeiten aus der Literatur übernommen, wie z.B. Nutzerperspektive oder Patientenorientierung. Diese Begriffe sind aber durchaus kritikwürdig, da sie der im deutschen Sprachgebrauch geltenden männlichen Bezeichnung ähneln. Sie sind in der Wissenschaft und Forschung übliche und daher relevante Begriffe und Schlagworte. In dieser Arbeit werden sie in ihrer Bezeichnung als eine Perspektive betrachtet, in der es zunächst nicht um die Personen geht. Daher sind sie den Geschlechtern übergeordnet bzw. unabhängig davon zu betrachten. Ansonsten wird sowohl die männliche wie auch weibliche Form genutzter Begriffe benannt.
1 Die Literaturanalyse
Dieses Kapitel soll einen groben Überblick zur aktuellen Diskussion in der Literatur und zum aktuellen Stand der Wissenschaft aufzeigen. In diesem Problemaufriss werden kleine Einblicke zu einzelnen ausgewählten Themen und Aspekten in kurzen Unterkapiteln ermöglicht. In den Unterkapiteln werden Definitionsansätze, Argumentationen und relevante Begriffe aufgezeigt, diskutiert und reflektiert. Zur Vertiefung der Einzelthemen und –aspekte wird auf die Quellenangaben und die weiterführende Literatur verwiesen, da es im Rahmen dieser Arbeit, aufgrund der Seitenvorgabe, nicht möglich ist, sämtliche Modelle, Konzepte, Definitionen, etc. vollständig zu bearbeiten und darzustellen.
1.1 Die Psychiatrie
Die Psychiatrie ist die Lehre der Psyche bzw. die Seelenheilkunde (Peters, 2007). Psychiatrie ist eine medizinische Disziplin bzw. klinische Organisationseinheit oder Abteilung. Sie ist eingebunden in das jeweilige regionale psychiatrische Versorgungsnetzwerk. Die Psychiatrie befasst sich mit Menschen und ihrer psychischen bzw. seelischen Gesundheit und Krankheit. Menschen in psychischen Krisen bzw. mit psychiatrischen Krankheitszeichen können professionelle Hilfen im Versorgungsnetz erhalten.
Psychisch gestörte Menschen stellen eine relevante Größe in der deutschen Gesellschaft dar. Die Prävalenz psychischer Erkrankungen beträgt in etwa 20% bis 30 % der Gesamtbevölkerung, wobei von einer Vielzahl an Menschen mit untherapierten, unbemerkten oder leichten Verläufen psychischer Krisen bzw. Störungen o.ä. ausgegangen werden kann. Dabei verlaufen ca. 60% aller psychischen Störungen chronisch. Die Lebenszeitprävalenz aller Bundesbürger an einer psychischen Störung zu erkranken beträgt bis zu 30% (Meller und Fichter, 2007; Gesundheitsberichterstattung, 2006; Riedel-Heller et al, 2004; Statistisches Bundesamt, 1998; Arolt, 1998). Über eine Million Menschen werden in der BRD jährlich in Krankenhäusern wegen psychischer Störungen aufgenommen und diese Anzahl steigt stetig. Sie stellten Mitte der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in der Altersgruppe von 25 bis 54 Jahren die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Anzahl von Krankenhauspflegetagen. Die aktuelle durchschnittliche Verweildauer in der Klinik beträgt diesbezüglich etwa 20 Tage (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2005a; 2005b; Statistisches Bundesamt, 2004; 1998).
In der Akutpsychiatrie erfolgen ungeplante, notfallmäßige Aufnahmen von Betroffenen bzw. sie hat eine Aufnahmeverpflichtung und einen so genannten Behandlungsauftrag für Menschen mit akuten Krisenzeichen und in psychischen Notfallsituationen. In der Regel werden in Kliniken der Akutpsychiatrie die große Mehrzahl der Patienten ohne Planung und vorherige Steuerung aufgenommen. Dies kann mit oder ohne ärztliche Einweisung sowie durch richterliche Einweisung erfolgen (Laux und Deister, 2007; Hofmann, 2004).
1.1.1 Psychische Gesundheit und Krankheit
Es gibt diverse Definitionen zu Gesundheit und Krankheit. Oft werden sie als gegensätzliche Pole in einem Kontinuum im Sinne von Homöostase betrachtet. Gesundheit und Krankheit können auch als dynamische Einheit im Sinne von Homöodynamik gesehen werden, die sich nicht gegenseitig ausschließen und somit auch Facetten von Wohlbefinden, chronischer Krankheit, Behinderung, etc. einschließt (Schwartz et al, 2002; Badura et al, 1999; Rogers, 1995).
Es gibt diverse Theorien zu psychischer Gesundheit und Krankheit. Insbesondere die Entstehung von Risiken und Dispositionen zur Erkrankung an einer psychischen Störung bzw. dem Verlauf von Krisenprozessen werden untersucht und geschildert (Gaebel, 2007; Huck, 2006; Rüesch und Neuenschwander, 2004; Ciompi, 2003; Vollmoeller, 2001; Caplan, 1964). Seelische bzw. psychische Krankheiten (Psychosen) sind u.a. Störungen des Gleichgewichtes in der Dynamik des Denkens, Fühlens, Handelns, Erlebens, Könnens und Wollens. Krisen verlaufen prozessartig in Phasen, die Zeichen von Störungen des psychischen Gleichgewichtes hervorbringen (Caplan, 1964). Dabei werden weniger die Sichtweisen von psychischer Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung und –pflege mit Definitionen, Faktoren zur Stärkung, von Risiken, Entstehung, Entwicklung und Erhaltung von Gesundheit oder Wohlbefinden bzw. von Ressourcen oder Selbstheilungskräften behandelt. Die Wirkfaktoren von therapeutischen Konzepten und Interventionen zur Gesundheitsförderung werden ebenso selten diskutiert.
Es werden nach ICD-10 (WHO, 2004) u.a. schizophrene, affektive, neurotische, Persönlichkeits-, Verhaltensstörungen als psychische Erkrankungen differenziert. Darunter fallen z. B. paranoide Psychose, halluzinatorische Psychose, Depression, Manie. Solche seelischen Störungen beinhalten möglicherweise und individuell auftretend verschiedene Phänomene als Zeichen psychischer Krisen, wie z:B. Angst, Verwirrtheit, Wahn, Halluzinationen, Aggression, Regression, Trauma, etc. (Sauter et al, 2006; WHO, 2004).
1.1.2 Leben unter den Bedingungen von psychischer Krankheit
Es gibt viele Erhebungen, die aufzeigen, dass Menschen, die unter den Bedingungen psychischer Störungen leben oftmals sehr hohen Belastungen. Problemen, Stigmata, Leiden, Einschränkungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind. Diese beziehen sich u.a. auf soziale, affektive, kognitive, kommunikative, psychomotorische, finanzielle Dimensionen des Lebens. Die Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Lebensqualität, etc. der Betroffenen sind oft aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und symptomatischen Phänomenen heraus eingeschränkt. Das Leben in der Gesellschaft ist unter den Lebensbedingungen einer psychischen Störung deutlich erschwert (Frei et al, 2004; Brieger et al, 2004; Burns et al, 2003; Angermeyer, 2003; Holzinger et al, 2003).
In Kliniken oder anderen Betreuungseinrichtungen werden die Betroffenen zeitweise mit Gewalt, Zwang, Kontrolle, rigiden Strukturen, Bevormundung, etc. (durch sich selber, Mitpatienten, Mitarbeiter, etc.) konfrontiert (Olofsson und Jacobson, 2003). Gerade die Einnahme von Psychopharmaka birgt einige Risiken und einschränkende, unerwünschte Nebenwirkungen in sich, die die Lebensbedingungen sehr verschlechtern können (Finzen, 2007).
Die Wünsche der Betroffenen zur Therapie sind gemäß der Datenlage u.a., dass der Schwerpunkt auf Kommunikation und Beziehung gelegt wird, dass Beratung zur Entscheidungsfindung erfolgt, dass eine Einbeziehung in die so genannte Behandlungsplanung selbstverständlich ist, freundliche Begegnung (Baer et al, 2003; Crawford et al, 2003: Gehrke et al, 2003, Oermann 1999; Langewitz et al, 2002; Kucharski, 2002; Spießl et al, 2002). Psychisch gestörte Menschen können ihre Lebenssituation, Krankheitsverläufe und Bedürfnisse also sehr wohl reflektieren (Kommer, 2005; Holzinger et al, 2002).
Die Angehörigen sind ebenso als Nutzer der Psychiatrieversorgungsnetzwerke zu sehen. Auch sie sind von immensen Belastungen durch die psychische Erkrankung ihrer Verwandten oder Partner und Partnerinnen betroffen und haben Erwartungen an deren Therapie (Spießl et al, 2005; Schmid et al, 2003; Jungbauer et al, 2001).
Psychische Störungen stehen auch stets unter dem Einfluss von Geschlecht, Kultur, Religion, Bildung, Alter, sozialer Entwicklung, etc. Damit beeinflussen sie auch die Lebensbedingungen und –qualität der Betroffenen unter den gegebenen Bedingungen der psychischen Störungen bzw. deren Verlauf und Therapiebedarfe (Rohde und Marneros, 2007; Gaebel, 2007; Hautzinger, 2007; Riecher-Rössler, 2007; Rosner und Gavranidou, 2007; Riecher-Rössler et al, 2004; Kornstein und Clayton, 2002; Riecher-Rössler und Rohde, 2001; Rowan, 1997).
1.1.3 Arbeitsbedingungen der professionell Tätigen
Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Akutpsychiatrie, insbesondere die kontinuierlich anwesenden Pflegenden, sind in ihren Arbeitssituationen mit Belastungen mit psychisch gestörten Menschen und ihre Angehörigen konfrontiert (Schanz und Klawe, 2005; Reimer, 2004; Grube, 2003; Meßenzehl et al, 2005). Dazu zählen Aspekte, wie Gewalt, Angst, Stress, Stalking, Burn Out.
Zugleich liegt es aber auch in der Hand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Gewaltspirale zu beeinflussen (Richter und Needham, 2007; Steinert et al, 2004). Gerade wegen der Beeinflussungsmöglichkeiten zur Deeskalation usw. obliegt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Psychiatrie die Verantwortung innerhalb therapeutischer Interventionen und Beziehungen erstens zu Selbstpflege und Selbstschutz sowie zweitens zum Schutz der Patienten und Patientinnen und zur Wahrung von deren Rechten und Würde. Gerade der Pflege als kontinuierlich anwesende Berufsgruppe wird hier therapeutische Verantwortung gegenüber sich und den Betroffenen abverlangt.
1.2 Das professionelle und therapeutische Handeln in der Psychiatrie
Professionelles Handeln ist einerseits regelgeleitetes, also nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtetes, Handeln sowie andererseits verstehendes Handeln im Sinne von Fallverstehen (Weidner, 2002; Raven, 1989; Oevermann, 1978). Professionelles Handeln ist Zeichen einer Profession bzw der Professionalisierung einer gesellschaftlich wichtigen beruflichen Tätigkeit. Therapeutisches Handeln im Sinne einer gesundheitsbezogenen Intervention professionell Tätiger beinhaltet die Orientierung am Paradigma der Gesundheit sowie die zielgerichtete und geplante Intervention als Anteil des (pflege-)diagnostischen und therapeutischen Prozesses. Das therapeutische Handeln richtet sich in Ziel und Maßnahme an Aspekten der Gesundheitsförderung und Prävention (Erhaltung, Stärkung, Wiedererlangung der Gesundheit) wie auch an Krankheitsbewältigung (Bewältigung von Störungen, Leid und Lebensbedingungen) und Rehabilitation (Bewältigung von Krankheitsfolgen, Wiedererlangung von Kompetenzen) aus. Therapeutisches Handeln ist also Gesundheitsförderung.
Professionelles therapeutisches Handeln orientiert sich an Qualitätsindikatoren, von denen es mittlerweile auch einige für den psychiatrischen Bereich gibt (Tschinke, 2006; Richter, 2002; Vieten et al, 2002; Dick et al, 2001, Villinger, 1999). Wobei auch angemessene und sinnvolle ökonomische Richtlinien zum Vorteil für Betroffene und Kliniken zu bedenken sind (Kunze, 2007). Dies schließt auch die Fundierung von therapeutischen Angeboten mit (auf Wirksamkeit hin) evaluierten Konzepten bzw. Manualen sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen ein, was offenbar nicht übliche Praxis ist (Schulz et al, 2006). Des Weiteren gehört es auch zur Qualität und Verantwortung, so genannte Drehtürkarrieren zu vermeiden (Melchinger, 2001). Fachliche Leitlinien, wie z.B. die S3-Leitlinien, bieten hierzu ebenfalls einen guten Orientierungsrahmen. Allerdings müssen auch diese Leitlinien fachlich reflektiert und auf ihre Validität und Fundierung sowie Aktualität hin geprüft werden.
Der Gesetzgeber fordert in seinen Vorgaben Qualitätssicherung, Patientenorientierung, Fachkompetenz, etc. für sämtliche Einrichtungen und Berufsgruppen. Speziell für die Pflege wird der therapeutische Auftrag in der Forderung nach Verantwortung in der Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und Krankheitsbewältigung sowie Beratung und Anleitung aufgezeigt (Mahler, 2004; Bundesgesetzblatt, 2003). Dementsprechend haben die Patienten und Patientinnen das Recht auf ein therapeutisches Handeln aller Berufsgruppen nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das professionelle, therapeutische Handeln aller Berufsgruppen muss sich also grundsätzlich auf aktuelles Wissen der Forschung und wissenschaftlichen Literatur begründen lassen. Allerdings steuern andere gesetzliche Vorgaben oder Lücken zur Finanzierung der Kliniken dagegen.
1.2.1 Der therapeutische Prozess
Der therapeutische Prozess ist Teil des Regelkreises professionellen gesundheitsbezogenen Handelns. Der Regelkreis besteht aus dem diagnostischen und therapeutischen Prozess. Der Regelkreis bietet das Fundament für organisiertes und zielgerichtetes professionelles Handeln, Planen, Entscheiden, etc. Der Regelkreis professionellen gesundheitsbezogenen Handelns beinhaltet das umfassende Assessment, die treffende Diagnose, die gezielte Aktion und die angemessene Evaluation. Damit dient er dem therapeutischen Team zur:
- Einschätzung und Erhebung des Handlungsbedarfes
- Diagnosestellung bzw. Feststellung des Handlungsbedarfes
- Ziel- und Interventionsplanung inklusive deren Durchführung
- Auswertung des Handlungserfolges und Rückkopplung (Mahler, 2008).
Speziell in der Pflege ist der therapeutische Prozess Teil des so genannten Pflegeprozesses als pflegediagnostischer und –therapeutischer Prozess. Er ist gesetzlich vorgeschrieben und muss daher von allen professionell handelnden Pflegenden erstellt und umgesetzt werden. Der Pflegeprozess ist ein Informationssammlungs- und Entscheidungsprozess zur Problemlösung in professionellen pflegerischen Beziehungs- und Handlungssituationen. Dieser umfasst in allen Definitionen und Modellen im Wesentlichen:
- Eine umfassende Erhebung und Einschätzung des pflegerischen Handlungsbedarfes,
- die Feststellung und Benennung des pflegerischen Handlungsbedarfes (Pflegediagnose),
- gezielte und geplante Pflegeinterventionen,
- eine Auswertung der Wirksamkeit der geplanten Ziele und Interventionen bzw. Prüfung aktuellen Handlungsbedarfes (Mahler, 2008).
Der pflegediagnostische und –therapeutische Prozess beinhaltet dementsprechend ebenso Assessment, Diagnose, Aktion und Evaluation. Der pflegediagnostische Prozess führt durch die Problemidentifikation zur Festlegung und Benennung des fallbezogenen Pflegebedarfes und idealer Weise zur Bestimmung einer Pflegediagnose. Der pflegtherapeutische Prozess oder das pflegerische Therapiemanagement ist ein geplanter wie auch mit Wissen und Können fundierter Vorgang und soll zur ethisch vertretbaren Problembewältigung führen (Mahler, 2008).
Die Steuerung des Regelkreises professionellen Handelns ist das Prozessmanagement. Die Steuerung des therapeutischen Prozesses ist das Therapiemanagement oder Therapieprozessmanagement. Das Prozessmanagement ist also Grundlage des professionellen Handelns. Die Steuerung des pflegetherapeutischen Prozesses ist das pflegerische Therapiemanagement.
1.2.2 Die therapeutische Arbeit
Die therapeutische Arbeit in der Psychiatrie erfolgt im multiprofessionellen und therapeutischen Team. Die Aufgaben und Hierarchien im Team verwischen trotz berufsgruppenspezifischer Schwerpunkte aufgrund des therapeutischen Milieus und der Grundhaltung im psychiatrischen Setting. Dies wird schon allein aufgrund der Vorgaben der so genannten Psychiatrie Personalverordnung (PsychPV) gefördert, wonach Gruppen- und Einzelangebote zur Entspannung, Psychoedukation, Gesprächstherapie, Lebens- und Alltagspraxis, usw. sowie auch Morgenrunden, Ausflüge, Hausbesuche, Begleitungen, etc. berufsgruppenübergreifend organisiert werden sollen (Kunze und Kaltenbach, 2005; Kaiser, 2004).
Es gibt neben der Psychopharmakotherapie diverse Ansätze und Konzepte einzel- und gruppentherapeutischer Interventionen in der Psychiatrie und Psychotherapie, wie z.B. Soziotherapie, Verhaltenstherapie, Sozialtherapie, Tiefenpsychotherapie, Gesprächstherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Musiktherapie, tiergestützte Therapie, systemische Therapie, Entspannungstherapie, Ergotherapie, Arbeitstherapie, Milieutherapie (vgl. Möller et al, 2007; Rössler, 2004; Rupprecht und Hampel, 2006; Frieboes et al, 2005; Rakel und Lanzenberger, 2001).
Aufgrund von verschiedenen Strukturen, Klientengruppen, Stationskonzepten, etc. haben unterschiedliche Organisationseinheiten, wie Aufnahmestationen, Tageskliniken, etc., unterschiedliche therapeutische Ausrichtungen und Inhalte. Es hat sich aber durchgehend eine Kombination von Psychopharmakotherapie und Psychotherapie in allen Bereichen der Krankenhauspsychiatrie durchgesetzt. Auch in der voll- und teilstationären Akutpsychiatrie sind psychotherapeutische Inhalte als Einzel- sowie Gruppenintervention sinnvoll und notwendig. Hierzu gibt es z.B. Konzepte, wie tiefenpsychologische Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, integriertes psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Menschen, die dialektisch-behaviorale Therapie für Menschen mit Borderline, interpersonelle Psychotherapie, interaktionelle Psychotherapie, Psychoedukation, Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, Soziotherapie, Milieutherapie, Entspannungstherapie. Diese Konzepte sind für die Akutpsychiatrie sowie zur Krisenintervention geeignet und evaluiert (Birkenheier, 2004; Fehrenbach, 2004; Köhler, 2004; Riecher-Rössler et al, 2004).
Offenbar besteht die Möglichkeit, dass Patienten und Patientinnen der vollstationären Akutpsychiatrie weniger therapeutische Angebote erhalten als andere psychiatrische Patienten und Patientinnen. Denn erstens werden in der Literatur für die Akutpsychiatrie weniger Therapiekonzepte benannt und zweitens werden scheinbar weniger Gelder investiert (Kallert et al, 2007). Welche fundierten Gründe und Auswirkungen dies haben mag, wird in der Literatur anscheinend nicht diskutiert. Ebenso wird nicht oder kaum besprochen bzw. untersucht, welche therapeutischen Angebote in der (vollstationären und evtl. geschlossenen) Akutpsychiatrie gegenüber Akuttageskliniken, Tageskliniken, (akut) Psychotherapie- oder Psychosomatikstationen angebracht und sinnvoll sind bzw. welche Patientengruppen in welcher Phase von Krise oder psychischer Krankheit welche Angebote benötigen oder wünschen bzw. zu welchen Therapien diese in der Lage sind.
Die therapeutische Beziehung ist dabei Grundlage jedes therapeutischen Handelns (Broda und Senf, 2004; Bauer und Ahrens, 1998). Sie nimmt Einfluss auf das therapeutische Milieu und schafft Vertrauen, Sicherheit, Kontinuität, etc. Gerade die Pflege hat aufgrund ihres kontinuierlichen Kontaktes zu den Betroffenen die Aufgabe zum Aufbau nachhaltiger therapeutischer Beziehungen (Teising, 2005; Bauer, 2001). Da die therapeutische Beziehung Grundlage jeglicher therapeutischer Intervention ist, muss sich die therapiebezogene Arbeitsorganisation des Teams so ausrichten, dass sie möglich werden kann.
Bildgebende Verfahren belegen den Nutzen psychotherapeutischer Interventionen und therapeutischer Beziehungen. Sie wirken ebenso positiv verändernd bzw. aktivierend auf verschiedene Hirnbereiche ein wie Psychopharmaka. Die Trennung zwischen Psychopharmakotherapie als „harte“ und auf das Gehirn bzw. biologisch wirkende Therapie und Psychotherapie als so genannte „weiche“ zum besser Fühlen geeignete Therapie ist damit hinfällig (Beutel, 2006). Die Neurowissenschaften belegen, dass neuronale Netzwerke durch therapeutische Beziehungen, soziale Kontakte, kommunikative Interaktion, etc. gesundheitsförderlich angeregt werden und neue neuronale Vernetzungen stattfinden (Grave, 2004). Psychotherapeutische Interventionen und therapeutische Beziehungen im weitesten Sinne sind also zur nachhaltigen Therapie von psychischen Störungen Sinne dringend notwendig.
Demnach wird das Therapiemanagement außerhalb von Psychopharmakotherapie umso relevanter. Dementsprechend gewinnt auch die therapiebezogene Arbeitsorganisation in der Psychiatrie an Bedeutung. Insbesondere die nicht-ärztlichen Interventionen von z.B. Psychologie und Pflege erlangen somit hohen therapeutischen Stellenwert (Ahrens, 2007; 2006). Das Stationsmanagement und insbesondere das Pflegemanagement trägt folglich hohe Verantwortung, die therapeutische Beziehung, kommunikativ-therapeutische Interaktion und sozial und psychotherapeutischen (gruppen-) Angebote bewusst zu planen, steuern, gestalten, etc. und somit gezielt in die Arbeitsorganisation und das Therapiemanagement zu integrieren. Gerade das Pflegemanagement gewinnt hier die Aufgabe pflegetherapeutische Angebote in gesundheitspflegerischer Sichtweise in den pflegediagnostischen und –therapeutischen Prozess zu implementieren.
Obwohl gerade die sozial-kommunikative Komponente therapeutischer Interventionen für psychisch gestörte Menschen aus Nutzerperspektive und neurowissenschaftlicher Erkenntnis heraus von herausragender Bedeutung ist, verliert sie wissenschaftlich und offenbar auch praktisch an Bedeutung (Hausner et al, 2007). Wie in obigen Ausführungen angedeutet, befassen sich die Fachliteratur und auch die psychiatrische Therapieforschung überwiegend mit der Psychopharmakotherapie.
1.2.3 Die therapeutische Haltung
Die therapeutische Haltung sollte sich zu allererst daran ausrichten, dass die therapeutische Arbeit ein gemeinsames Produkt der Betroffenen mit dem therapeutischen Team ist. Das übergeordnete Ziel der therapeutischen Arbeit ist demnach die Genesung bzw. das Wohlbefinden der Betroffenen. Um dies zu erreichen müssen gemeinsam Bedingungen sozialer, therapeutischer, struktureller und begleitender Art geschaffen werden, um erbeute Klinikaufnahmen zu vermeiden. Um dies zu erreichen ist die Förderung einer gesundheitsschützenden Umwelt, Rehabilitation und Teilhabe notwendig (Helmes und Bengel, 2007; Herwig und Koch, 2007; Bauer und Ahrens, 1998; Borsi, 1997). Das sollte demnach Teil der therapeutischen Haltung sein. In der bekannten Fachliteratur bzw. in Lehrbüchern wird das therapeutische Ziel der Gesundheitsförderung und Förderung von Wohlbefinden allerdings überwiegend vernachlässigt. Beinhaltet die therapeutische Haltung aber nicht die Gesundheitsorientierung bzw. das Ziel der Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Teilhabe so wird sie sich wahrscheinlich auch nicht in der therapeutischen Arbeit sowie dem Therapiemanagement bzw. der therapiebezogenen Arbeitsorganisation niederschlagen.
Des Weiteren wird in der Literatur diskutiert, dass es wichtig ist, sich vom passiven Behandeln weg- und zum gemeinsamen und aktiven therapeutischen Handeln hinzubewegen. Dazu ist die Sichtweise weg vom Patient als Objekt hin zum Patient als Subjekt zu vollziehen (Dörner, 2002; Voelske, 2001; Borsi, 1997).
Weiterhin werden verschiedene Begriffe, Konzepte und Ansätze in der psychiatrischen Fachliteratur als wichtig erachtet, wie Person sein, Recovery, Subjektorientierung, social support, Empowerment, therapeutische Beziehung als Begegnung und (Genesungs-) Begleitung, Selbstreflexion, Affektlogik und Soteria, therapeutische Gemeinschaft; Personenzentrierung, Selbstbestimmung, Alltag, Gemeindenähe (Lütjen, 2007; Amering und Schmolke, 2007; Borsi, 2006; Knuf et al, 2006; Rüesch und Neuenschwander, 2004; Ciompi, 2003; Dörner, 2002; Schmidt-Zadel et al, 2002; Kauder, 1999; Walther, 1999; Hübner, 1999; Strasser und Starz, 1996). Solche Begriffe, Ansätze und Konzepte beeinflussen die Philosophie der professionell Tätigen und damit ihre therapeutische Haltung, Arbeit und Zielformulierung.
1.2.4 Lebenswelt und Alltagswelt
Alltag oder Alltagswelt stellen die selbstverständliche und vertraute gesellschaftliche Wirklichkeit eines jeden Menschen dar. Die Alltagswelt wird in der Interaktion der Menschen geprägt und verstanden. Im alltäglichen zwischenmenschlichen Zusammenleben entwickelt sich eine Alltagskultur, die den Menschen prägt und eine Erwartungssicherheit für eine berechenbare sowie stabile Interaktion verleiht. Lebenswelt bezeichnet den subjektiven und gruppenspezifischen Bereich des alltäglichen, selbstverständlichen Wissens, Handelns und Erlebens von Menschen (gleichzeitig wird die Lebenswelt aber auch durch die Alltagswelt bestimmt. Gedanken und Gefühle, damit dann auch menschliche kommunikative Ausdrucksformen, beziehen sich auf äußere Gegebenheiten sowie die Wahrnehmung und Bewertung dieser. Realität entsteht dann in der eigenen Interpretation des Austausches mit der Umwelt (Radlinski, 1995; Hillmann, 1994).
In der Psychiatrie und Psychotherapie spielen die Konzepte von Alltagswelt und Lebenswelt eine große Rolle. Denn gerade unter den Bedingungen psychischer Störungen und Phänomenen, wie Erlebens- und Realitätsveränderungen, Angst, Trauma, Verwirrtheit, etc. werden die wahrgenommene Alltags- und Lebenswelt für die Betroffenen ein wichtiger Anhaltspunkt zur Stabilität und Sicherheit. In der therapeutischen Beziehung begegnen sich die Alltags- und Lebenswelten verschiedener Menschen. Therapeuten sowie Patienten und Patientinnen werden mit den Ausdrucksformen der Lebenswelt des Gegenübers konfrontiert. Zudem Verändern die Bedingungen psychischer Störungen die Lebensbedingungen, beeinflussen als auch die gegebene Alltags- und Lebenswelt. Daraus ergibt sich der Bedarf an alltags- und lebensweltorientierten Handeln in der therapeutischen Beziehung und im Therapiemanagement (Obers, 2004).
In Verbindung zu den Konzepten der Alltags- und Lebenswelt stehen ebenso Begriffe, wie Alltagsbewusstsein, Alltagskultur, Lebensfeld, Arbeitswelt, etc..
1.2.5 Das Fall- und Situationsverstehen
Um Phänomene, z. B. das Handeln psychisch gestörter Menschen, zu erklären, müssen sie erst einmal verstanden werden (Konegen und Sondergeld, 1990). Das Verstehen der Ausdrucksformen, also das Handeln durch Verhalten, Mimik, Gestik, Kommunikation, etc., wird als Handlungsverstehen bezeichnet. Das Verstehen von Handlungen ist nur im Kontext des Verstehens der zugrunde liegenden Situation möglich (Esser, 2001; Wright, 1997; Hollis, 1995). Das Verstehen der Alltags- und Lebenswelt sowie der daraus resultierenden Ausdrucksformen psychisch gestörter Menschen wird den professionell Tätigen also nur durch Situationsverstehen ermöglicht.
Die Rekonstruktion des Handlungshintergrundes eines Patienten oder einer Patientin macht das Handlungs- und Situationsverstehen zum Fallverstehen (Oevermann, 1978). Das Fallverstehen stellt dementsprechend eine notwendige Grundlage professionellen therapeutischen Handelns dar. Dazu müssen die therapeutisch Handelnden die so genannte Binnenperspektive einnehmen und sich am Subjekt orientieren.
1.3 Die Nutzerperspektive
Die so genannte Nutzerperspektive (Consumer´s perspective, patient´s view) beinhaltet die Sichtweise, Beteiligung und Meinung der Nutzer und Nutzerinnen von Dienstleistungen. In Verbindung zur Nutzerperspektive im Gesundheitswesen bzw. in der Psychiatrieversorgung stehen u.a. Begriffe, wie Binnen- und Außenperspektive, Fremd- und Eigenperspektive, Patientensicht, Experienced involvement, Nutzerinteressen, Nutzererfahrungen, Nutzererwartungen, Nutzerbeteiligung, Nutzerorientierung,
Für viele professionell Tätige, aber auch für Forscher, bleiben Patienten und Patientinnen ein unbekanntes Wesen (Hoffmann, 2005). Ihre Wünsche, Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse, Erfahrungen, usw. spielen in der Fachliteratur, Lehrbüchern, etc. oft keine oder eine unwesentliche Rolle. Um Patienten und Patientinnen nicht als Objekt sondern als Subjekt zu sehen, müssen sie als Nutzer und Nutzerinnen einer Dienstleistung betrachtet werden. Dazu gehört auch, dass die Sichtweise der Nutzer und Nutzerinnen in das Therapiemanagement, etc. integriert wird. Daher ist sie auch wesentlich für das Qualitätsmanagement von z.B. Kliniken (Blumenstock et al, 2004).
Auch im Gesundheitswesen erhält die Nutzerperspektive zunehmend Beachtung. Mittlerweile gilt sie im Zusammenhang mit Angemessenheit, Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen als Qualitätsmerkmal bzw. –indikator gesundheitsbezogener Dienstleistungen. Die Nutzerperspektive wird für die Dienstleistungen im Gesundheitswesen immer wichtiger, denn sie wird als Grundlage von Versorgungsqualität angesehen (Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 2003; Müller und Thielhorn, 2000). Knop (2002) konstatiert, dass es zunehmend relevanter wird, die Bedürfnisse der Patienten zu erkennen, dazu gehört ebenso ihre Zufriedenheit. Die Zufriedenheit der Patienten wird damit zum Ziel der gesundheits- und personenbezogenen Dienstleistung (Müller und Thielhorn, 2000). Eine hohe Dienstleistungsqualität kann nach Blonski (1998) auch im Gesundheitswesen bzw. in personenbezogenen Dienstleistungen die Nutzerzufriedenheit fördern.
Aus der Sichtweise des Qualitätsmanagements und der professionell Tätigen ist daher eine so genannte Nutzer- oder Patientenorientierung einzunehmen. Die Dienstleistungsqualität und –gestaltung sollte demnach an den Bedürfnissen der Dienstleistungsnutzer und –nutzerinnen ausgerichtet sein. Im Krankenhaus sollte sich das gesamte Prozess- und Therapiemanagement demzufolge an der Patientensicht orientieren (customer driven hospital) (Schreiber et al, 2001).
1.3.1 Nutzerzufriedenheit
Im Zusammenhang zur so genannten Nutzerzufriedenheit (consumer oder user satisfaction) stehen auch Begrifflichkeiten wie, Kunden-, Klienten-, Patienten-, Behandlungs- und Therapiezufriedenheit sowie Nutzer- und Patientenorientierung.
Nutzerzufriedenheit ergibt sich u.a. als Situationseinschätzung aus der Erfüllung von Erwartungen und Interessen im Vergleich zu den Erfahrungen und Wahrnehmungen. Bezüglich gesundheitsbezogener Dienstleistungen sind auch die Überzeugungen der Nutzer und Nutzerinnen im Zusammenhang zu ihrer gesundheitsbezogenen Versorgung relevant (Müller und Thielhorn, 2000).
Zufriedenheit hat verschiedene Ausprägungen. So schließt sich z.B. allgemeine Zufriedenheit mit einer Dienstleistung mit der Unzufriedenheit bezüglich Einzelaspekten nicht aus. Im Gesundheitswesen hängt die Zufriedenheit auch mit der Entwicklung des Gesundheits- und Krankheitsprozesses zusammen. Außerdem hängt eine Beurteilung stark vom Erleben erst kürzlicher Geschehnisse ab und Angehörige äußern sich meist kritischer als die Betroffenen selbst (Wingenfeld, 2003).
Es erfolgen häufiger so genannte vorzeitige Behandlungsabbrüche durch psychiatrische Patienten und Patientinnen. Von den professionell Tätigen werden diese oft als mangelnde Krankheitseinsicht und Non-Compliance bzw. unangemessene Adhärenz bezeichnet. Hier wird die Nutzersichtweise sowie die eigene therapeutische Verantwortung bzw. professionelle Handeln nicht einbezogen und kann so nicht aufrecht erhalten werden (Garlipp et al, 2001). Gerade bei Nutzern und Nutzerinnen in so genannten Grenzsituationen, wie u.a. psychisch gestörte Menschen in einer Zwangsbehandlung, ist eine hohe Qualität der Dienstleistung zur Beziehungsgestaltung und Förderung der Gesundung unumgänglich. Daher ist eine Zufriedenheit gerade in diesen Bereichen der Belastungs-, Problem- und Grenzsituationen erforderlich (Schanz et al, 2001).
1.3.2 Zufriedenheitsforschung in der Psychiatrie
Befragungen der Nutzer und Nutzerinnen zu ihren Erwartungen sowie Erfahrungen und der damit verknüpften Zufriedenheit sind eine notwendige Basis zur Reflexion der Therapie- und Versorgungsangebote (Richter, 2004; Lecher et al, 2002; Schwartz und Wismar, 1998; Badura und Strodtholz, 1998). Die Nutzbarkeit der Evaluationsergebnisse hängt in vielfältiger Weise von der Analyse der Befragung sowie der Art der Implementation der Ergebnisse in die Praxis ab (Priebe, 2000; Blum, 1998).
Die allgemeine Zufriedenheit im Sozial- und Gesundheitswesen ist global sehr hoch. Es besteht eine Tendenz der Befragten, positiv zu antworten. In einzelnen Details lassen sich aber Differenzierungen zur Zufriedenheit finden, wenn es um konkrete Erlebnisse und Ereignisse geht. Aufgrund von durch Institutionen initiierte, interessengesteuerte Befragungen von Patienten und aus der Außensicht interpretierte Antworten werden Studien zur Patientensicht oft verfälscht und für institutionelle Bedarfe missbraucht, so dass oft gar nicht wirklich das Interesse der Qualitätsentwicklung zur Patientenzufriedenheit hinter einer Befragung steht (Crawford und Kessel, 1999).
Die Nutzerperspektive und -zufriedenheit gewinnt aufgrund der Importanz für das gesundheitsbezogene Versorgung auch in der Forschung zunehmend an Relevanz. Auch in der Psychiatrie ist die Erhebung der Nutzerzufriedenheit bzw. der Nutzererwartungen von zunehmender Bedeutung (Müller und Schanz, 2002). Im deutschsprachigen Raum sind in den vergangenen Jahrzehnten ca. 16% an Studien zur Sichtweise der Nutzer der psychiatrischen Netzwerke publiziert worden. Es gibt demnach noch immer recht wenige Studien zur Nutzerzufriedenheit mit der Psychiatrieversorgung in Deutschland (Holzinger und Angermeyer, 2003; 2002). Die Perspektive der Nutzer im ambulanten Setting wird noch weniger erfasst (Holzinger und Angermeyer, 2003; Classen und Priebe, 2003; Böcker, 1996). Hierzu lassen sich auch nur wenige aktuellere Artikel und Bücher finden.
Die Erforschung der Nutzerzufriedenheit (consumer satisfaction research) oder Nutzerperspektive (Patient´s view) wird heute aber grundsätzlich sehr ernst genommen. Mittlerweile gibt es auch für die Psychiatrieversorgung national und international verschiedene Studien zur Patientensichtweise. Hier soll eine kleine Auswahl einen kurzen Einblick geben: Spießl et al, 2006; Tomozei, 2006; Hartmann, 2006; Krüger und Schmidt-Michel, 2005; Gutknecht, 2005; Henderson et al, 2003; Crawford et al, 2003; Müller-Leimkühler, 2003; Kallert und Schützwohl, 2002; Müller et al, 2002; Schanz et al, 2001; Ring, 2001; Howard, et al 2001; Barak et al, 2001; Fähndrich und Pieters, 2001; Dreier und Hartmann, 2000; Swoboda et al 2000; Berghofer et al, 2000; Keller et al, 2000; Oermann, 1999; Rentrop et al, 1999; Jungkunz et al, 1999; Fähndrich und Smolka, 1998; Messner und Lewis, 1996; Böcker, 1996; Bjoerkman et al, 1995; Gruyters, 1995; Seligman; 1995.
Allerdings befassen sich diese Studien meist mehr mit der medikamentösen Therapie, mit Diagnosegruppen, Lebensqualität, Stigma, Krankheitskonzepte, allgemeine Krankenhausbehandlung, oder mit der Auswertung eines bestimmten Konzeptes sowie der allgemeinen Gesundheitsentwicklungen in der Therapie (vgl. auch Holzinger und Angermeyer 2002; 2003). Sehr selten oder nur indirekt stehen Aspekte des Stationsmanagements bzw. der Arbeitsorganisation, der Stationsstrukturen, der Prozessgestaltung oder Prozessqualität sowie der Organisation und des Managements der therapeutischen Angebote und Beziehungen, des therapeutischen Milieus, o. ä. im Zentrum der Untersuchungen. Das Interesse des Stationsmanagements bzw. des Managements im Gesundheitswesen zur Patientenzufriedenheit und zu Patientenerwartungen sowie an entsprechenden Konsequenzen zur patientenzentrierten Verbesserung der Stationsstrukturen und –abläufe wie auch der Arbeitsorganisation und Prozessqualität scheint gering. Des Weiteren befassen sich diese Studien selten mit Patienten der Akutpsychiatrie und deren Therapiemanagement. Überwiegend sind es Tageskliniken, Stationen der Psychosomatik oder Einrichtungen der ambulanten Versorgung, deren Patienten befragt wurden. Zudem fällt auf, dass alle diese genannten Studien eine quantitative Methode nutzen. Qualitative Untersuchungen in diesem Bereich sind selten (Tschinke, 2006; Baer, 2003; Jungbauer et al, 2002).
Aus den wenigen Studien, in denen Therapieelemente oder therapeutische Relevanz bzw. Wirksamkeit diskutiert wurden, ergab sich, dass erstens die professionell Tätigen eher eine andere Einschätzung der Notwendigkeit von Angeboten und Bedürfnissen haben, als die Betroffenen, dass diese aber sehr genaue Vorstellungen davon haben, was sie sich wünschen (Hahnefeld und Kallert, 2005; Krüger und Schmidt-Michel, 2005; Fleischmann, 2003; Lasalvia et al, 2000; Böcker, 1996). Wenn nach Tagesablauf und Organisationsstrukturen gefragt wurde, ergaben sich auch hier angemessene Kritikpunkte aus Patientensicht (Eichler et al, 2006). Insgesamt zeigt sich damit deutlich, dass auch Psychiatriepatienten und –patientinnen befragbar sind (Siegrist et al, 2002; Babiker und Thorne, 1993). Dies kann in der Regel auch für Patienten und Patientinnen der Akutpsychiatrie angenommen werden.
In den wenigen der o.g. Untersuchungen, die erfragten, was den Nutzern und Nutzerinnen denn wichtig sei bzw. was sie sich wünschen oder was sie an der Behandlung positiv bewerteten, ergab sich, dass die Nutzer und Nutzerinnen insgesamt viel Wert auf angemessene Kommunikation und Beziehung, Gesprächs- und Psychotherapie, Information und Beteiligung sowie Aktivität und reflexive Auseinandersetzung legen.
In der bekannten Fachliteratur bzw. in Lehrbüchern über Forschungsmethoden in der Psychiatrie werden qualitative Methoden und Studien zur Nutzerperspektive nicht erwähnt. Es finden sich auch keine Inhalte zur Arbeitsorganisation oder der Organisation des Therapiemanagements in der Psychiatrie. Zum Stationsmanagement in der Psychiatrie ist auch wenig bis keine (insbes. medizinische und psychologische) Literatur zu finden.
1.4 Die Organisationstheorie
Organisationen sind soziale Gebilde, die gewissen Funktionen, Zielen und Aufgaben verbunden sind sowie Systeme von menschlichen in Beziehung befindlichen Rollen (Remer und Hucke, 2007; Giddens, 1999). Organisation kann dabei als Institution, instrumentelles Regelsystem zur Verfolgung gemeinsamer Ziele der Organisationsmitglieder oder als Tätigkeit bzw. Prozess zur Entstehung von Ordnung gesehen werden (Bea und Göbel, 2006). Organisation ist in instrumenteller Hinsicht somit die Koordination, Zusammenführung und arbeitsteilige Erfüllung von Aufgaben zwischen Einzelpersonen (interpersonelle Arbeitsteilung), Institutionen (inter-institutionelle Arbeitsteilung) und Nationen (internationale Arbeitsteilung). Dabei geht es um Effektivität (Zielerreichung) und Effizienz (Ressourcenersparnis) sowie um eine möglichst reibungslose und erfolgreiche Abwicklung der arbeitsteiligen Leistungsprozesse (Reichwald und Möslein, 1999).
Allgemein werden Organisationstheorien in unterschiedliche Ansätze eingeordnet. Es gibt demnach z. B. strukturorientierte oder handlungsorientierte Ansätze sowie evolutionstheoretische, institutionsökonomische, situative, systemische, humanistische, verhaltenswissenschaftliche, tayloristische, bürokratische Ansätze (Kieser und Ebers, 2006; Bea und Göbel, 2006; Weik und Lang, 2005; Sanders und Kianty, 2006).
In den letzten Jahren entwickelten sich eine Reihe neuerer Organisationsmodelle, in denen die Verteilung von Kompetenzen, Aufgaben, Verantwortungen, etc. sowie die Organisation bzw. Steuerung und Koordination von Abläufen, Prozessen, Methoden, etc. anders erfolgt und gedacht wird, als in bisherigen traditionelleren Modellen. Demnach wird aktuell eher der Blickwinkel auf soziale Systeme, Interaktion und Kooperation sowie auf Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Schnittstellenminimierung, minimale Arbeitsteilung, Prozessorientierung, minimale Koordination und flache Hierarchien gelegt (Bea und Göbel, 2006).
Das Menschenbild beeinflusst die Organisationsgestaltung, -entwicklung, etc. sowohl in der Ausübung des Managements bzw. der Teamführung, wie auch gegenüber den Kunden und Kundinnen, Klienten und Klientinnen, Patienten und Patientinnen, etc. Auch Aspekte, wie Geschlecht, Kultur, Alter und Sozialisation haben Einfluss auf die Organisation (Kutschenbach, 2004; Kirchler et al, 2004; Tergeist, 2001b).
1.4.1 Das Krankenhaus als soziale Organisation
Wird das Krankenhaus als soziale Organisation betrachtet, in der Menschen interagieren und in Beziehung treten, so folgt daraus z. B. dass die Organisation in Abhängigkeit von den wechselseitigen Handlungsweisen der Organisationsmitglieder steht sowie die Handlungsweisen abhängig von den agierenden Personen sind. Des Weiteren besteht das Krankenhaus als Organisation in einer sozialen Umwelt und steht in Beziehung zu anderen Organisationen, so dass auch eine wechselseitige Abhängigkeit in der Interaktion der sozialen Gebilde untereinander besteht (Aderhold, 2003).
Die soziale Struktur einer Organisation bezieht im Krankenhaus nicht allein die Angestellten sondern auch die Nutzer und Nutzerinnen mit ein (Schroeter, 2006). Weiterhin besteht die Organisationskultur in ihrer sozial geprägten Struktur aufgrund von Traditionen und historischen Entwicklungen (Krankenhaus als geschichtliches Gebilde) auch aus sehr unterschiedlichen Professionskulturen (Stratmeyer, 2002). Professionskulturen beeinflussen das Handeln der Organisationsmitglieder sehr stark. Auch die Beziehungen der Organisations- und Professionsmitglieder untereinander (informelle Organisation) hat erheblichen Einfluss auf deren Handeln (Simonovich, 2005).
Die Organisation Krankenhaus als soziales System befasst sich insbesondere in sozio-technischer Hinsicht mit der Gestaltung, Problemlösung und Lenkung im System und dessen Subsystemen (Organisationseinheiten, Abteilungen, etc.) (Aderhold, 2003).
Das Krankenhaus als Organisationssystem bedeutet auch, die Rollen in der Organisation zweckmäßig zu verteilen sowie zu interpretieren, um sämtliche Mittel der Organisation effektiv, effizient und zielgerichtet optimal einsetzen zu können (Remer und Hucke, 2007). Dabei wird aufgrund von Erwartungen der Sinnbereich und die Handlungssicherheit in der jeweiligen Aufgabe und Rolle festgelegt (formale, informale, funktionale, personale, normative und kognitive Erwartungen) (Aderhold, 2003).
Krankenhäuser und ihre Subsysteme müssen in diesem Zusammenhang als sehr komplexes, dynamisches und offenes System mit funktionaler Bestimmung mit einer Vielfalt an Gestaltungs- und Organisationsmöglichkeiten (Martens und Ortmann, 2006; Bea und Göbel, 2006).
Im sozialen System Krankenhaus sind auch weitere Begrifflichkeiten von Relevanz, wie z.B. kollektives Handeln, Human Relations, Selbstorganisation, Kontextfaktoren (Situation), lernendes System (Bea und Göbel, 2006; Kieser, 2006a; 2006b; Sanders und Kianty, 2006; Pawlowsky und Geppert, 2005).
1.4.2 Organisationales Handeln
Organisationen handeln durch das Handeln ihrer Organisationsmitglieder. Diese handeln in der und für die Organisation. So ist eine Organisation stets in Handlungsprozesse involviert. Dadurch ist eine Organisation aber auch stets Entwicklungen und Veränderungen unterworfen, da sich das Handeln der Organisationsmitglieder stets verändert. Zugleich ist das organisationale Handeln allerdings auch abhängig von Veränderungen, damit sich die Funktionen, Ziele und Aufgaben der Organisation ständig erfüllen lassen bzw. den aktuellen Anforderungen angepasst sind (Remer und Hucke, 2007; Bea und Göbel, 2006; Hartmann, 2005).
Das organisationale Handeln steht in Abhängigkeit zur Umwelt. Die von außen gegebenen Anforderungen, z .B. durch Kunden, Politik, Wettbewerb, Wissenschaft, etc.. Dadurch befindet sich eine Organisation immer in Organisationsentwicklung und –gestaltungsprozessen. Dazu gehören u.a. Aspekte wie Lernende Organisation, Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, lebendige Organisation, Mitarbeiterorientierung, Prozessorganisation, Arbeitsprozessgestaltung, Ablauforganisation, Qualitätsmanagement, etc. (Olfert und Steinbuch, 2006; HInterhuber und Matzler, 2006; Hartmann, 2005; Bekman, 2003; Blum, 2000).
In Krankenhäusern bezieht sich die so genannte Kundenorientierung auf die Patienten und Patientinnen sowie deren Angehörige als Nutzer und Nutzerinnen. Die diesbezüglichen Bedarfe und Bedürfnisse sind sehr vielfältig durch u.a. gesundheits-, kultur-, geschlechts- , alters-, lebensform- und gewohnheitsbezogene Faktoren bestimmt. Die Lern- und Entwicklungsbedarfe der Organisation sind u.a. durch die fachlichen sowie den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen in ihrer wissenschaftlichen Aktualität geprägt. Die Arbeitsorganisation in Krankenhäusern bezieht sich auf so genannte patientenferne und –nahe bzw. bezogene Arbeitsprozesse, gesundheits- und personenbezogene Dienstleistungen sowie Interventionen im interdisziplinären bzw. multiprofessionellen diagnostischen und therapeutischen Prozess (Stratmeyer, 2002; Thiele, 2002; Braun, 1999; Borsi, 1997).
1.4.3 Organisation Psychiatrie
Krankenhäuser und speziell psychiatrische Kliniken können aufgrund ihrer Eigenschaft der Isolierung der Patienten und Patientinnen von der Außenwelt nach Goffman (s.a. Giddens, 1999) auch unter dem Blickwinkel einer so genannten totalen Institution (Kerkerinstitution) betrachtet werden. Totale Institutionen sind demnach u. a auf Überwachung, Disziplin, organisationszentrierte Strukturen, etc. anstatt auf eher patienten- oder genesungszentrierte Strukturen, etc. ausgerichtet (Giddens, 1999). Hier wird das Klischee der Verwahrpsychiatrie und der Bevormundung bzw. der Entmündigung und Isolierung erkennbar.
Die Organisation Psychiatrie bzw. psychiatrische Klinikabteilung o. ä. sowie ihrer Suborganisationen (Stationen, Organisationseinheiten, Institute, etc.) bezieht sich (s.o.) eher auf abstraktere oder schwer messbare Aspekte, wie Beziehung, Kommunikation, Interaktion, sowie Denken, Fühlen, Handeln, Erleben, Wahrnehmen, Wollen, Können. Somit bezieht sich auch das organisatorische Handeln sowie die Arbeitsorganisation und die Intervention im Therapiemanagement auf solche abstrakteren Aspekte. Zugleich muss sie sich aber auch mit Aspekten wie Gewalt, Aggression, Regression, Sicherheit und Schutz befassen.
[...]
- Quote paper
- Dipl.-Berufspäd. für Pflegewissenschaft, MPH Arne Mahler (Author), 2008, Das pflegerische Therapiemanagement in der klinischen Akutpsychiatrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195989