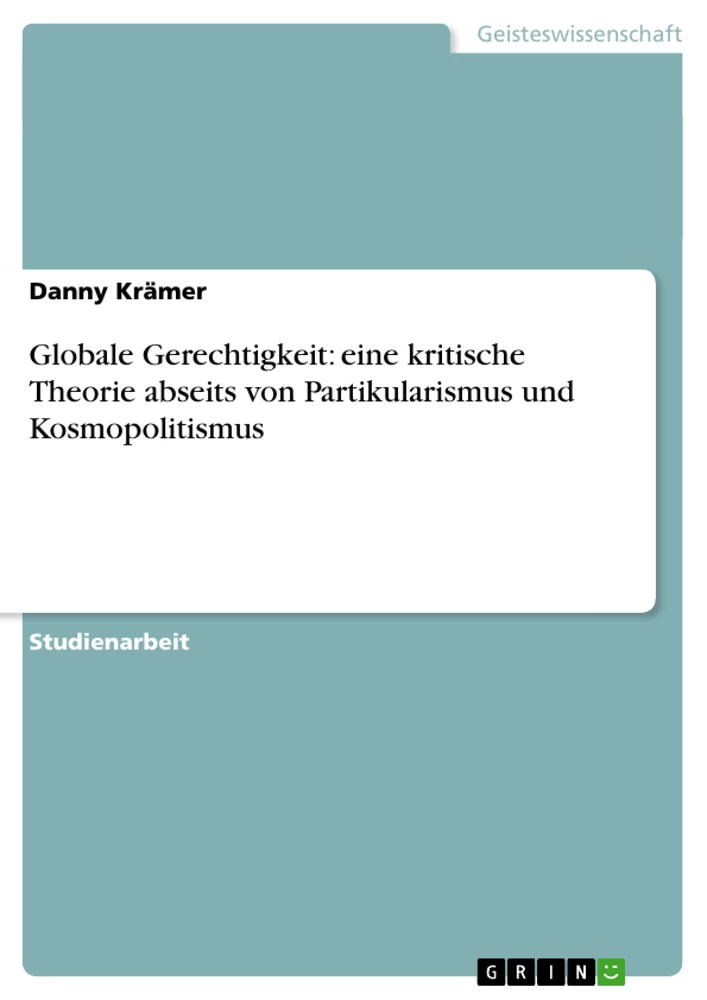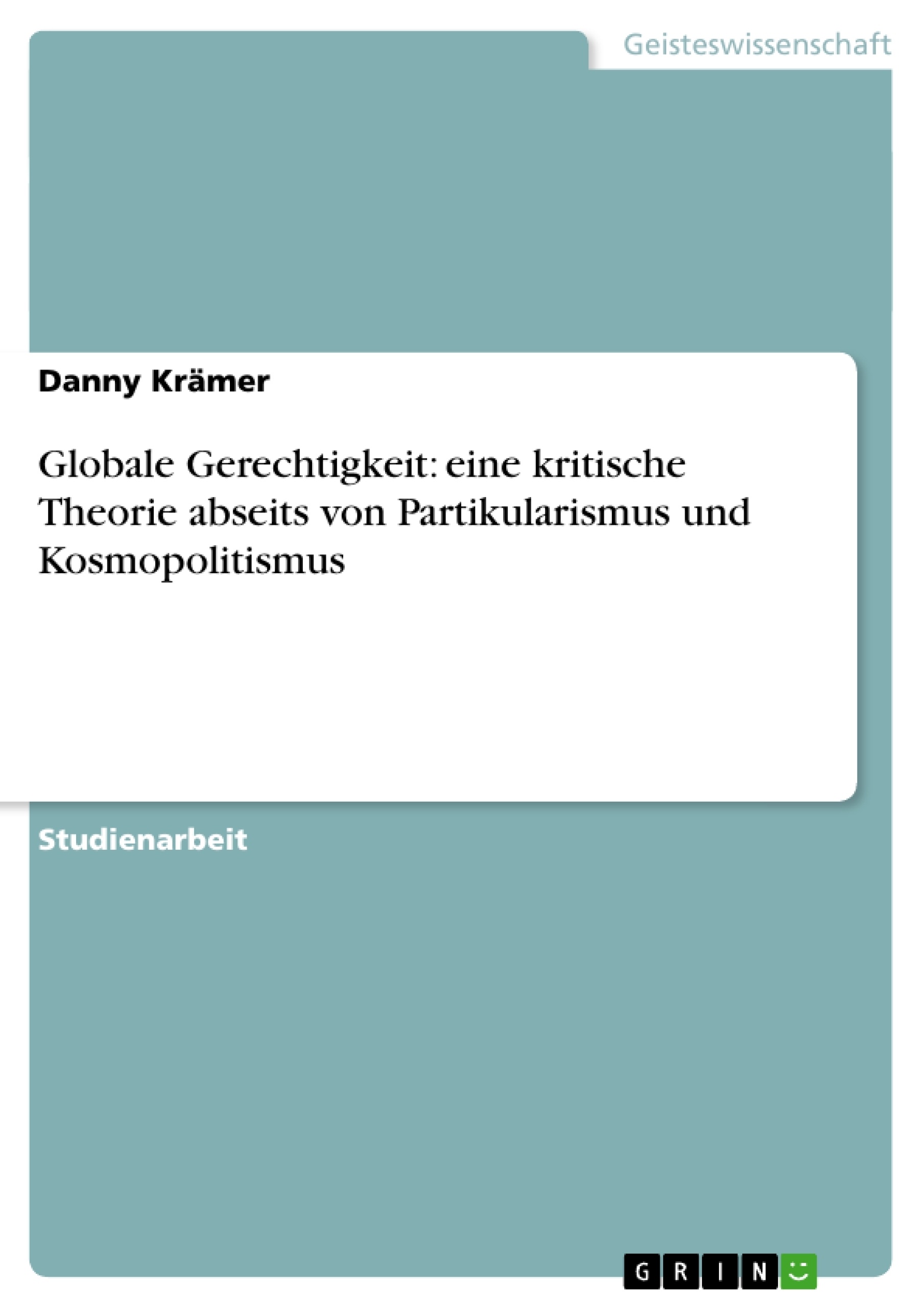Die Arbeit präsentiert kurz die beiden Hauptrichtungen in der Debatte der globalen Gerechtigkeit und stellt anschließend eine kritische Alternative dar.
Globale Gerechtigkeit: eine kritische Theorie abseits von Partikularismus und Kosmopolitismus
I. Partikularismus vs. Kosmopolitismus
Das Thema der globalen Gerechtigkeit ist eines der neueren Themen in der Philosophie. Mit der Globalisierung und der damit verbundenen Ausdehnung sozialer Kontexte, auch über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus, entstanden globale Interdependenzen, die ein erhebliches Maß dazu beitragen, dass es Unterschiede zwischen den Ländern, vor allem der Industrienationen und den Ländern der Dritten Welt, in Sachen Einkommen, Gesundheitsversorgung, Bildung usw. gibt. Spätestens seit Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ stellt man sich die Frage, in welchem Maße Gerechtigkeitsansprüche globale Zusammenhänge betreffen. Daraus entwickelte sich eine lebendige Diskussion. Die
Fronten liegen hier vor allem zwischen Partikularisten und Kosmopolitisten. Henning Hahn fasst die beiden Denkrichtungen folgendermaßen zusammen1:
Der Kosmopolitismus geht davon aus, dass der Kontext für Gerechtigkeitsansprüche ein globaler ist. Er definiert für ihn drei Kriterien:
a. Normativ geht er von einem moralischen Universalismus aus, für den alle Menschen überall und gleichermaßen von letzter moralischer Wichtigkeit sind.
b. Methodisch gründet er auf einem legitimatorischen Individualismus. Das bedeutet, dass alle Herrschaftsverhältnisse, also alle Praktiken, Regeln und Institutionen, die unvermeidlich und gravierend in das Leben einer Person eingreifen, gegenüber jeder betroffenen Person gerechtfertigt werden müssen.
c. Politisch vertritt er eine bestimmte Version legitimer globaler Herrschaft, die dazu dienen soll, bestehende Strukturen globaler Herrschaft zu reformieren oder globale gerechtigkeitssichernde Institutionen neu einzurichten.
Partikularisten behaupten stattdessen, dass Gerechtigkeitsansprüche nur auf spezielle Domänen der Gerechtigkeit beschränkt sind. Auch für sie gibt er drei Merkmale an:
a. Normativ verteidigt er die partikularistische Prioritätsthese. Das heißt, er geht davon aus, dass im Falle konfligierender nationaler und globaler Gerechtigkeitsprinzipien die eigenen Mitbürger Vorrang genießen.
b. Konzeptionell ist er darauf festgelegt, dass sich die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nur mit Blick auf besondere Beziehungsformen stellt; es ließe sich hierbei von gerechtigkeitskonstitutiven Beziehungen sprechen, die nicht alle Menschen, sondern ausschließlich Mitglieder desselben Staates (Etatismus), derselben Nation (Nationalismus), Gemeinschaft (Kommunitarismus) oder Machtordnung (Machtrealismus) teilen.
c. Schließlich vertritt er die empirische These, dass sich auf globaler Ebene keiner dieser gerechtigkeitskonstitutiven Beziehungen, vor allem keine staatsanaloge Form globaler Herrschaft und Souveränität, herausgebildet hat oder auch nur herausbilden könnte, die Forderungen der Gerechtigkeit auslöst bzw. rechtfertigt.
Im Folgenden soll am Beispiel von Thomas Pogges Essay „“Armenhilfe“ ins Ausland““ sowohl eine bekannte partikularistische Theorie, nämlich die John Rawls, als auch eine kosmopolitische, Pogges eigene, kurz skizziert werden, um zu zeigen um welche Probleme sich diese Diskussion dreht. Außerdem wird die Verschiebung der Perspektive von politischen Institutionen auf soziale Strukturen, am Beispiel von Iris Marion Youngs Modell sozialer Verbundenheit, erläutert. Daraufhin soll eine kritische Alternative angeboten werden, die versucht die beiden Positionen zu verbinden und über sie hinaus zu denken. Ansätze die dabei von strukturellen Machtrelationen, als die Ursache globaler Ungerechtigkeit ausgehen, finden sich bei Rainer Forst. Diese Perspektive wird zum Schluss auf ein Beispiel aus Thomas Pogges Text angewandt, um zu zeigen, wie verschiedene Analyseebenen verbunden und die Ursachen für Ungerechtigkeit auf strukturelle Machtrelation zurückgeführt werden können.
II. John Rawls und die RIAT
John Rawls entwickelte seine Vorstellungen zur globalen Gerechtigkeit vor allem in seinem Buch „Das Recht der Völker“. Thomas Pogge nennt den Ansatz den Rawls vertritt, den der „rein innerstaatlich verursachten Armut“, kurz RIAT.2 Rawls führt in „Das Recht der Völker“ ein Rechtsprinzip ein, dass das Problem der globalen Gerechtigkeit lösen soll: „Völker sind verpflichtet, anderen Völkern zu helfen, wenn diese unter ungünstigen Bedingungen leben, welche verhindern, dass sie eine gerechte oder achtbare politische und soziale Ordnung haben.“3 Pogge kritisiert, wie ich denke zu Recht, dass diese Konzeption, die Rawls aus seinem internationalen Urzustand ableitet nicht ausreiche. Er erklärt, dass es zwar wahrscheinlich sei, dass die Repräsentanten der einzelnen Völker sich in Notzeiten helfen, allerdings nicht, dass sie dies auch außerhalb Notzeiten tun würden und vor allem Völkern die nie eine liberale oder achtbare institutionelle Ordnung besaßen.4 Wie sich in der Realität zeigt, leben die Menschen denen es am schlechtesten geht, oft weder in liberalen noch achtbaren institutionellen Ordnungen. Diese Menschen würden in Rawls Urzustand keine Beachtung finden. Rawls geht es also nur um ein absolutes Ziel, nämlich dass kein Volk durch Armut darin gehindert wird, eine liberale und achtbare institutionelle Struktur aufzubauen. Relative Ziele die darüber hinausgehen, lehnt Rawls strikt ab. Das begründet er in der Autonomie der Staaten. Sie können selbst entscheiden, wie weit sie für Wohlstand sorgen oder eben auch nicht. Doch auch daraus wird nicht klar, warum es nicht möglich sein sollte, einen internationalen institutionellen Kontext zu schaffen, der dafür sorgt, dass arme Länder unterstützt werden. Vor allem wenn man bedenkt, dass globale Interdependenzen zunehmen und die Rohstoffverteilung der einzelnen Länder sehr unterschiedlich ausfällt. Rawls scheint aber fest davon überzeugt, dass die Ursache der Armut einzelner Länder, in den kulturellen und innerstaatlichen Bedingungen der Länder liegt.5 Diese Behauptung lässt sich heute nur noch schwer verteidigen. Es stellen sich schwierige Fragen: Es gibt oft unterschiedliche Entwicklungen bei Ländern, die kulturell auf einer ähnlichen Voraussetzung aufbauen. Wie verhält es sich mit Ländern, die mehr und mehr multikulturell geprägt sind? Warum sind gerade Exkolonien besonders stark von Armut betroffen? Ist das wirklich ihr eigenes innerstaatliches Verschulden?
[...]
1 Entnommen aus: Christoph Broszies, Henning Hahn, „Die Kosmopolitismus-Partikularismus-Debatte im Kontext“, in: Globale Gerechtigkeit - Schlüsseltexte zur Debatte zwischen Partikularismus und Kosmopolitismus, hg. von Christoph Broszies und Henning Hahn, Berlin 2010, S. 10 f.
2 Vgl͘ Thomas Pogge, „“ rmenhilfe“ ins usland“ in: Globale Gerechtigkeit - Schlüsseltexte zur Debatte zwischen Partikularismus und Kosmopolitismus, hg. von Christoph Broszies und Henning Hahn, Berlin 2010, S. 263 f. [im Folgenden: Pogge, 2010]
3 John Rawls, „Das Recht der Völker“, Berlin 2002, S͘ 41 [im Folgenden: Rawls, 2002]
4 Vgl. Pogge, 2010 S. 264 f.
5 Vgl. Rawls, 2002 S. 134
- Quote paper
- Danny Krämer (Author), 2012, Globale Gerechtigkeit: eine kritische Theorie abseits von Partikularismus und Kosmopolitismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195949