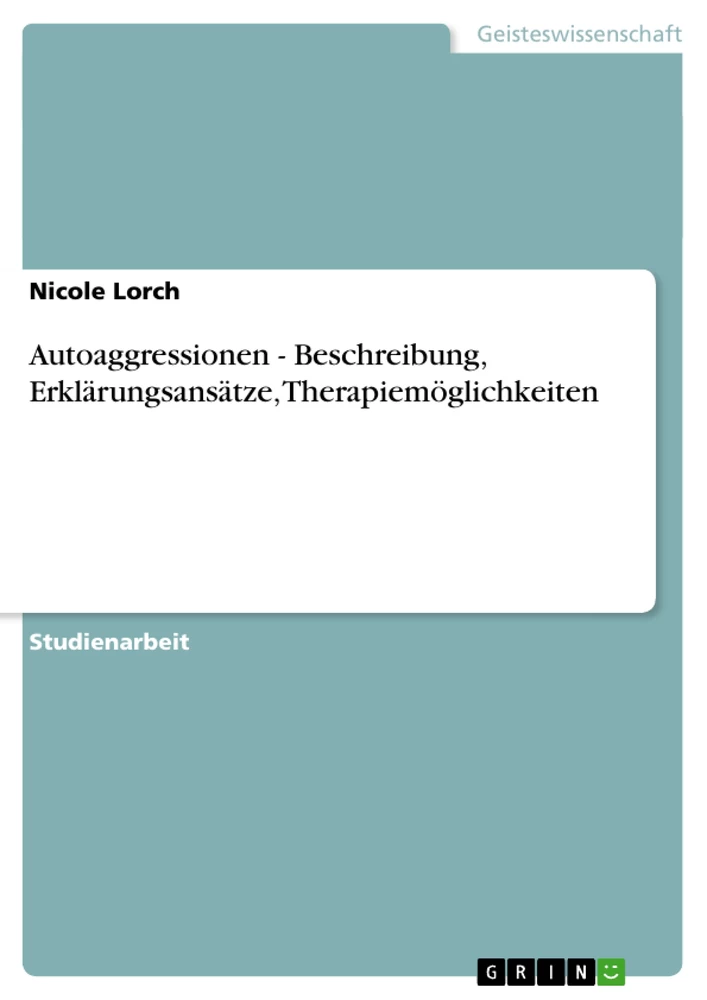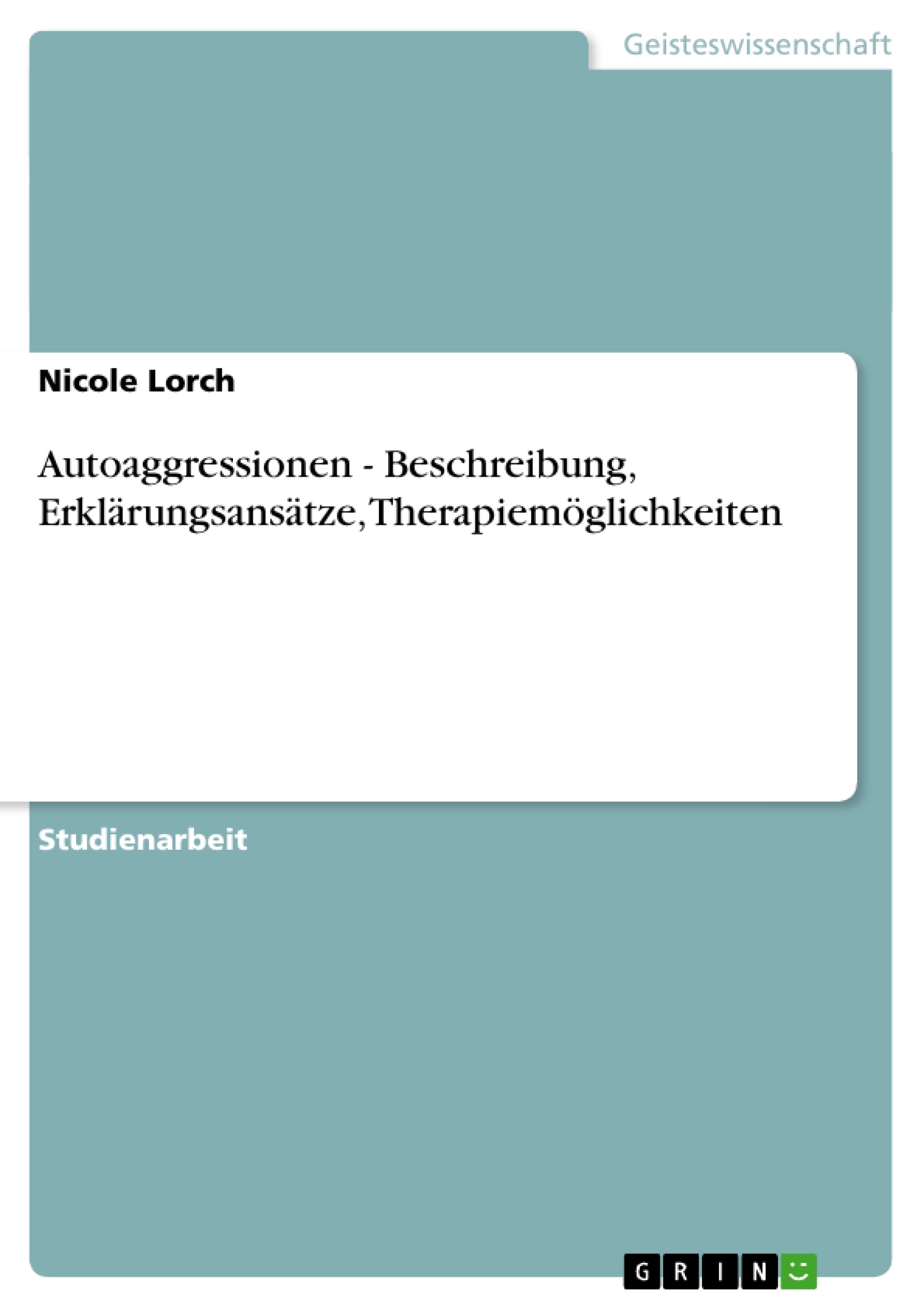"Wenn Du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt Du von den Schmerzen, die in mir sind, und was weiß ich von Deinen. Und wenn ich mich vor Dir niederwerfen würde und weinen und erzählen, was wüsstest Du von mir mehr als von der Hölle, wenn Dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich. Schon darum sollten wir Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich (...) stehen, wie vor dem Eingang zur Hölle." (Franz Kafka) Autoaggressionen bzw. Selbstverletzendes Verhalten gehören wohl zu den erschreckendsten Verhaltensweisen, insbesondere dann, wenn es bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Dieses Verhalten löst in der Umwelt Gefühle wie Entsetzen, Unverständnis und Ohnmacht, aber auch Erbarmen, Ablehnung, Mitgefühl und Distanzierung aus. Oftmals wird auch nicht verstanden, warum es zu diesen Selbstverletzungen kommt, viele sind der Meinung, dass Kinder und Jugendliche, die dieses Verhalten aufzeigen, versuchen sich selbst umzubringen und es nur nicht "geklappt" hat. In unserer Gesellschaft haben Aggressionen nur wenig Raum, sie müssen unterdrückt oder in anderen Handlungen sublimiert werden. Selbstverletzungen werden überwiegend heimlich, im "stillen Kämmerlein", vollzogen. Aufgrund dessen gibt es nur wenig gesicherte Daten über Auftretenshäufigkeit und die Verteilung. Jedoch wird in der Literatur immer wieder die signifikante Häufigkeit bei Mädchen bzw. Frauen erwähnt.
Dazu muss man sagen, dass es in der Geschichte der Menschheit zu jeder Zeit Personen gegeben hat, die sich selbst Schaden zufügten, meist jedoch im Stillen. Entdeckungen wurden entweder verurteilt oder totgeschwiegen. Heute gibt es immerhin Ansätze, dieses gesellschaftliche Problem ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und Verständnis für die betroffenen Jugendlichen zu wecken. Die landläufigen Meinungen und meine Erfahrungen in der Praxis brachten mich dazu, dieses Thema als Hausarbeitsthema aufzugreifen. In dieser Arbeit möchte ich das Hauptaugenmerk auf das Verhalten "normaler" Menschen richten, da eine Ausweitung auf alle Gruppen, wie zum Beispiel Autisten, zu weit führen würde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beschreibung und Definition
- 2.1 Definition
- 2.2 Klassifizierung
- 2.3 Erscheinungsformen/ Phänomenologie
- 2.4 Auftretungshäufigkeit/ Epidemiologie
- 2.5 Diagnose
- 3. Erklärungsansätze
- 3.1 Biologischer Ansatz
- 3.2 Lerntheoretischer Ansatz
- 3.3 Psychoanalytischer Ansatz
- 3.4 Entwicklungspsychologischer Ansatz
- 4. Ritzen
- 4.1 Ritzen typisch weibliches Verhalten? Oder weibliche Perversion?
- 4.2 Funktion und Dynamik
- 4.3 Die Selbstverletzungssituation
- 4.4 Auslöser
- 4.5 Intention
- 5. Ursachen/ Ätiologie
- 5.1 Menstruation
- 5.2 Sexueller Missbrauch
- 5.3 Körperliche Misshandlung
- 5.4 Deprivation/ emotionale Vernachlässigung
- 6. Therapiemöglichkeiten
- 6.1 Psychoanalytische Therapie
- 6.2 Körpertherapie
- 6.3 Gestaltungstherapie
- 6.4 Verhaltenstherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Autoaggressionen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, das Verhalten zu beschreiben, verschiedene Erklärungsansätze zu beleuchten und Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf „normalen“ Menschen, um den Umfang der Arbeit zu begrenzen.
- Definition und Klassifizierung von Autoaggressionen
- Biologische, lerntheoretische, psychoanalytische und entwicklungspsychologische Erklärungsansätze
- Häufigkeit und Erscheinungsformen von Selbstverletzungen, insbesondere Ritzen
- Ursachen und Auslöser von Autoaggressionen (z.B. Missbrauch, Deprivation)
- Möglichkeiten der Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Autoaggressionen ein und beschreibt die damit verbundenen gesellschaftlichen Reaktionen. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, gesicherte Daten zu erhalten, und betont die hohe Häufigkeit bei Mädchen und Frauen. Der Autor begründet die Wahl des Themas mit persönlichen Erfahrungen und der Notwendigkeit, das Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren und Verständnis zu fördern. Der Fokus der Arbeit wird auf "normale" Menschen gelegt.
2. Beschreibung und Definition: Dieses Kapitel liefert verschiedene Definitionen von Autoaggressionen aus der Fachliteratur. Es wird der Unterschied zwischen bewusster und automatisierter Selbstverletzung diskutiert, ebenso wie die verschiedenen Erscheinungsformen und die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Klassifizierung in der psychiatrischen Diagnostik (DSM-IV, ICD-10). Der Text differenziert zwischen verschiedenen Intensitäten und Formen der Selbstverletzung, von leichten bis hin zu lebensbedrohlichen Handlungen, und beschreibt den Unterschied zwischen offener und heimlicher Selbstverletzung.
3. Erklärungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Perspektiven zur Erklärung von Autoaggressionen. Es werden biologische, lerntheoretische, psychoanalytische und entwicklungspsychologische Ansätze vorgestellt und deren jeweilige Sichtweisen auf die Ursachen und die Dynamik selbstverletzenden Verhaltens erläutert. Der Abschnitt vergleicht und kontrastiert diese unterschiedlichen Perspektiven und liefert somit ein umfassendes Verständnis der komplexen Ursachen von Autoaggressionen.
4. Ritzen: Das Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Form der Selbstverletzung, das Ritzen. Es hinterfragt Klischees über geschlechtsspezifische Hintergründe und untersucht die Funktionen und die Dynamik dieser Handlung. Die Selbstverletzungssituation, Auslöser und die Intentionen hinter dem Ritzen werden detailliert analysiert, um das Verständnis dieser spezifischen Form der Autoaggression zu vertiefen.
5. Ursachen/ Ätiologie: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Faktoren, die zu Autoaggressionen beitragen können. Es werden Menstruation, sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und Deprivation/ emotionale Vernachlässigung als mögliche Ursachen detailliert untersucht und ihre Bedeutung im Kontext von Selbstverletzungen erklärt. Die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und dem Auftreten von Autoaggressionen werden umfassend dargestellt.
Schlüsselwörter
Autoaggressionen, Selbstverletzendes Verhalten, Ritzen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Psychoanalytischer Ansatz, Lerntheoretischer Ansatz, Entwicklungspsychologischer Ansatz, Therapiemöglichkeiten, Ätiologie, Epidemiologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Autoaggressionen bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Autoaggressionen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Sie beschreibt das Verhalten, beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze (biologisch, lerntheoretisch, psychoanalytisch, entwicklungspsychologisch) und zeigt Therapiemöglichkeiten auf. Der Fokus liegt auf "normalen" Menschen, um den Umfang der Arbeit zu begrenzen. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Arten von Autoaggressionen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Autoaggressionen im Allgemeinen, wobei ein besonderes Augenmerk auf das Ritzen gelegt wird. Es werden verschiedene Intensitäten und Formen der Selbstverletzung beschrieben, von leichten bis hin zu lebensbedrohlichen Handlungen, sowohl offene als auch heimliche Selbstverletzungen.
Welche Erklärungsansätze für Autoaggressionen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene theoretische Perspektiven, darunter biologische, lerntheoretische, psychoanalytische und entwicklungspsychologische Ansätze. Diese Ansätze werden verglichen und kontrastiert, um ein umfassendes Verständnis der komplexen Ursachen von Autoaggressionen zu liefern.
Welche Rolle spielt das Ritzen im Kontext der Autoaggressionen?
Dem Ritzen wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Es werden Klischees über geschlechtsspezifische Hintergründe hinterfragt, die Funktionen und Dynamik des Ritzens untersucht, sowie die Selbstverletzungssituation, Auslöser und Intentionen analysiert.
Welche Ursachen für Autoaggressionen werden diskutiert?
Als mögliche Ursachen werden Menstruation, sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und Deprivation/emotionale Vernachlässigung detailliert untersucht und deren Bedeutung im Kontext von Selbstverletzungen erklärt.
Welche Therapiemöglichkeiten werden aufgezeigt?
Die Arbeit nennt verschiedene Therapiemöglichkeiten, darunter psychoanalytische Therapie, Körpertherapie, Gestaltungstherapie und Verhaltenstherapie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Autoaggressionen, Selbstverletzendes Verhalten, Ritzen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Psychoanalytischer Ansatz, Lerntheoretischer Ansatz, Entwicklungspsychologischer Ansatz, Therapiemöglichkeiten, Ätiologie, Epidemiologie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Beschreibung und Definition von Autoaggressionen, Erklärungsansätzen, dem Ritzen als spezifische Form der Selbstverletzung, den Ursachen und schließlich den Therapiemöglichkeiten. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Autoaggressionen bei Kindern und Jugendlichen zu beschreiben, verschiedene Erklärungsansätze zu beleuchten und Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen. Sie soll zum Verständnis des Themas beitragen und die öffentliche Diskussion fördern.
- Citar trabajo
- Nicole Lorch (Autor), 2003, Autoaggressionen - Beschreibung, Erklärungsansätze, Therapiemöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19581