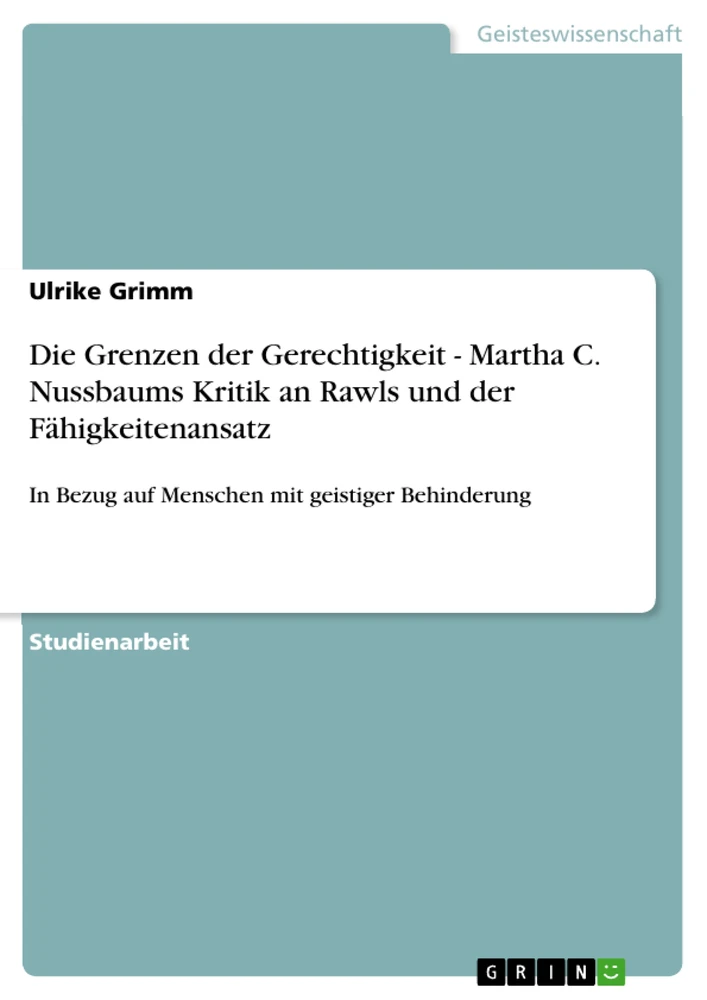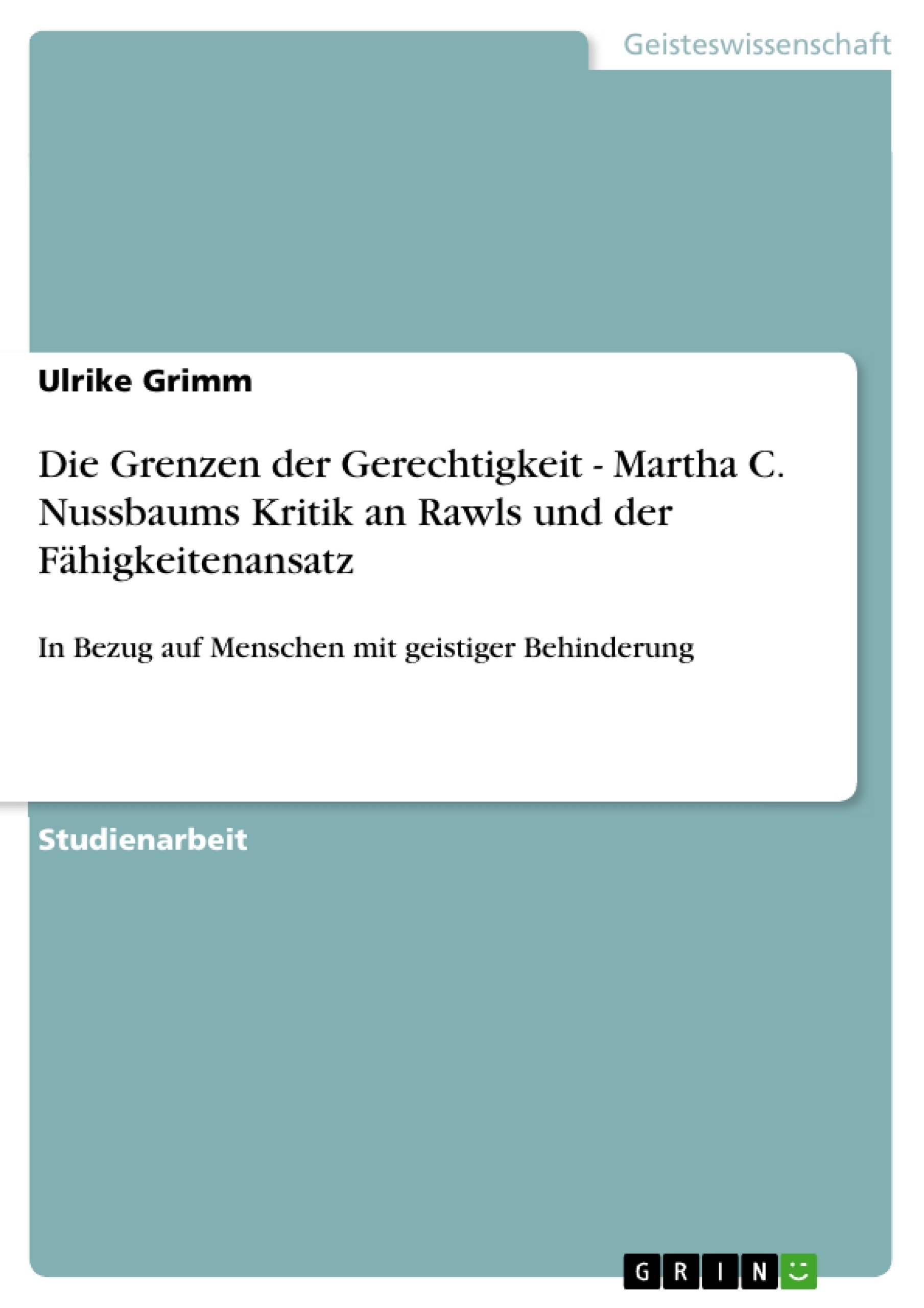Gerechtigkeit ist ein Schlagwort, das heutzutage in aller Munde ist. Rechtsphilosphisch gesehen ist die soziale Gerechtigkeit die zentrale Idee des Rechts überhaupt (vgl. Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2007, S. 851). Doch wie Gerechtigkeit tatsächlich aussieht wird sehr unterschiedlich definiert. Vertragstheorien üben hierbei einen großen Einfluss auf die Politik aus. Martha Nussbaum, amerikanische Philosophin, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch „Die Grenzen der Gerechtigkeit“ mit den Unzulänglichkeiten gängiger Vertragstheorien, insbesondere derer John Rawls, einer der bekanntesten zeitgenössischen Vertragstheoretiker. Nussbaum weist auf drei Bereiche hin, in denen die Theorie Rawls an ihre Grenzen gelangt: Dies umfasst zum einen Menschen mit Behinderung, die Beziehungen von Staaten bzw. die nationale Zugehörigkeit sowie der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies, also den Umgang mit Tieren und Pflanzen. Rawl selbst hat diese Probleme benannt, Martha Nussbaum geht ihnen nun nach. Mit dem mit Amartya Sen entwickelten Fähigkeitenansatz (capability approach), den sie überträgt und erweitert, so dass er nicht mehr nur ökonomisch ausgelegt wird, schlägt sie eine andere Sichtweise vor, die diese Probleme lösen soll.
Diese Arbeit geht der Frage nach, inwiefern diese Thesen haltbar sind. Nussbaum belegt ihre Annahmen anhand einiger Beispiele von Menschen mit geistiger Behinderung, die in den USA leben. Diese Arbeit wird ebenfalls überprüfen, ob diese auf einen Menschen mit geistiger Behinderung, der in Deutschland lebt, übertragbar und daher global sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Martha Nussbaums Kritik an Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness
- Überprüfung der Kritik von Martha Nussbaum anhand eines Fallbeispiels
- Der Fähigkeitenansatz
- Überprüfung des Fähigkeitenansatz am Fallbeispiel des Herrn B.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Martha Nussbaums Kritik an John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Fairness und untersucht, inwiefern der von Nussbaum vorgeschlagene Fähigkeitenansatz die Kritikpunkte an Rawls' Theorie löst. Insbesondere wird der Fokus auf die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung gelegt.
- Nussbaums Kritik an Rawls' Theorie der Gerechtigkeit
- Die Vernachlässigung von Menschen mit Behinderung in Vertragstheorien
- Der Fähigkeitenansatz als alternative Sichtweise auf Gerechtigkeit
- Die Anwendung des Fähigkeitenansatzes auf Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Übertragbarkeit der Thesen auf den deutschen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Gerechtigkeit gegenüber Menschen mit Behinderung dar und führt in die Kritik von Martha Nussbaum an John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Fairness ein. Der Fähigkeitenansatz als alternative Lösung wird vorgestellt und die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
- Hauptteil: Der Hauptteil beleuchtet Nussbaums Kritik an Rawls' Theorie, insbesondere in Bezug auf die Vernachlässigung von Menschen mit geistiger Behinderung. Er analysiert die Kritikpunkte an Rawls' Gesellschaftsvertragstheorie und zeigt auf, wie Nussbaum mit dem Fähigkeitenansatz eine alternative Sichtweise auf Gerechtigkeit vorschlägt. Im weiteren Verlauf wird der Fähigkeitenansatz anhand eines Fallbeispiels eines Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland überprüft.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Behinderung, geistige Behinderung, Vertragstheorie, John Rawls, Martha Nussbaum, Fähigkeitenansatz, Capability Approach, Inklusion, Gesellschaft, Fairness, Würde, Respekt, Leistungsprinzip, Ökonomie, Moral, Fallbeispiel, Deutschland, USA
- Quote paper
- Ulrike Grimm (Author), 2012, Die Grenzen der Gerechtigkeit - Martha C. Nussbaums Kritik an Rawls und der Fähigkeitenansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195749