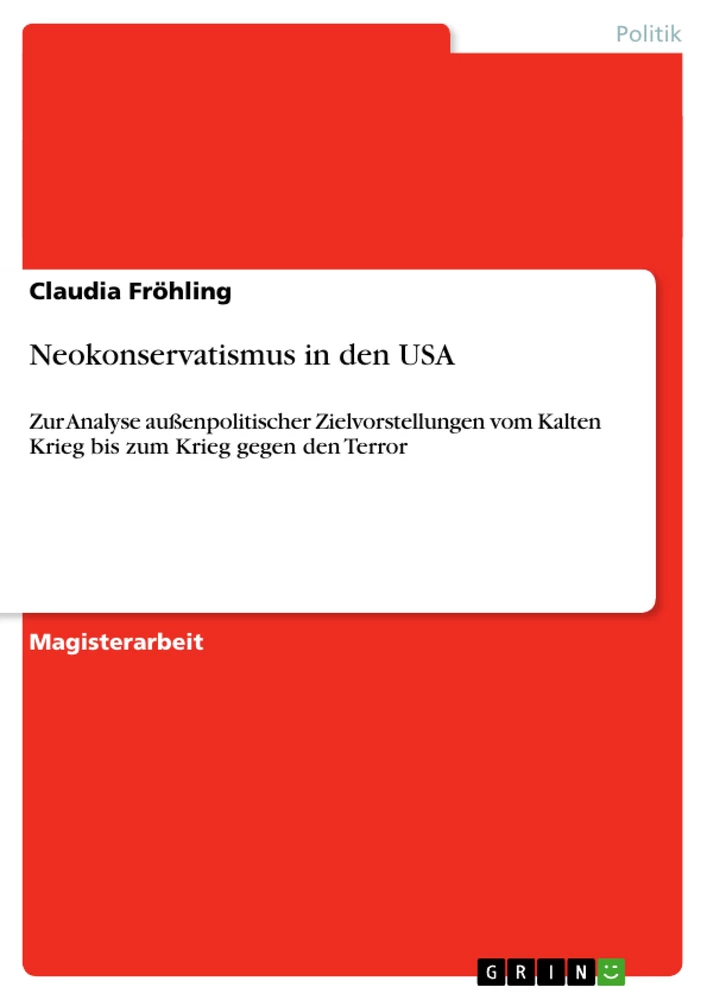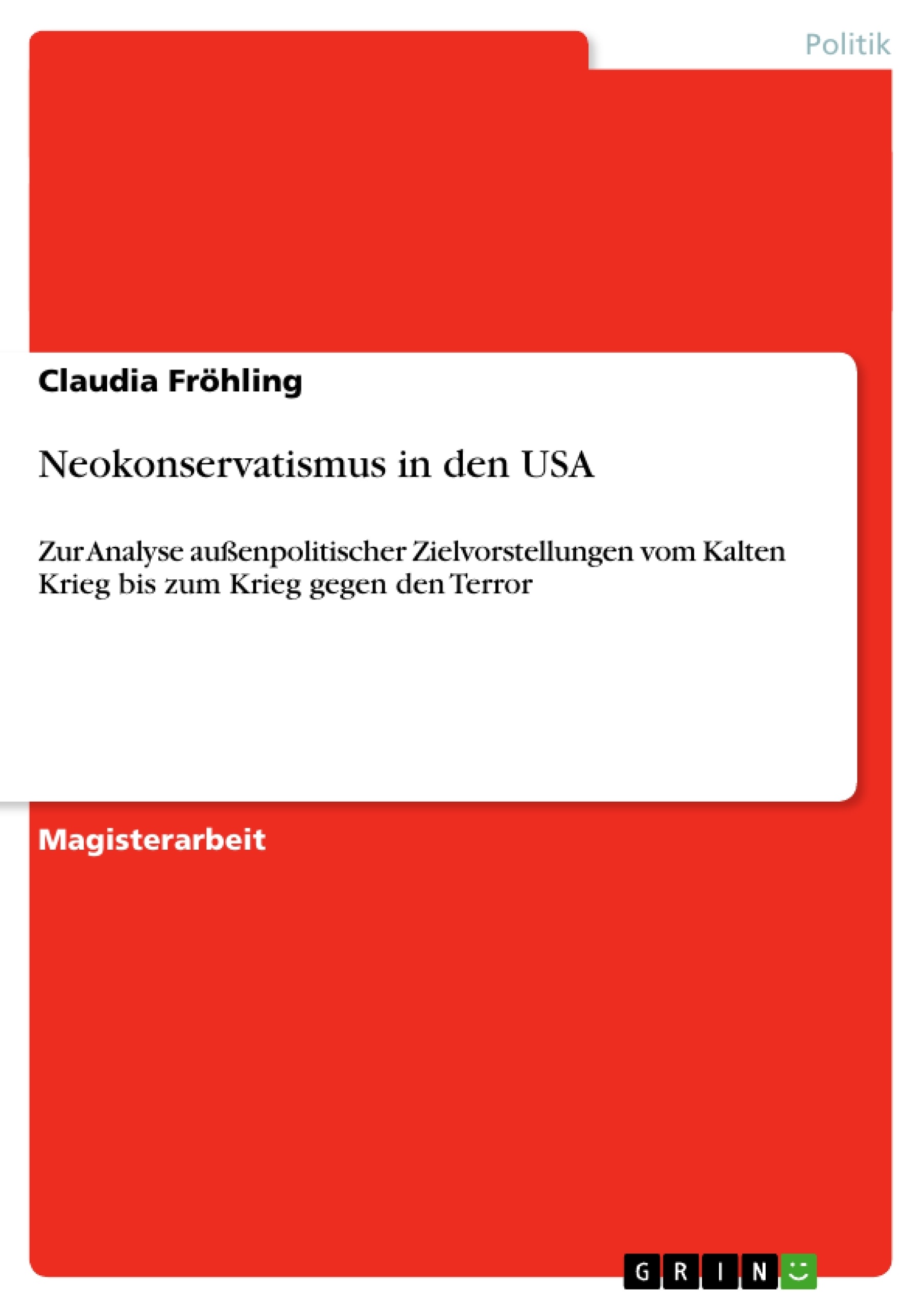Wer sich dem Thema Neokonservatismus nähert und erste Recherchen unternimmt, stellt schnell fest, dass sich um diese Bewegung viele Mythen ranken, manche wahr, die meisten aber schlicht übertrieben. Der Mythos, es handle sich bei den Neocons um eine „jüdische Lobby“, die im Weißen Haus die Interessen Israels vertritt, ist ebenso unwahr wie die Behauptung, nach dem 11.September 2001 habe eine „neokonservative Verschwörung“ die USA in den Irak-Krieg getrieben. Beschäftigt man sich eingehender mit dem Phänomen des Neokonservatismus, lassen sich die „Ammenmärchen“ schnell falsifizieren, und man stößt auf ein in höchstem Maße komplexes und heterogenes Gebilde. Der Neokonservatismus ist beispielsweise noch so jung, dass seine Gründungsväter noch am Leben sind und zum Teil noch ihre Meinung durch Buchveröffentlichungen oder Essays kundtun, wie es zum Beispiel bei Norman Podhoretz der Fall ist. Daneben steht eine zweite Generation von Neocons, die sich unter anderen politischen Rahmenbedingungen entwickelte als ihre Vorgänger. Wer den Neokonservatismus zum Gegenstand einer politikwissenschaftlichen Untersuchung macht, muss sich dieser Heterogenität stets bewusst sein. Da eine umfassende Behandlung den Rahmen einer Magisterarbeit sprengt, wurde das Thema auf die neokonservativen Zielvorstellungen einer amerikanischen Außenpolitik eingegrenzt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass der Neokonservatismus ursprünglich ausschließlich innenpolitische Themen diskutierte und sich die Ansichten der Neocons erst im Laufe der Sechziger Jahre internationalisierten. Diesem Wandel wird hier Rechnung getragen, indem als erster neokonservativer Text ein Artikel von Norman Podhoretz aus dem Jahre 1966 herangezogen wird, der quasi eine Brücke vom alten zum neuen Themenschwerpunkt schlagen soll. Ziel der Arbeit ist der Nachweis einer Kontinuität im neokonservativen Denken seit den späten Sechzigern bis heute. Zu diesem Zweck wird ein eigener Ansatz ausgearbeitet, welcher anschließend durch die Bearbeitung von Quellen verifiziert werden soll. Um welche Quellen es sich dabei handelt, wird im folgenden Kapitel erläutert. Am Ende der Magisterarbeit sollen neben der Hauptfrage, ob es eine Kontinuität im Denken der Neocons gibt, auch die Frage „nach der Henne und dem Ei“ beantwortet werden. Haben die Neocons die Geschichte beeinflusst oder waren sie immer „Kinder ihrer Zeit“?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorüberlegungen
- 1.1. Einleitung
- 1.2. Methodik und Forschungsstand
- 2. Zentrale Grundüberzeugungen
- 2.1. Was ist Neokonservatismus?
- 2.2. Versuch einer Definition: Drei-Plus-Zwei-Formel
- 2.2.1. Das erste Axiom: „Neo-Manifest Destiny“
- 2.2.2. Das zweite Axiom: „Battleship America“
- 2.2.3. Das dritte Axiom: „From Evil Empire to the Axis of Evil“
- 2.2.4. Das Reaktive Moment
- 2.2.5. Das interdependente Moment
- 2.3. Abweichende Meinungen
- 3. Zeitabschnitt I: Kalter Krieg bis 1989/90 - „Klar definiertes Feindbild Kommunismus“
- 3.1. Exkurs: Was zeichnet die Ära des Kalten Krieges aus?
- 3.2. Wichtige Köpfe der frühen Bewegung
- 3.2.1. Irving Kristol
- 3.2.2. Norman Podhoretz
- 3.3. Untersuchung der Drei-Plus-Zwei-Formel anhand der Quellen
- 3.3.1. Podhoretz, “My Negro Problem – And Ours”
- 3.3.2. Dreimal Podhoretz in Buchform
- 3.3.3. Kirkpatrick, „Dictatorships and Double Standard“
- 4. Zeitabschnitt II: Zwischen 1989/90 und 9/11 - „Der unipolare Imperativ“ oder „Saddam Must Go!“
- 4.1. Exkurs: Think Tanks in den USA
- 4.2. Die neue Generation von Neocons
- 4.2.1. Charles Krauthammer
- 4.2.2. William Kristol, Robert Kagan
- 4.3. Untersuchung der Drei-Plus-Zwei-Formel anhand der Quellen
- 4.3.1. Krauthammer, “The Unipolar Moment”
- 4.3.2. Feindbild Irak im Spiegel der Quellen
- 4.3.3. Kagan, „A Retreat From Power“
- 5. Zeitabschnitt III: Zwischen 9/11 und 2003 - „Neocons in Hochform“
- 5.1. Die „Vollstrecker“: Paul Wolfowitz, Richard Perle
- 5.2. Untersuchung der Drei-Plus-Zwei-Formel anhand der Quellen
- 5.2.1. Kristol / Kaplan, „War Over Iraq“
- 5.2.2. Offensive Kriegspropaganda
- 5.2.3. Wolfowitz' Forderung nach Präemption
- 6. Zeitabschnitt IV: Nach 2003: „Neocons in der Krise – Teilweiser Rückzug von oder stures Festhalten an alten Positionen?“
- 6.1. Einleitende Worte
- 6.2. Fukuyama, „Scheitert Amerika?“
- 6.3. Podhoretz, "World War IV"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die außenpolitischen Zielvorstellungen des Neokonservatismus in den USA vom Kalten Krieg bis zum Irakkrieg. Ziel ist der Nachweis einer Kontinuität im neokonservativen Denken. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der neokonservativen Ideologie und deren Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik. Die Heterogenität der Bewegung wird berücksichtigt.
- Kontinuität des neokonservativen Denkens
- Entwicklung der neokonservativen Ideologie
- Einfluss des Neokonservatismus auf die amerikanische Außenpolitik
- Analyse der "Drei-Plus-Zwei-Formel" als Definitionsansatz
- Vergleich verschiedener neokonservativer Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorüberlegungen: Dieses einleitende Kapitel räumt mit gängigen Mythen über den Neokonservatismus auf und betont die Komplexität und Heterogenität der Bewegung. Es definiert den Fokus der Arbeit auf die neokonservativen außenpolitischen Zielvorstellungen und begründet die Auswahl eines spezifischen Zeitraums sowie die Methodik der Quellenanalyse. Die Einleitung benennt die zentrale Forschungsfrage nach der Kontinuität im neokonservativen Denken und der wechselseitigen Beeinflussung von Ideologie und historischen Ereignissen. Die Methodologie wird vorgestellt, die darauf abzielt, schriftliche Äußerungen von anerkannten Neokonservativen und neokonservative Publikationen zu analysieren und in vier historische Zeitabschnitte zu kategorisieren.
2. Zentrale Grundüberzeugungen: Dieses Kapitel versucht, den Neokonservatismus zu definieren und entwickelt eine "Drei-Plus-Zwei-Formel", die zentrale Axiome und reaktive sowie interdependente Momente der Ideologie beschreibt. Es wird auf die verschiedenen Strömungen innerhalb der Bewegung eingegangen und abweichende Meinungen werden kurz vorgestellt. Die "Drei-Plus-Zwei-Formel" dient als analytisches Werkzeug für die folgenden Kapitel.
3. Zeitabschnitt I: Kalter Krieg bis 1989/90 - „Klar definiertes Feindbild Kommunismus“: Dieses Kapitel analysiert den Neokonservatismus während des Kalten Krieges. Es beleuchtet die wichtigsten Persönlichkeiten der frühen Bewegung wie Irving Kristol und Norman Podhoretz, deren Schriften und deren Rolle bei der Entwicklung des neokonservativen Denkens. Der Abschnitt untersucht, wie die "Drei-Plus-Zwei-Formel" auf diese Zeit angewendet werden kann und wie das Feindbild des Kommunismus die neokonservative Ideologie prägte. Der Exkurs über den Kalten Krieg selbst liefert einen wichtigen Kontext.
4. Zeitabschnitt II: Zwischen 1989/90 und 9/11 - „Der unipolare Imperativ“ oder „Saddam Must Go!“: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Entwicklung des Neokonservatismus nach dem Ende des Kalten Krieges. Er stellt die neue Generation von Neocons vor, einschließlich Persönlichkeiten wie Charles Krauthammer und William Kristol. Die Rolle von Think Tanks in der Verbreitung neokonservativer Ideen wird untersucht. Die Analyse der "Drei-Plus-Zwei-Formel" in diesem Kontext beleuchtet den "unipolaren Imperativ" und die sich entwickelnde Fokussierung auf den Irak.
5. Zeitabschnitt III: Zwischen 9/11 und 2003 - „Neocons in Hochform“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Zeit nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Aufstieg der Neoconservativen innerhalb der Bush-Administration. Es analysiert die Rolle von Schlüsselfiguren wie Paul Wolfowitz und Richard Perle und untersucht, wie die "Drei-Plus-Zwei-Formel" den Weg zum Irakkrieg beeinflusste. Kriegspropaganda und die Forderung nach Präemption werden kritisch untersucht.
6. Zeitabschnitt IV: Nach 2003: „Neocons in der Krise – Teilweiser Rückzug von oder stures Festhalten an alten Positionen?“: Dieser Abschnitt analysiert die Entwicklungen nach dem Irakkrieg und die interne Debatte innerhalb der neokonservativen Bewegung. Es werden die Reaktionen auf den Irak-Krieg beleuchtet und die Frage diskutiert, ob die Bewegung von ihren Positionen abrückte oder an ihnen festhielt. Die Meinungen von Fukuyama und Podhoretz werden in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Schlüsselwörter
Neokonservatismus, USA, Außenpolitik, Kalter Krieg, Irak-Krieg, Manifest Destiny, Unipolarität, Präemption, Think Tanks, Norman Podhoretz, Irving Kristol, Charles Krauthammer, William Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Kontinuität, Ideologie, Quellenanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Neokonservatismus in den USA
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die außenpolitischen Zielvorstellungen des Neokonservatismus in den USA vom Kalten Krieg bis zum Irakkrieg. Der Fokus liegt auf dem Nachweis einer Kontinuität im neokonservativen Denken und der Analyse der Entwicklung dieser Ideologie und deren Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik. Die Heterogenität der neokonservativen Bewegung wird dabei berücksichtigt.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Quellenanalyse, die sich auf schriftliche Äußerungen anerkannter Neokonservativer und neokonservative Publikationen konzentriert. Diese Quellen werden in vier historische Zeitabschnitte kategorisiert, um die Entwicklung des neokonservativen Denkens nachzuvollziehen. Ein zentrales analytisches Werkzeug ist die von der Autorin entwickelte "Drei-Plus-Zwei-Formel", die die zentralen Axiome und reaktiven sowie interdependenten Momente der neokonservativen Ideologie beschreibt.
Welche Zeitabschnitte werden untersucht?
Die Arbeit gliedert sich in vier Zeitabschnitte: 1. Kalter Krieg bis 1989/90 ("Klar definiertes Feindbild Kommunismus"); 2. Zwischen 1989/90 und 9/11 ("Der unipolare Imperativ" oder "Saddam Must Go!"); 3. Zwischen 9/11 und 2003 ("Neocons in Hochform"); und 4. Nach 2003 ("Neocons in der Krise – Teilweiser Rückzug von oder stures Festhalten an alten Positionen?"). Jeder Abschnitt analysiert die neokonservative Ideologie im Kontext der jeweiligen historischen Ereignisse.
Welche zentralen Persönlichkeiten des Neokonservatismus werden analysiert?
Die Arbeit untersucht die Schriften und den Einfluss wichtiger neokonservativer Persönlichkeiten, darunter Irving Kristol, Norman Podhoretz, Charles Krauthammer, William Kristol, Paul Wolfowitz und Richard Perle. Die Analyse ihrer Werke soll die Entwicklung und die Kontinuität neokonservativer Ideen belegen.
Was ist die "Drei-Plus-Zwei-Formel"?
Die "Drei-Plus-Zwei-Formel" ist ein von der Autorin entwickeltes analytisches Modell, das die zentralen Axiome des Neokonservatismus beschreibt. Sie umfasst drei zentrale Axiome ("Neo-Manifest Destiny", "Battleship America", "From Evil Empire to the Axis of Evil") und zwei zusätzliche Momente (das reaktive und das interdependente Moment). Diese Formel dient als roter Faden durch die Analyse der verschiedenen Zeitabschnitte.
Welche Rolle spielen Think Tanks in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Think Tanks in den USA bei der Verbreitung neokonservativer Ideen, insbesondere im Kontext des Zeitabschnitts nach dem Ende des Kalten Krieges. Think Tanks werden als wichtige Akteure bei der Formierung und Verbreitung neokonservativer Politikvorstellungen dargestellt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf den Nachweis einer Kontinuität im neokonservativen Denken ab, trotz der Veränderungen im globalen Kontext. Sie analysiert, wie sich die neokonservative Ideologie über die verschiedenen Zeitabschnitte hinweg entwickelt hat und wie diese Entwicklung die amerikanische Außenpolitik beeinflusst hat. Die Schlussfolgerungen werden aus der Analyse der Quellen und der Anwendung der "Drei-Plus-Zwei-Formel" abgeleitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neokonservatismus, USA, Außenpolitik, Kalter Krieg, Irak-Krieg, Manifest Destiny, Unipolarität, Präemption, Think Tanks, Norman Podhoretz, Irving Kristol, Charles Krauthammer, William Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Kontinuität, Ideologie, Quellenanalyse.
- Quote paper
- Claudia Fröhling (Author), 2008, Neokonservatismus in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195723