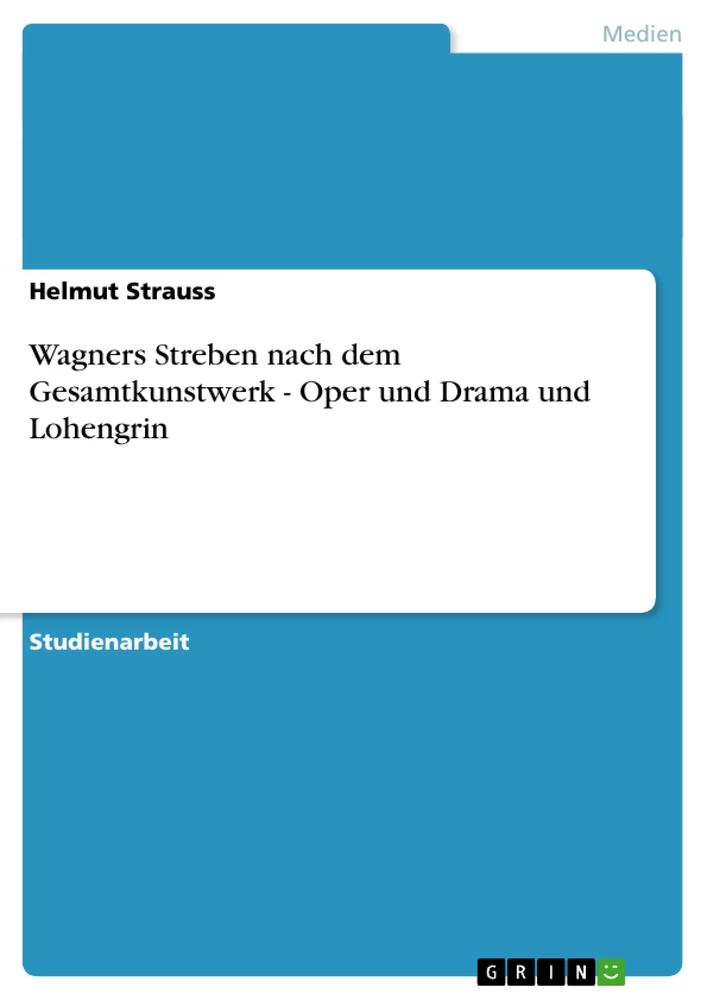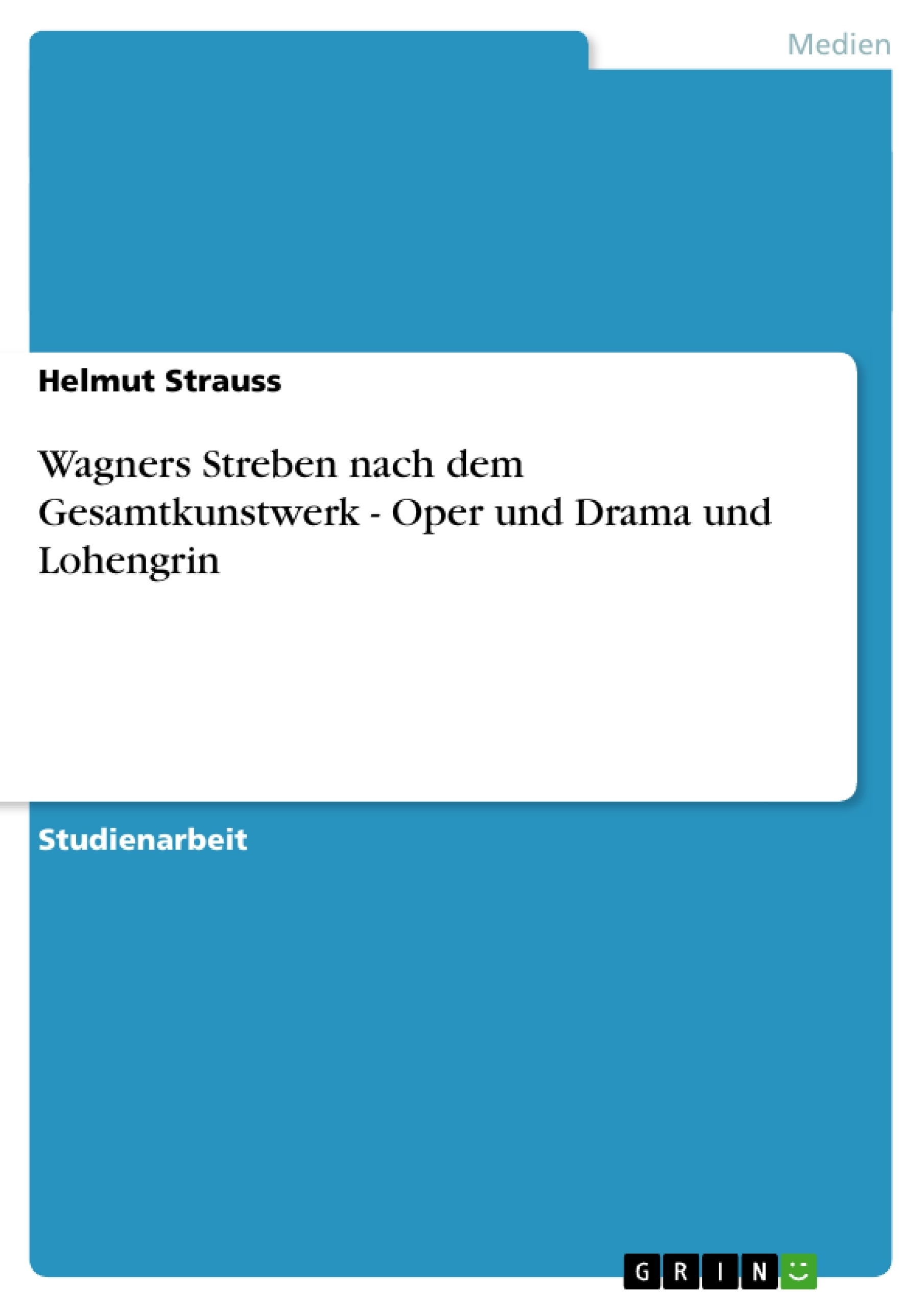Im Jahr 1878 bezeichnete Wagner gegenüber Cosima die Zürcher Kunstschriften als seine
eigentlichen Werke. Dadurch wird deutlich, wie wichtig für Wagners Selbstverständnis als Künstler
die theoretisch-programmatische Fundierung seines kompositorischen Schaffens war.1
In den Zürcher Kunstschriften „Die Kunst und die Revolution“, geschrieben im Juli 18492, „Das
Kunstwerk der Zukunft“, vollendet im November 18493 und schließlich „Oper und Drama“,
abgeschlossen am 10. Februar 18514, entwickelte Wagner seine Konzeption des
Gesamtkunstwerkes. Diese Schriften entstanden nach der Teilnahme Wagners am gescheiterten
Maiaufstand in Dresden 18495 und seiner Flucht nach Zürich in der „Lebenskrise des Exils“6. In den
fünf Jahren zwischen 1848 und 1853 verstummte Wagner im Gegensatz zur umfangreichen
theoretischen Tätigkeit als Komponist; nach dem „Lohengrin“ vollendete er bis zum „Rheingold“
kein Bühnenwerk mehr. Zwar entstanden 1850 Skizzen zu „Siegfrieds Tod“, doch brach Wagner
bezeichnenderweise die Arbeit in diesem Entwicklungsstadium vorerst ab.7
„Oper und Drama“ gilt als Wagners programmatische Hauptschrift; diese Wertung wurde aber
durchaus in Frage gestellt.8
1 Wagner, Cosima: Die Tagebücher. Ediert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack , Bd. 2: 1878-1883, München, 1977,
Anmerkung S. 154
2 Artikel „Die Kunst und die Revolution“, in: Gregor-Dellin, Martin und von Soden , Michael: Hermes Handlexikon Richard Wagner, Düsseldorf 1983, S.
100-102
3 Artikel „Das Kunstwerk der Zukunft“, in: Gregor-Dellin/von Soden , Handlexiko n, S. 102
4 Artikel „Oper und Drama“, in: Gregor-Dellin/von Soden, Handlexikon, S. 152f.
5 Gregor-Dellin, Martin: Richard Wagner. Sein Leben. Sein Werk. Sein Jahrhundert. Taschenbuchausgabe, München 1983, S. 259-276
6 Gregor-Dellin, Wagner, S. 278ff.
7 Dahlhaus, Carl: Zur Geschichte der Leitmotivtechnik bei Wagner, in: ders. (Hg.): Das Drama Richard Wagners als musikalisches Kunstwerk
(= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Band 23), Regensburg 1970, S. 17-36
8 vgl. Dahlhaus, Carl: Wagners Konzeption des musikalischen Dramas, Taschenbuchausgabe, München u.a., 1990, S. 11; Voss, Egon: Die Chöre im
„Lohengrin“ vor dem Hintergrund von „Oper und Drama“, in: Csampai, Attila und Holland, Dietmar (Hg.): Richard Wagner. Lohengrin. Texte,
Materialien, Kommentare, Reinbek bei Hamburg, 1989, S. 275-283
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wagners Gesamtkunstwerk
- Die formbildenden Elemente
- Das Problem der Anwendbarkeit - „Lohengrin“ und „Oper und Drama“
- Die Leitmotivverkettung am Beispiel des „Frageverbots“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Richard Wagners Streben nach dem Gesamtkunstwerk, insbesondere im Kontext seiner Schriften „Oper und Drama“ und der Oper „Lohengrin“. Die Analyse fokussiert auf die theoretischen Grundlagen von Wagners Konzept und dessen praktische Anwendung in seinen Werken.
- Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks und seine historischen Wurzeln
- Die formbildenden Elemente im Gesamtkunstwerk nach Wagner
- Die Anwendbarkeit von Wagners Theorie auf „Lohengrin“
- Leitmotivtechnik in „Lohengrin“
- Der Einfluss der griechischen Antike auf Wagners Ästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Bedeutung von Wagners theoretischen Schriften für sein künstlerisches Selbstverständnis. Sie situiert die Entstehung seiner Konzeption des Gesamtkunstwerks im Kontext seiner „Lebenskrise des Exils“ nach dem Dresdner Maiaufstand 1849 und weist auf die Bedeutung von „Oper und Drama“ als zentrale Schrift hin, deren Relevanz für „Lohengrin“ und den „Ring des Nibelungen“ diskutiert wird. Der Fokus der Arbeit wird auf die Analyse von Wagners Gesamtkunstwerk-Konzept und dessen Anwendung in „Lohengrin“ gelegt.
Wagners Gesamtkunstwerk: Dieses Kapitel untersucht Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks im Lichte der romantischen Kunsttheorie und der Philosophie Schellings. Es beleuchtet den Einfluss der griechischen Antike auf Wagners Denken und seine Kritik an der bestehenden Oper und dem modernen Drama. Wagner idealisiert das antike Drama als ein Gesamtkunstwerk, das Poesie, Musik und Tanz vereint, im Gegensatz zur modernen Oper, die er als Fehlentwicklung kritisiert. Die Kapitel analysiert Wagners dialektischen Ansatz, der vom Griechentum über die moderne Zivilisation zum Kunstwerk der Zukunft führt.
Die formbildenden Elemente: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keine detaillierte Beschreibung der formbildenden Elemente bietet, kann hier nur eine allgemeine Zusammenfassung gegeben werden). Dieses Kapitel würde im vollständigen Text die spezifischen Elemente beschreiben, die Wagner als konstitutiv für die Einheit seines Gesamtkunstwerks ansah. Dies könnte Aspekte wie die Verschmelzung von Musik, Dichtung, Tanz und Bühnenbild umfassen, und wie diese Elemente in seiner Theorie zusammenwirken, um ein kohärentes und sinnhaftes Ganzes zu schaffen.
Das Problem der Anwendbarkeit - „Lohengrin“ und „Oper und Drama“: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit Wagners Theorie des Gesamtkunstwerks, wie sie in „Oper und Drama“ dargelegt wird, auf seine Oper „Lohengrin“ anwendbar ist. Es analysiert die Übereinstimmung und Abweichung zwischen Theorie und Praxis. Es wird die Frage diskutiert, ob „Oper und Drama“ primär als Ausdruck von Wagners musikdramatischem Bewusstsein im Jahr 1850 zu sehen ist und ob „Lohengrin“ als ein Beispiel für die Umsetzung seiner Ideale gelten kann.
Schlüsselwörter
Gesamtkunstwerk, Richard Wagner, Oper und Drama, Lohengrin, Leitmotiv, griechische Antike, Romantische Kunsttheorie, Schelling, Musikdrama, Synthese der Künste.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Richard Wagners Gesamtkunstwerk in "Lohengrin"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Richard Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks, insbesondere im Kontext seiner Schrift „Oper und Drama“ und der Oper „Lohengrin“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der theoretischen Grundlagen und deren praktischen Anwendung in Wagners Werken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks und seine historischen Wurzeln, die formbildenden Elemente im Gesamtkunstwerk, die Anwendbarkeit von Wagners Theorie auf „Lohengrin“, die Leitmotivtechnik in „Lohengrin“, und den Einfluss der griechischen Antike auf Wagners Ästhetik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Wagners Gesamtkunstwerk, ein Kapitel zu den formbildenden Elementen, ein Kapitel zur Anwendbarkeit der Theorie auf „Lohengrin“ und „Oper und Drama“, und einen Schluss. Die Einleitung situiert Wagners Konzept im Kontext seiner „Lebenskrise des Exils“ und hebt die Bedeutung von „Oper und Drama“ hervor. Das Kapitel zu Wagners Gesamtkunstwerk beleuchtet den Einfluss der griechischen Antike und Schellings Philosophie. Das Kapitel zu den formbildenden Elementen beschreibt die Elemente, die Wagner als konstitutiv für die Einheit seines Gesamtkunstwerks ansah (detaillierte Beschreibung fehlt im Auszug). Das Kapitel zur Anwendbarkeit untersucht die Übereinstimmung und Abweichung zwischen Wagners Theorie und Praxis in „Lohengrin“.
Wie wird Wagners Gesamtkunstwerk-Konzept beschrieben?
Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks wird im Kontext der romantischen Kunsttheorie und der Philosophie Schellings untersucht. Es wird seine Kritik an der bestehenden Oper und sein Ideal des antiken Dramas als vereinigte Form von Poesie, Musik und Tanz beleuchtet. Wagners dialektischer Ansatz, der vom Griechentum über die moderne Zivilisation zum Kunstwerk der Zukunft führt, wird analysiert.
Welche Rolle spielt "Lohengrin" in der Analyse?
„Lohengrin“ dient als Fallbeispiel zur Untersuchung der Anwendbarkeit von Wagners Theorie des Gesamtkunstwerks. Die Arbeit analysiert, inwieweit die in „Oper und Drama“ dargelegte Theorie in „Lohengrin“ umgesetzt wurde, und diskutiert Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Theorie und Praxis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gesamtkunstwerk, Richard Wagner, Oper und Drama, Lohengrin, Leitmotiv, griechische Antike, Romantische Kunsttheorie, Schelling, Musikdrama, Synthese der Künste.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den formbildenden Elementen?
Der bereitgestellte Text enthält keine detaillierte Beschreibung der formbildenden Elemente. Diese Informationen wären im vollständigen Text zu finden.
Was ist der Zweck der Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema ein, betont die Bedeutung von Wagners theoretischen Schriften für sein künstlerisches Selbstverständnis und situiert die Entstehung seiner Konzeption des Gesamtkunstwerks im Kontext seiner „Lebenskrise des Exils“ nach dem Dresdner Maiaufstand 1849. Sie hebt die zentrale Bedeutung von „Oper und Drama“ für „Lohengrin“ und den „Ring des Nibelungen“ hervor und legt den Fokus der Arbeit auf die Analyse von Wagners Gesamtkunstwerk-Konzept und dessen Anwendung in „Lohengrin“ dar.
- Quote paper
- Helmut Strauss (Author), 2001, Wagners Streben nach dem Gesamtkunstwerk - Oper und Drama und Lohengrin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19567