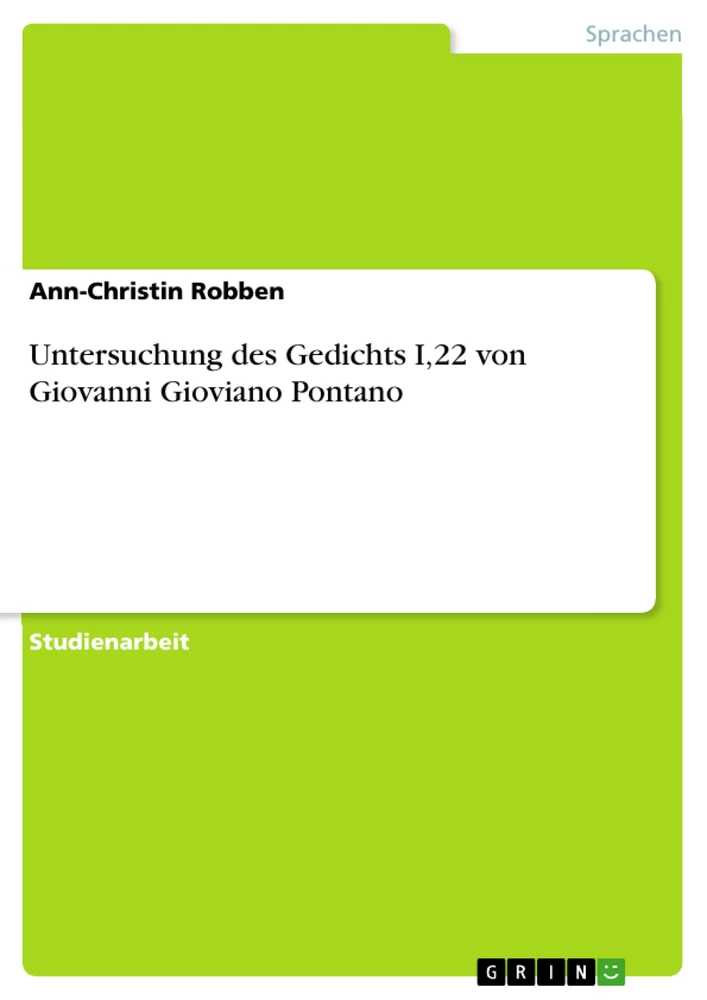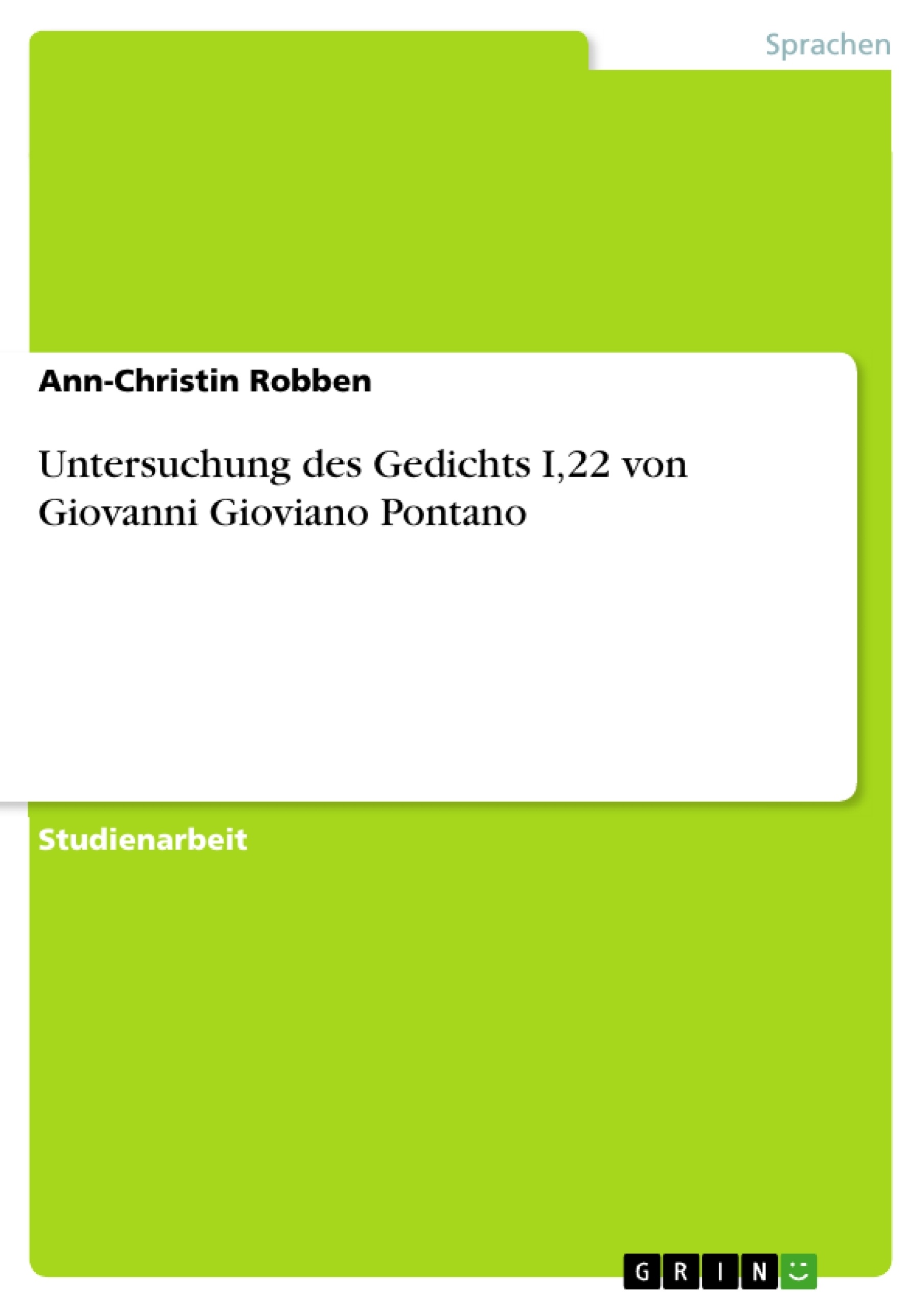Die inhaltliche Schwerpunktsetzung in Gedicht I,22 ist auf den ersten Blick untypisch für Giovanni Gioviano Pontano, der vordergründig in seinem Werk „Baiae“ detailgetreu erotische zwischenmenschliche Beziehungen schildert, die oftmals auf keiner festen Bindung beruhen. In dem vorliegenden Gedicht steht jedoch die beständige Liebe zwischen zwei Partnern im Vordergrund. Er greift die turtures als Metaphern für die ewige, innige Liebe auf und befragt diese nach einem „Rezept“ ihrer Partnerschaft. Er stellt ihrer Liebe und Treue die oftmals unbeständigen und unglücklichen Liebschaften der Menschen gegenüber. Auf den zweiten Blick enthält das Gedicht jedoch einen Appell zur Ausübung von Liebe und Leidenschaften – dies wiederum entspricht eher dem Stil Pontanos. Im weiteren Verlauf des Referats sollen diese beiden Facetten des Gedichts deutlicher werden.
1 Einleitung
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung in Gedicht I,22 ist auf den ersten Blick untypisch für Giovanni Gioviano Pontano, der vordergründig in seinem Werk „Baiae“ detailgetreu erotische zwischenmenschliche Beziehungen schildert, die oftmals auf keiner festen Bindung beruhen. In dem vorliegenden Gedicht steht jedoch die beständige Liebe zwischen zwei Partnern im Vordergrund. Er greift die turtures als Metaphern für die ewige, innige Liebe auf und befragt diese nach einem „Rezept“ ihrer Partnerschaft. Er stellt ihrer Liebe und Treue die oftmals unbeständigen und unglücklichen Liebschaften der Menschen gegenüber. Auf den zweiten Blick enthält das Gedicht jedoch einen Appell zur Ausübung von Liebe und Leidenschaften – dies wiederum entspricht eher dem Stil Pontanos. Im weiteren Verlauf des Referats sollen diese beiden Facetten des Gedichts deutlicher werden.
2 Adressat des Gedichts I,22
Im Folgenden soll auf den Adressaten des Gedichts, die Turteltaube (streptopelia turtur), näher eingegangen werden. Allerdings wird keine ausführliche Artenbeschreibung folgen, sondern es findet eine Beschränkung auf die für diese Thematik relevanten Aspekte statt.
Die Turteltaube hat ihren Namen aufgrund ihres ausdauernden Gurrens, das besonders häufig in mediterranen Gegenden zu hören ist, erhalten – Ihr typisches Turteln klingt etwa wie „turr-turr“.[1] Sie gilt als Glücks- und Liebessymbol, sodass man zwei frisch verliebte Menschen umgangssprachlich auch „Turteltäubchen“ nennt. Ihre Symbolfunktion leitet sich von ihrem beobachteten Paarungsverhalten ab: Ein Turteltaubenpaar, das einmal zueinander gefunden hat, verbringt sehr viel Zeit am Nistplatz mit „turteln“. Das Pärchen sitzt ständig eng beieinander, pflegt gegenseitig sein Gefieder und widmet viel Zeit dem so genannten Schnäbeln, welches von ständigem leisem Gurren, dem Turteln begleitet wird. Der Beobachter erhält den Eindruck, dass die beiden Tauben einander sehr vertraut und untrennbar verbunden sind. Ihnen werden in der Tiersymbolik Synonyme wie eheliche Treue, Verliebtheit und Zärtlichkeit zugeschrieben. Es ist jedoch erwiesen, dass der Paarbund der Turteltaube nur eine Brutsaison andauert, allerdings brüten die Pärchen oftmals auch in den Folgejahren miteinander, was aber bislang noch darauf zurückgeführt wird, dass beide nach den Wintermonaten zum selben Nistplatz zurückkehren.[2]
Die Turteltaube hat vielfach Eingang in Werke bekannter Literaten, wie beispielsweise William Shakespeares „Der Phoenix und die Turteltaube“ gefunden. Auch der Schriftsteller Johann Gottfried von Herder widmet ihr ein ganzes Gedicht. Bereits antike Autoren wie Catull und Properz haben die Symbolik der Turteltaube in ihren literarischen Stücken aufgegriffen. Die Tatsache, dass die Turteltaube auch Erwähnung bei Catull findet, ist für dieses Referat von Bedeutung, da Catull Pontano als Vorlage diente und Pontano „den Renaissanceanspruch, Catullnachfolger zu sein“[3] für sich einnimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Turteltaube – streptopelia turtur
(entnommen von: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Turteltaube, Stand: 03.07.2010)
3 Sprachliche und inhaltliche Analyse des Gedichts
Das Gedicht ist geprägt von rhetorischen Fragen (V.9f., 11-14, 17ff., 20f.), die darauf hinweisen, dass das lyrische Ich in diesem Gedicht versucht über die Natur der ewigen Liebe und Treue zu forschen, wie es bereits die Überschrift des Gedichts ankündigt. Die Dringlichkeit der Nachforschungen des lyrischen Ichs wird zum einen durch die zweimalige Verwendung des Imperativs dicite in V. 9 und V. 22 unterstrichen und zum anderen durch obsecro in V. 9, welches die Wichtigkeit der Frage für das lyrische Ich ausdrückt, wie auch durch die Epanalepsen (Doppelung – Wiederaufnahme) in den Versen 12 und 17 des Fragewortes cur. Immer wieder werden die turtures direkt angesprochen (V. 2, 7, 22), um von ihnen eine Aussage auf die gestellte Schlüsselfrage zu bekommen, die sich in den Versen 9f. finden lässt:
[...]
[1] Vgl. Schweizer Vogelwarte: URL: http://www.vogelwarte.ch (letzter Zugriff: 04.07.2010).
[2] Vgl. Kappeler, Markus (2002): URL: http://www.markuskappeler.ch/tex/texs2/turteltaube.html (letzter Zugriff: 04.07.2010).
[3] Schmidt, Ernst A.: Catullisch, catullischer als Catull, uncatullisch – Zu Giovanni Pontanos Elfsilblergedichten, S. 204. In: Baier, Thomas (Hrsg.): Pontano und Catull. Tübingen 2003 (NeoLatina 4).
- Quote paper
- Master of Education Ann-Christin Robben (Author), 2010, Untersuchung des Gedichts I,22 von Giovanni Gioviano Pontano, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195566