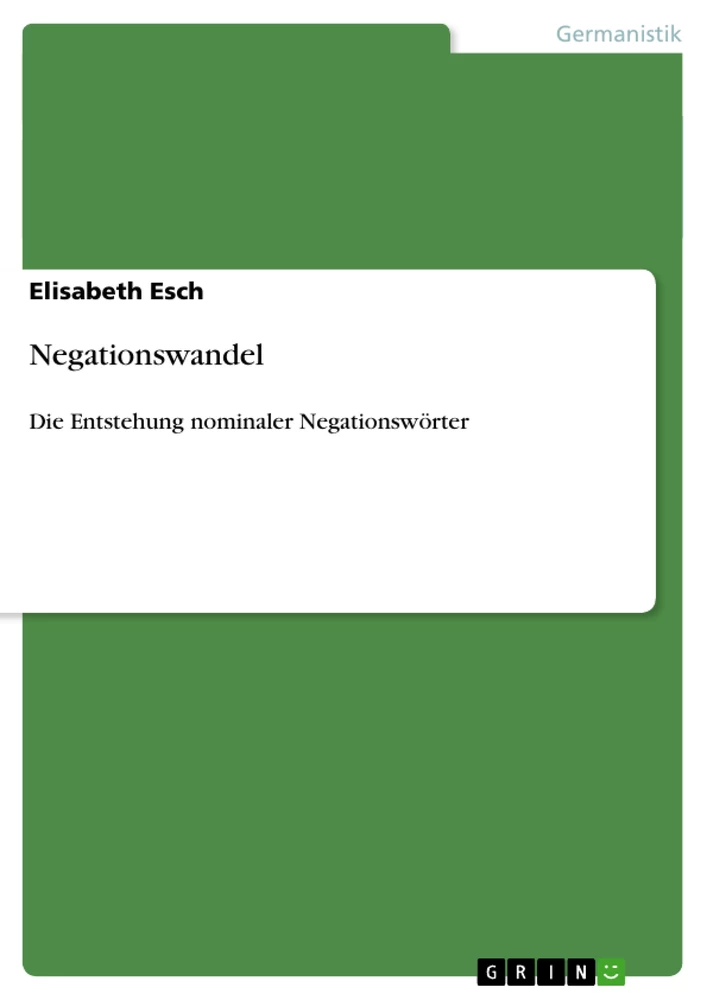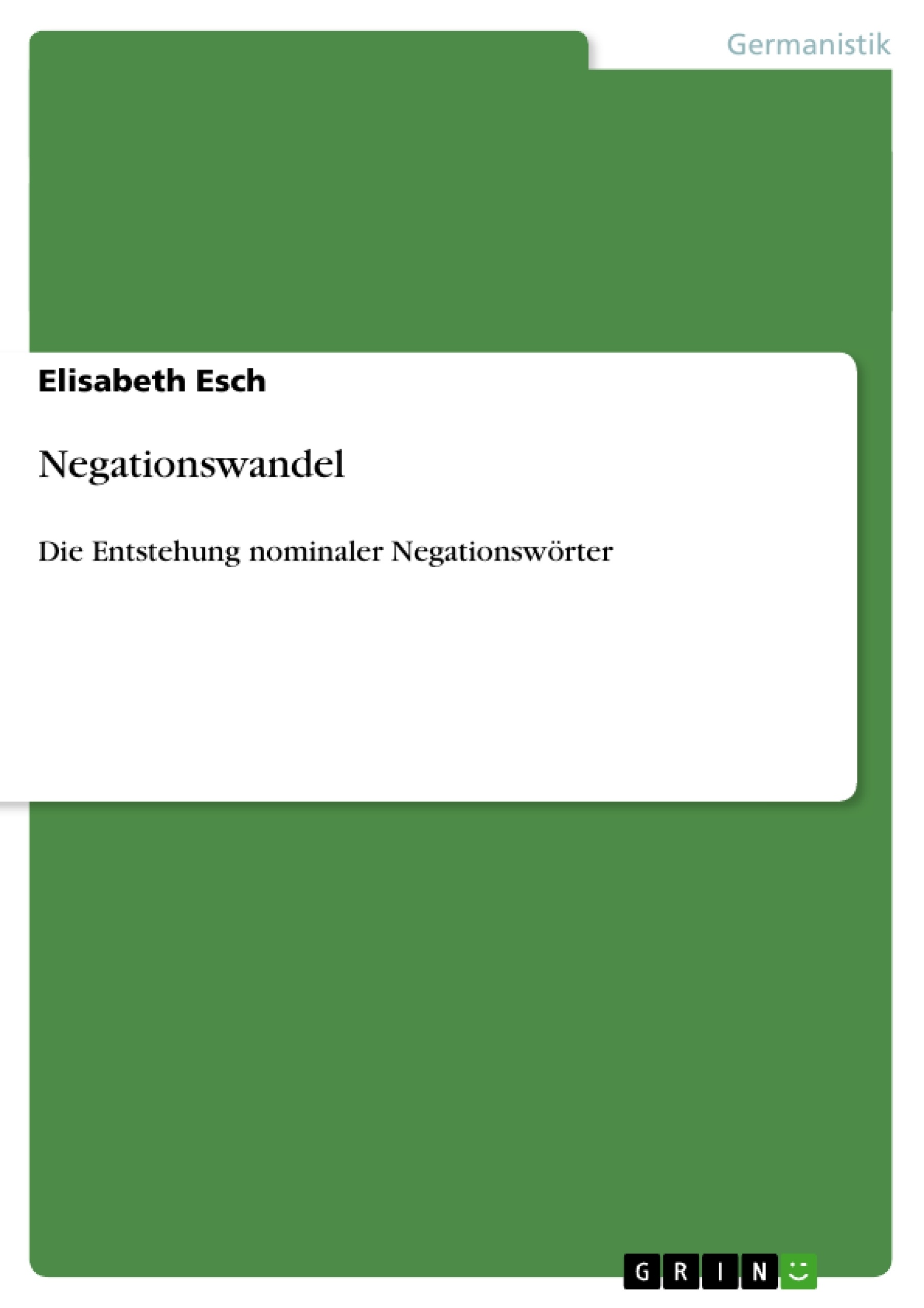Renate Szczepaniak beschäftigt sich unter anderem mit dem Sprachwandel der Negation. In allen Sprachen ist die Möglichkeit vorhanden, eine Aussage zu ne-gieren oder einem Sachverhalt zu widersprechen. Aus diesem Grund ist die Negation universal. In der deutschen Sprache erneuern sich die Negatoren im Laufe der Zeit sowohl anhand ihrer Position als auch ihrer Form. Zudem zeigen sich immer zahlreichere Negationsformulierungen.
Die folgende Ausarbeitung wird die Entstehungsgeschichte der Negation in der deutschen Sprache erläutern. Die Negation verändert sich in dem Zeitraum vom 9. bis zum 17. Jahrhundert. Zunächst wird explizit auf den Jespersen-Zyklus eingegangen, der aufzeigt, wie aus dem ahd. ni das nhd. nicht entstanden ist. Daraufhin wird beschrieben, wie sich aus dem ahd. Morphem wiht die Form über-haupt nichts und aus ni io wiht das nhd. nicht entwickelt hat. Im Anschluss daran wird das Aufkommen der nominalen Negatoren beleuchtet, wie beispielsweise niemand oder nichts. Zum Schluss wird kurz erläutert, wie kein entstanden ist, da dieses Morphem formal von den anderen nominalen Negationswörtern Ab-weichungen zeigt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Jespersen-Zyklus
3. Grammatikalisierung von nicht als Negationsträger
4. Die Entstehung nominaler Negationswörter
5. Fazit
6. Abkürzungsverzeichnis
7. Bildnachweis
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Renate Szczepaniak beschäftigt sich unter anderem mit dem Sprachwandel der Negation. In allen Sprachen ist die Möglichkeit vorhanden, eine Aussage zu negieren oder einem Sachverhalt zu widersprechen. Aus diesem Grund ist die Negation universal. In der deutschen Sprache erneuern sich die Negatoren im Laufe der Zeit sowohl anhand ihrer Position als auch ihrer Form. Zudem zeigen sich immer zahlreichere Negationsformulierungen.
Die folgende Ausarbeitung wird die Entstehungsgeschichte der Negation in der deutschen Sprache erläutern. Die Negation verändert sich in dem Zeitraum vom 9. bis zum 17. Jahrhundert. Zunächst wird explizit auf den Jespersen-Zyklus eingegangen, der aufzeigt, wie aus dem ahd. ni das nhd. nicht entstanden ist. Daraufhin wird beschrieben, wie sich aus dem ahd. Morphem wiht die Form überhaupt nichts und aus ni io wiht das nhd. nicht entwickelt hat. Im Anschluss daran wird das Aufkommen der nominalen Negatoren beleuchtet, wie beispielsweise niemand oder nichts. Zum Schluss wird kurz erläutert, wie kein entstanden ist, da dieses Morphem formal von den anderen nominalen Negationswörtern Abweichungen zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.Der Jespersen-Zyklus
Der Jespersen-Zyklus, der zurück geht auf Otto Jespersen, zeigt die Renovation der Negation in der deutschen Sprache. Er verdeutlicht, dass das ahd. freie Morphem ni, welches das einzige Negationswort zu dieser Zeit ist, zunächst phonetisch abgeschwächt wird zu dem spätahd. ni/ ne. Dabei verschmolz dieses Morphem oft mit dem darauffolgendem Verb. Die ahd. Negationsphrase ni (eo) wiht entwickelt sich, die oft eine Aussage verstärken soll. Durch Verschmelzung der Wörter verbreitet sich die Negation ni(o)wiht, die im mhd. zu niht wird. Im Mittelhochdeutschen taucht eine Negation auf, die aus einem klitischen Wort en-, ne- oder -n und aus dem freien Morphem niht besteht (ne... niht). Im Verlauf der Zeit verschwindet allmählich das abhängige unbetonte Morphem en/ ne/ n und es entsteht das heute verwendete Negationswort nicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Jespersen-Zyklus beginnt und endet mit einem „mononegative(m) System“ (Szczepanik 2011: 44). Das bedeutet, dass die freien Morpheme ni und nicht ausreichen, um eine Aussage zu verneinen. Im Mittelhochdeutschen wird eine „Polynegation“ (ebd.) angewendet, um eine Negierung zu verstärken (vgl. ebd: 43-45).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Grammatikalisierung von nicht als Negationsträger
Das freie ahd. Morphem wiht, welches mit Ding oder Sache übersetzt werden kann, verändert sich im Laufe der Zeit zum mhd. niht und später zum nhd. nicht. Wiht gehört zu den „Generalisierer(n)“ (ebd.: 47), weil mit ihm allgemeine Ge- genstände bezeichnet werden können und dadurch die Negation relativ universell fungiert. Neben den Generalisierem gibt es auch die „Minimierer“ (ebd.: 48), die als Negationswörter kleine Gegenstände beschreiben, wie zum Beispiel drof (Tropfen). Das Wort wiht wird zunehmend routiniert benutzt, um eine Aussage zu verstärken. Es ist dabei auf einen negierenden Kontext beschränkt, da es im Zusammenhang mit einem falschen Satzinhalt oder Vorwurf steht, und gehört somit zu den sogenannten „negativ-polare(n) Elemente(n)“ (ebd.: 45).
Die Verstärkung geschieht dadurch, dass „nicht ein Ding [wiht]“ (ebd.: 46) gesagt wird, aber eine bedeutungsvollere Aussage „überhaupt nichts“ (ebd.: 45) impliziert wird. Durch die so entstehende konversationelle Implikatur verliert wiht zunehmend seinen lexikalischen Inhalt, da es seine ursprüngliche Bedeutung verliert und vermehrt „als Marker einer emphatischen Negation“ (ebd.: 46) genutzt wird. Wiht wird zu dem Ausdruck überhaupt nichts. Das Wort wiht kann im weiteren Verlauf immer häufiger im Zusammenhang mit intransitiven Verben auftreten, da es ansonsten meist als „Pseudo-Objekt“ (ebd.: 47) verwendet wird. Das Wort niowiht entsteht durch phonologische Prozesse aus der Formulierung ni io wiht. Aus diesem Morphem erwächst schließlich niouuiht, welches das Fundament für das heutige nicht ist. Bei ni(e)ht vollzieht sich ein „Frequenzanstieg“ (ebd.: 48), weil das Morphem in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts nicht mehr emphatisch genutzt, sondern durch regelmäßige Anwendung als „unmarkierte Ne - gation“ (ebd.) gehandhabt wird. Denn ni(e)ht, welches zur Verstärkung für die Negierung von nicht erwünschten Situationen oder bei Enttäuschungen eingesetzt wird, wird oft überspitzt genutzt und somit zu einem unmarkierten Negationswort. Dadurch entstehen zusätzliche Ausdrücke, die eine Negation kennzeichnen. Die diskontinuierliche Form von Verneinung ne-/ en- ... ni(e)ht wird häufiger verwendet. Allmählich wird ne-/ en- zu einem negativ-polaren Element und verliert sein verneinendes Potenzial. Es handelt sich demnach bei ne um eine „expletive, d.h. ergänzende Negation“ (ebd.: 49), wie auch das heutige nicht in einigen Fällen dazu gezählt werden kann. Ne-/ en- wird im Mittelhochdeutschen stark zurückgedrängt, so dass niht alleine eine Aussage verneinen kann. Schließlich entsteht spätestens im 18. Jahrhundert aus diesem niht das neuhochdeutsche nicht (vgl. ebd.: 48-49).
Weitere Formulierungen zur Emphase der Negation im Mittelhochdeutschen sind beispielsweise „niht ein blat, niht ein strô, niht ein bast, niht ein hâr, niht eine.
[...]
- Quote paper
- Elisabeth Esch (Author), 2012, Negationswandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195114