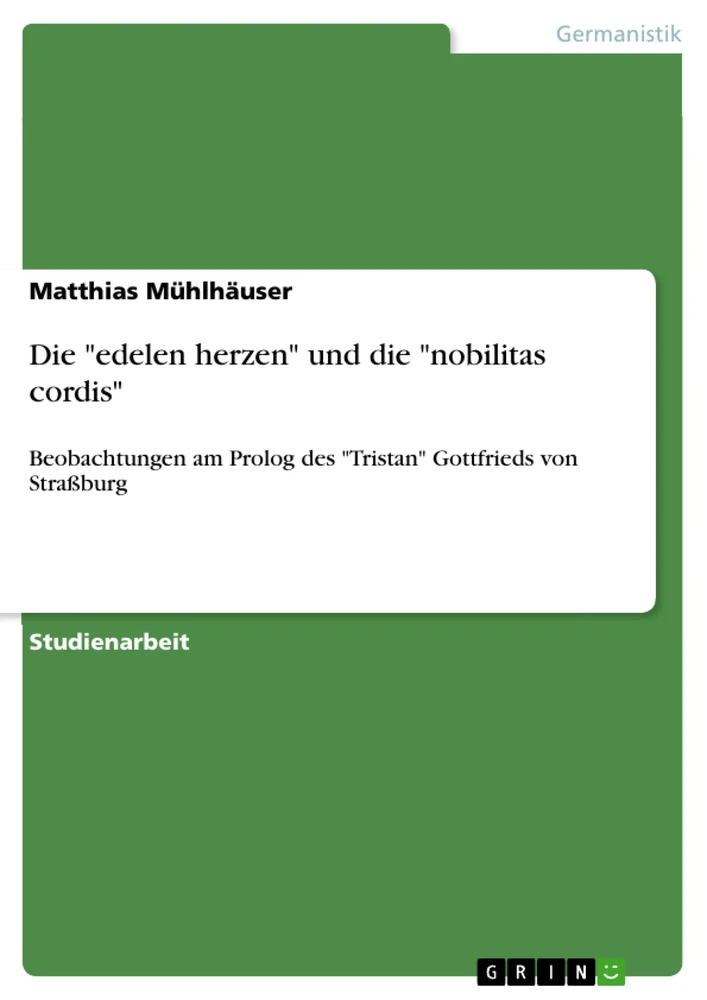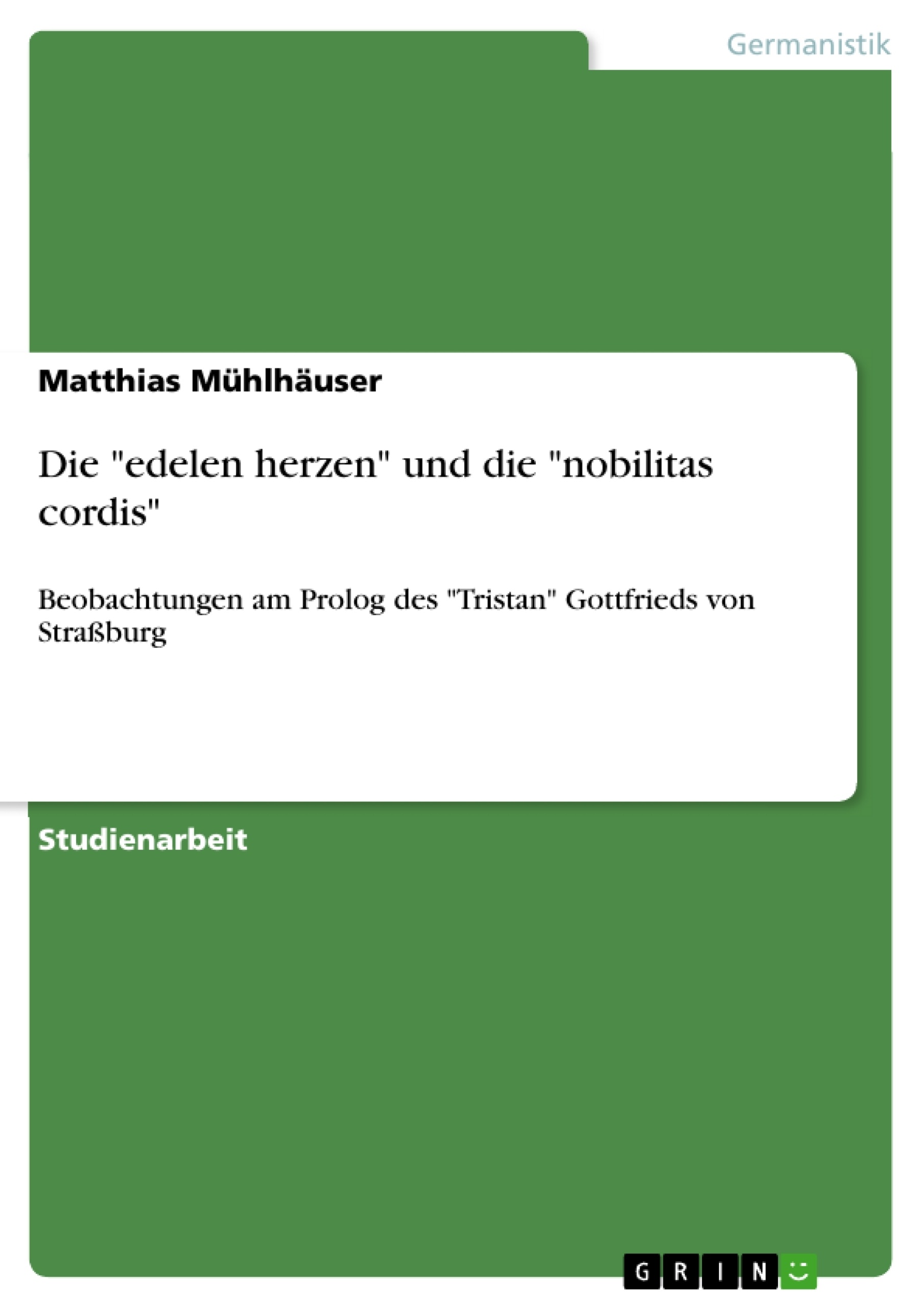Gemeinhin werden Prologe und Vorwörter wie auch Einleitungen zu einem Zeitpunkt verfasst, da das Hauptwerk in seiner geschlossenen und einem intendierten Rezipientenkreis angepassten Form bereits vorliegt. Gehen Schriften der Gegenwartsliteratur häufig ganz unvermittelt in medias res und verzichten auf einleitende Worte, so liegt dies nicht selten an den multimedialen Ausformungen zeitgenössischer Werbung, deren Funktion in den preelektronischen Epochen der Prolog übernahm, insofern dieser auch mittels der "caritativ benevolentiae" eine günstige Stimmung für eine adäquate Aufnahme des Werks erzeugen sollte. Fakultativ wendet sich der Autor außerdem an einen Musterleser als einem möglichen Dialogpartner, dessen kulturelles Weltbild weitestgehend dem seinen entspricht und es ihm ermöglicht, den komplizierten Verweisen innerhalb eines interkulturellen und intertextuellen Konnexes zu folgen.
Im griechischen Drama bezeichnete der Prolog noch den ganzen Teil der Tragödie vor dem Einzug des Chores, welcher bis dahin die Erläuterung der dramatischen Handlung vornimmt. So erscheint der Prolog bei Euripides als monologischer Bericht über die Situation bei Ausgang der Handlung, der nicht nur die auftretenden Personen vorstellt, sondern außerdem bereits zentrale Teile des Handlungsgangs vorwegnimmt. Doch scheint im europäischen Mittelalter die griechische Dramatik unbekannt gewesen zu sein. Die Funktion und die Bestimmung des Prologs in den mittelalterlichen Epen ist mithin eine andere, zumal das Drama des Altertums im Mittelalter keine Fortsetzung fand.
Inhaltsverzeichnis
- Die „Zweiteilung“ des Prologs in den Epen des Mittelalters
- Der Prolog in den literarischen Werken des Mittelalters
- Das Prooemium als ein prologus praeter rem
- Der prologus praeter rem – strophischer Teil
- Der prologus praeter rem – stichischer Teil
- Die edelen herzen
- Zur Adäquanz von Übertragungen
- Die Gemeinschaft der edelen herzen
- Eine Welt im Spannungsfeld der Gegensätze
- Der prologus ante rem
- Die,,richtige“ Erzählung
- Zur Eucharistie-Frage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prolog des Tristan-Romans von Gottfried von Straßburg und analysiert dessen Bedeutung für das gesamte Werk. Sie befasst sich insbesondere mit dem Konzept der "edelen herzen", der Zielgruppe, an die sich Gottfried in seinem Prolog wendet, und deren Bedeutung für das Verständnis seiner Dichtung.
- Die Rolle des Prologs in mittelalterlichen Epen
- Die "Zweiteilung" des Prologs: prologus praeter rem und prologus ante rem
- Die Bedeutung der "edelen herzen" als spezifische Rezipienten
- Die Funktion des Prologs in der Konstruktion des Tristan-Mythos
- Das Verhältnis von Moral und Erotik im Tristan-Roman
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Prolog in den literarischen Werken des Mittelalters befasst sich mit der Funktion von Prolog und Vorwort in der mittelalterlichen Literatur. Dabei werden die verschiedenen Formen des Prologs im griechischen Drama sowie in der lateinischen Prologtheorie untersucht, bevor der Fokus auf den Prolog als Mittel zur Herstellung einer Verbindung zwischen Autor, Werk und Rezipienten gelenkt wird.
- Kapitel 2: Die „Zweiteilung“ des Prologs in den Epen des Mittelalters behandelt die von Brinkmann eingeführte Unterscheidung zwischen prologus praeter rem und prologus ante rem. Dabei werden die beiden Teile des Prologs in ihrer Funktion und Bedeutung für die Gestaltung des Werks analysiert.
- Kapitel 3: Das Prooemium als ein prologus praeter rem analysiert die Funktion des ersten Teils des Prologs in Gottfrieds Tristan, der in zwei Abschnitte unterteilt wird. Der erste Teil behandelt den Wert der Dichtung im Allgemeinen, während der zweite Teil eine Verbindung zwischen dem Autor, den Protagonisten und dem Leser herstellen soll.
Schlüsselwörter
Prolog, Tristan, Gottfried von Straßburg, mittelalterliche Literatur, Epen, prologus praeter rem, prologus ante rem, edele herzen, Rezipienten, höfische Gesellschaft, Moral, Erotik.
- Citar trabajo
- M.A. Matthias Mühlhäuser (Autor), 2010, Die "edelen herzen" und die "nobilitas cordis", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195109